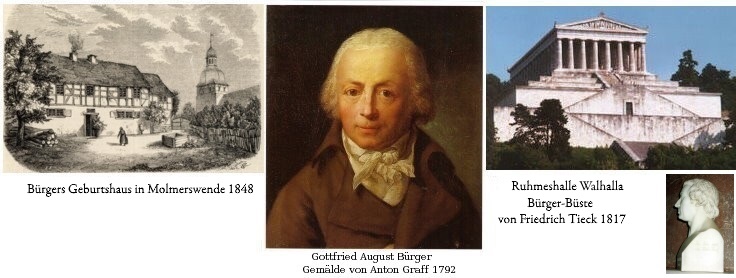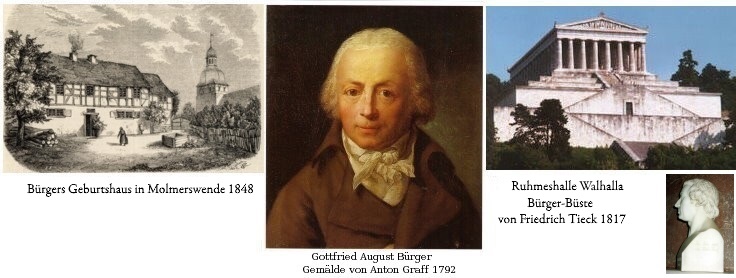|
|
Bürger-Rezeption Volltexte 1950 bis heute
bis 1789 1790-1799 1800-1806 1807-1815 1816-1821 1822-1825 1826-1828 1829-1831
1832-1836 1837-1840 1841-1845 1846-1850 1851-1855 1856-1858 1859-1861 1862-1865
1866-1868 1869-1870 1871-1880 1881-1897 1898-1915 1916-1949 ab 1950
|
|
1954
|
Fechter, Paul. Goethe und Schiller. In: Geschichte der deutschen Literatur.
“[S. 186] Es war mehr als Zufall, daß Schiller mit einer sehr harten Kritik den letzten echten Bänkelsänger Gottfried August Bürger (1747-1794) aus dem Sattel hob. Bürger, im Leben
durch die Problematik einer Art von Doppelehe mit zwei Schwestern in schwere Verwirrungen geraten, kam von Percys Relics aus zu einer Form der Ballade, in der noch Leben war. Seine ´Lenore´, im Rhythmus der alten
englischen Ballade von der Chevy-Chase dahineilend, war letzter echter Bänkelsang, und ´Des Pfarrers Tochter von Taubenheim´ hatte den lebendigen Dienstbotenklang, den die echte Volksballade auch brauchte. Sie haben
nichts mit Schillers Bildungsballaden zu tun; sie stammen aus demselben Boden wie die Geschichten vom Baron Hieronymus von Münchhausen, die Bürger nach Raspes Vorbild herausbrachte.”
|
|
1954
|
Leschnitzer, Franz. G. A. Bürger - Ein plebejischer Dichter. In: Programmerklärung des Ministeriums für Kultur der Deutschen Demokratischen Republik zur Verteidigung der Einheit
der deutschen Kultur, Neue Deutsche Literatur, Beilage zu Heftt 5, Jahrgang
"[S. 110] Also an inhaltsarmer Leidenschaftlichkeit standen die eigentlichen Hainbündler in keiner Weise dem jungen G. A. Bürger nach. Auch seine ärgere wirtschaftliche Bedrängnis
- er war damals ein kleiner Justizbeamter in einem Nest bei Göttingen - reicht zur Erklärung seiner exklusiven Stellung im Hainbund nicht hin; eine vulgärsoziologische Deutung seines Verhaltens wäre um so
fehlerhafter, als die beiden einzigen aristokratischen Hainbündler,die Grafen zu Stolberg, besonders der jüngere: Friedrich Leopold zu Stolberg, sich noch bei weitem radikaler als die kleinbürgerlichen
Bundesmitglieder gebärdeten. Vielmehr ist Bürgers Hinneigung zu Wielands Sensualismus vor allem aus seinem ungewöhnlich früh und ungemein stark entwickelten Verständnis für die ideologischen Ereignisse im
vorrevolutionären Frankreich zu erklären. Während die eigentlichen Hainbündler nichts andres als Klopstockverehrer sein wollten und waren, wurzelte Bürger nicht nur in der christlich-asketischen Sphäre der
´Messias´-Periode Klopstocks und in der hellenistisch-hedonistischen der ´Musarion´-Periode Wielands, sondern auch tief in jenem rationalistischen Sensualismus, dem in Frankreich am Vorabend der Revolution von 1789
sämtliche Enzyklopädisten, alle bürgerlich-revolutionären Ideologen anhingen.
[S. 111] Bürger war Shakespeare und Voltaire zugetan. Den Antirationalismus der Hainbündler, der sie gegen Voltaire aufbrachte
(mit Lessings revolutionären Argumenten gegen Voltaire hatten die gleichgerichteten Emotionen der Hainbündler nichts gemein) - diesen Antirationalismus unterstützte Bürger ebensowenig wie ihren Antisensualismus, der
sie zu Verächtern Wielands machte. [...] Der Ausdruck ´plebejisch´ ist im Titel wie durchweg im Text des vorliegenden Aufsatzes in jenem positiven Sinn gebraucht, den ihm mit Recht die Klassiker des Marxismus
beilegten, namentlich Marx, wenn er etwa von der ´plebejischen Manier´ der konsequentesten bürgerlichen Revolutionäre sprach, ´mit den Feinden der Bourgeoisie, dem Absolutismus, dem Feudalismus und dem
Spießbürgertum fertig zu werden´.
[S. 112] Am schärfsten ist Schillers Kritik dort, wo sie offenkundig eine retrospektive Selbstkritik ist; da wirkt sie gradezu wie die Selbstgeißelung eines Konvertiten.
Zugleich mit Bürgers noch fortgesetzter Sturm- und Drangzeit sucht Schiller seine eigne schon abgeschlossene ein zweitesmal von sich zu weisen; er verurteilt, wenn er sich beispielsweise gegen den ´zu sinnlichen,
oft gemeinsinnlichen Charakter´ der Muse Bürgers wendet, im Grunde nichts andres als die frühere eigne Muse, die ihm zehn Jahre vorher nicht nur ein Drama im Stil des Hainbündlers Leisewitz eingegeben hatte (´Die
Räuber´, geschrieben in Anlehnung an Leisewitz' Stück ´Julius von Tarent´), sondern auch etliche Gedichte vom Genre Bürgers (´Der Venuswagen´, ´Die schlimmen Monarchen´).
[S. 113] Also Aufhebung der
Klassengegensätze durch ´reine Kunst, durch Erreichung eines allgemeingültigen ästhetischen Ideals! Selbst das ´Leidenschaftsbedürfnis des Volks´, das der Plebejer Bürger auf revolutionäre Art zu stillen suchte,
hätte er nach Schiller lediglich ´für die Reinigung der Leidenschaft nutzen´ sollen. Überhaupt hätte er das Volk, die Masse, den ´großen Haufen´ als ein Menschen-Konglomerat ansehn sollen, zu dem man als Poet
´hinabsteigt´; [...] Wiederum wird hier also ein Plus Bürgers von Schiller in ein Minus verwandelt: Bürgers Demokratismus wird verworfen; und just der Autor der ´Verschwörung des Fiesco zu Genua´ ist's, der ihm anstelle der plebejisch-demokratischen Haltung eine offenbar geistesaristokratische anpreist. Aber auch der Realismus Bürgers, ja grade sein Realismus ist Schiller ein Dorn im Auge: [...]
[S. 114] Kein Zweifel, daß alle diese Darlegungen, mögen sie auch vereinzelt Zutreffendes enthalten, grade das Positivste an Bürgers lyrischer Produktion verzerren, um es herabsetzen und in Bürgers Person
den Jokobinismus treffen zu können.
[S. 116] Auch Bürger stand, wie wir gesehen haben, zu derselben Zeit, da sein Schaffen schon Strum-und-Drang-Züge aufwies, unter dem Einfluß Voltaires. Die rationale
Stoßkraft der Aufklärung und die emotionale des Sturms und Drangs verschmolzen in seiner Lyrik, besonders in seiner Epigrammatik, zu einer machtvollen Einheit. (Insofern überragen Bürgers Epigramme teilweise sogar
die Sinngedichte Friedrich Logaus, des großen Epigrammatikers der sogenannten ersten schlesischen Dichterschule, dessen von Lessing und RamIer ausgegrabene Schätze sicherlich zur Bereicherung Bürgers viel
beitrugen.) .
[S. 117] Bedenkt man, daß zu Bürgers Zeit der grobe Bauernkittel kein geringeres Klassensymbol war als etwa die Arbeiterbluse zur Zeit des jungen Gerhart Hauptmann und des jungen Arno Holz, dann
kann man ermessen, welch gewaltiger klassenkämpferischer Wert einem solchen Kontrast zwischen Bauer und Graf zukam. Aber diesen klassenkämpferischen Vorstoß biegt Bürger ins Religiöse - also auch dem Adel Genehme -
ab, indem er am Ende des Gedichts [Das Lied vom braven Mann] und zweimal schon vorher die rhetorische Frage ertönen läßt:
Wann klingst du, Lied vom braven Mann,
Wie Orgelton und Glockenklang ?
Man darf wohl sagen, daß hier der Respekt vor dem Klerus .. zwar nicht an den Haaren, aber am Glockenschwengel herbeigezerrt wird.
[S. 119] Zum
andern finden sich bei Bürger auch Versstellen, an denen der erforderliche Doppelschlag gegen Adel und Klerus (oder gegen Monarchie und Klerus) geführt ist. Das gilt vor allem für die mitreißenden Gedichte, die
Bürger nach dem Sieg der Französischen Revolution von 1789 und sogar nach dem Machtantritt der Jakobiner schrieb. ´Sogar´ -denn bekanntlich hörte die Sympathie andrer deutscher Dichter für die Französische
Revolution im Zeitpunkt der Jakobinerherrschaft jäh auf: man denke an Klopstocks und Schillers Abkehr von der jungen französischen Republik, deren Geburt sie beide (zumal Klopstock in den Gedichten ´Sie, nicht wir´,
´Die Etats Generaux´ und ´Der Fürst und sein Kebsweib´) hymnisch begrüßt hatten. Bürger blieb der französischen Republik treu. Er bewahrte ihr, länger als Klopstock, die Treue selbst während des von Österreich,
Preußen und Braunschweig unternommenen Interventionskrieges, des ´ersten Koalitionskrieges´ (1792 -1797), dessen erste beide Jahre er ja noch erlebte. Weit davon entfernt, an der Intervention teilzunehmen - etwa wie
Goethe, dem freilich die Kanonade von Valmy am 20. September 1792 die Erkenntnis verschaffte: ´Von hier und von heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus!´, - spornte Bürger die französischen Republikaner
mit dem Epigramm ´Unmut´ zum bewaffneten Widerstand an (´Mit Fäusten schlagt den Feind, und nicht mit Rednerphrasen!´) und ergriff im selben Jahr in seinem ´Straflied beim schlechten Kriegsanfange der Gallier´ gegen
´Pfaff und Edelmann´ Partei.
[S. 120] Der plebejisch-demokratiscbe Gesamtcharakter der Poesie Bürgers berechtigt vielmehr grad uns Marxisten, ebendiese Poesie zu unserm Erbgut zu zählen.
Wohlgemerkt: der Gesamtcharakter der Poesie Bürgers berechtigt uns hierzu. [...] Man pflegt es Bürger hoch anzurechnen, daß er die alte Volksballade Ossianischer Prägung zu einer Kunstballade geläutert habe; aber
dies Lob geht am Wesentlichen vorbei: an dem auch formalen Plebejertum Bürgers. Was etwa an der ´Lenore´ als kunstballadenhaft gerühmt wird, das ist in Wahrheit ausschließlich eine bei Volksballaden unübliche Akkuratesse des Reims und des Rhythmus; ihrer inhaltlichen und grad auch ihrer formalen Substanz nach ist die ´Lenore´ nicht weniger Volksballade als das viel gedämpftere ´Lied vom braven Mann´.
[S. 122] Die immer größere formale Exaktheit, zu der er als Balladiker wie als Epigrammatiker gelangte, dies einzige positive Resultat der idealistischen Rezension Schillers, entfremdete ihn nicht im
geringsten dem ureigenen Realismus. Er behielt auch formal im Kern das plebejische Element bei, das ihm jener verargte. Eben dieses Elements wegen gehört ihm unsre Liebe; [...]"
Leschnitzers G. A. B. - ein plebejischer Dichter in der ONLINE-BIBLIOTHEK
|
|
1955
|
Allmann, Rudolf. Auf den Spuren Gottfried August Bürgers. In: Heimatblätter des Kreises Sangerhausen 12. Folge. Kulturspiegel Ausgabe Monat Juni, S.19
"[S. 21] Wesentlich ist aber vor allem das Heimatliche in dem Charakter des Mannes. Ja, Gottfried August Bürger ist ein Harzer, und zwar ein Mansfelder ganz und gar. Das war etwas
unerhört Neues gegenüber der weichlichen Anakreontik. Das war mansfeldische Art, diese grobknochige Kraft, die in Bürgers Dichtungen laut wurde, der todbringend dahinlodernde Feuerbrand, die Liebe, die wahr und
innig, aber auch wild und gewaltig war. Mansfeldisch war auch, das Musikalische in seiner Sprache. Hierin und in .der volkstümlichen Bildkraft übertrifft er die Kunstsprache Lessings durchaus. Nach einer Zeit
fremdländischer Geziertheit und Verderbnis und einheimischer Armseligkeit, Geschraubtheit, trockener Pedanterie und lehrhafter Nüchternheit in der Dichtkunst gehören Bürgers Dichtungen zu den goldenen Geigentönen
einer neuen deutschen Dichtkunst. So etwas an Kraft und Innigkeit, an Leidenschaft und stärkster dichterischer Unmittelbarkeit der Anschauung war im damaligen Deutschland unerhört. Es war ein prächtiger,
heilsamer ´Sturm und Drang´, der damals durchs Land fegte. Bürger war eins der stärksten Talente seiner Zeit. Ja, es schaudert heute noch manchem braven Spießbürger, freilich nicht mehr vor seinen Dichtungen,
wohl aber vor seinem Lebenswandel. ´Sittenlos´ soll er gewesen sein. Die Unstetheit des Dichters wird ihm zum Vorwurf gemacht. Er hätte wohl hübsch brav hinterm Ofen sitzen sollen wie Vater Gleim oder Gellert. Ganz
sicher: behaglicher hätte er es gehabt! (Hätte vielleicht auch länger gelebt?)
Er wäre aber nie der Gottfried August Bürger geworden, wie ihn die literarische Welt kennt und ehrt, der
Leonorendichter! Nicht an seinem Dämon ist er gescheitert, nicht seine innere Unstetheit, sein Lebenswandel haben verschuldet, daß er seine Persönlichlkeit nicht so vollenden konnte, wie der zwei Jahre nach ihm
geborene Goethe, dessen Spuren auch durch den Harz laufen. Nein, es war noch viel zu viel Alltäglichkeit und Spießerhaftigkeit - trotz allem - in ihm selber, und darüber ist er zerbrochen."
|
|
1955
|
Mitzka, Walther (Hg.) Seidenpapier. In: Trübners Deutsches Wörterbuch, Sechster Band, Berlin W 35. Digitalisiert von Google
“[S. 311] Seidenpapier war im 18. Jh. ein besonders kostbares Schreibpapier, das wirklich aus Seidenlumpen hergestellt wurde: ´Er schrieb ihr ein Briefchen auf Seidenpapier, Umrändelt mit goldenen Kanten´. Später wurde das Wort auf ganz dünnes, seidenweiches Einwickelpapier übertragen.”
|
|
1956
|
Schöffler, Herbert. Bürgers Lenore. In: Deutscher Geist im 18. Jahrhundert.
“[S. 86] ”Aber der Schlüssel zur vollen geistesgeschichtlichen Bedeutung des Kunstwerkes liegt anderswo. Er liegt in den zwölf Eingangsstrophen, die der junge Bürger zu dem, was er
gehört hat, hinzudichtet. Denn was immer wir als seine Hauptquelle ansehen, ob mit den Deutschen die rührenden Kadenzen eines aufgefangenen Spinnstubenliedes, ob mit den Engländern die Percy-Ballade Sweet William's
Ghost - in keiner dieser Quellen findet sich eine Andeutung dessen, was diesen entscheidend bedeutsamen Teil des Bürgerschen Kunstwerkes ahnen ließe.”
Der vollständige Beitrag in der ONLINE-BIBLIOTHEK
|
|
1956
|
Lukács, Georg. Zur Ästhetik Schillers. In: Beiträge zur Geschichte der Ästhetik.
“[S. 14] Diese .´Tragik´ der Französischen Revolution ist aber in Schillers Augen nur die Erscheinung der unlösbaren Antinomie der bürgerlichen Revolution überhaupt. Der
Feudalabsolutismus, der Naturstaat, ist nach Schillers Auffassung nicht nur im gegenwärtigen Augenblick morsch geworden und dem Untergang geweiht, sondern ist von Anfang an den Gesetzen der Moral widersprechend, da
er ´seine Einrichtung ursprünglich von Kräften, nicht von Gesetzen ableitet´. Es ist dabei interessant, mit welcher naiven Selbstverständlichkeit Schiller die Moral schlechthin mit der bürgerlichen Moral
identifiziert und in der alten Gesellschaft eben nur eine rohe Kraft als begründendes und zusammenhaltendes Element erblickt. Diese Konzeption bringt er aus seiner revolutionären Jugendperiode mit, damals aber zog
er aus diesem Bild, das er sich von der alten Gesellschaft gemacht hatte, die radikalste, wenn auch noch so unklare revolutionäre Konsequenz: ´Quae medicamenta nun sanat,ferrum sanat, quae ferrum non sanat, ignis sanat´ (Was die Medizin nicht heilt, heilt das Eisen, was das Eisen nicht heilt, heilt das Feuer), heißt das Motto zur Vorrede der ´Räuber´.
Jetzt zieht er - auf der Grundlage der Kantschen Philosophie - aus derselben Feststellung die Konsequenz, daß hier eine unlösbare Antinomie vorliegt. Diese Antinomie entstammt daraus, daß nach
der grundlegenden Konzeption der Kantschen Philosophie, das wahre Wesen des Menschen, das Ich der praktischen Vernunft, nichts Wirkliches sondern ein Postulat, kein Sein, sondern ein Sollen ist. Die Antinomie, die
hieraus für jede Revolution entsteht, formuliert Schiller folgendermaßen: ´Nun ist aber der physische Mensch wirklich, und der sittliche nur problematisch. Hebt also die Vernunft den Naturstaat auf,
wie sie notwendig muß, wenn sie den ihrigen an die Stelle setzen will, so wagt sie den physischen und wirklichen Menschen an den problematischen sittlichen, so wagt sie die Existenz der Gesellschaft an ein bloß
mögliches (wenngleich moralisch notwendiges) Ideal der Gesellschaft ... Das große Bedenken also ist, daß die physische Gesellschaft in der Zeit keinen Augenblick aufhören darf, indem die moralische in der Idee sich bildet, daß um der Würde des Menschen willen seine Existenz nicht in Gefahr geraten darf.´ Wir finden hier in zugespitzter geschichtsphilosophischer Formulierung die letzten Konsequenzen jener Selbstkritik, die Schiller an den Helden seiner stoisch-revolutionären Jugendperiode geübt hat. Denn was er seinerzeit seinem Karl Moor und Marquis Posa vorwarf, war ja gerade, daß sie über dem Vorsatz der unmittelbaren Verwirklichung der Idee das Seiende am Menschen, die Gesetze der lebenden Menschlichkeit, vernachlässigt und außer acht gelassen haben.
Wenn aber dieses Dilemma so scharf gestellt wird, daß einerseits die Aufhebung des ´Naturstaats´ moralisch notwendig, andererseits seine tatsächliche Aufhebung moralisch unmöglich ist -
wo ist dann der Ausweg für Schiller? Die Grundlinie der Lösung stand für Schiller schon lange Zeit fest: Erziehung der Menschen zu einer sittlichen Höhe, die einen solchen Übergang gefahrlos möglich macht. Er hält sogar zeitweilig den Gedanken der Erziehung selbst mitten in der Revolution nicht für vollständig hoffnungslos. [...] Das Erziehungswerk muß also sowohl vor der Revolution, vor der Umwälzung der Gesellschaft den Forderungen der Vernunft gemäß geleistet werden wie unabhängig von dem bestehenden Staat und den realen gesellschaftlichen Mächten. Der Weg, die Forderungen der Vernunft, den sozialen Inhalt der bürgerlichen Revolution ohne Revolution zu verwirklichen, die Revolution also überflüssig zu machen, ist nach Schiller die ästhetische Erziehung der Menschheit, die Verwandlung der unwirklichen, sollensmäßigen Postulate der Moral in eine Realität, in eine Tagespraxis und Tagespsychologie der Menschen.
Diese Wendung zur Ästhetik als Zentralfrage der Philosophie, insbesondere der Gesellschafts- und Geschichtsphilosophie ist eine außerordentlich widerspruchsvolle. Sie ist, wie wir gesehen
haben, in erster Reihe eine Abwendung von der Revolution, ein praktisches Sichabfinden mit dem gegenwärtigen - scharf verurteilten - politschen und gesellschaftlichen Zustand; sie ist, wie Engels scharf und treffend
sagt, Flucht aus der platten :Misere in die überschwengliche Misere. Indem Schiller sich auf den Boden der Kantschen Philosophie stellt, verfällt er vollständig den apologetischen Tendenzen, die Marx an der höchsten
Philosophie dieser Periode, der Hegelschen, so scharf kritisiert hat. Es entsteht auch bei ihm jener ´unkritische Positivismus´, den Marx bei Hegel dahingehend kritisiert, daß ´von einer Akkommodation Hegels gegen
Religion, Staat etc. also keine Rede mehr sein kann, da diese Lüge die Lüge seines Progresses ist´.
|
|
1956
|
Markwardt, Bruno. Die Programmatik und Ästhetik des Sturmes und Dranges. In: Geschichte der deutschen Poetik II. Berlin
“[S. 442] Seine literatursatirische Versfabel ´Der Vogel Urselbst´(1793), für deren Form Bürger selbst auf Burkhard Waldis`´Manier´ zurückverweist, bei deren grotesker
Personifikation von Abstrakten (der Vogel Urselbst gleich Originalgenie; der Vogel ´Der Ideal´) man aber fast auf Christian Morgenstern vorausschauen möchte, bezeugt jedoch - von Epigrammen abgesehen -, daß Bürger
sehr wohl über das Grundsätzliche der Auseinandersetzung jenseits des Persönlichen sich klar und nicht willens war, sein volksnahes Ideal für ein volksfernes klassizistisches Ideal (der Uhu, der ´aus Trojas Schutt
und Graus´ heraus dem deutschen Original falsche Wege der Vervollkommnung weist) aufzugeben. Das Originalgenie, der Vogel ´Urselbst´ soll nicht durch fremde Federn seinen Flug ´vervollkommnen´ wollen. Weder der
antike Uhu, noch ´der Ideal´, jener Wundervogel, der im ´dritten Himmelssaal´ neben dem ´Wunderphönix der Moral´ (Einigung des Ästhetischen und Ethischen; Schiller) fliegt und sich bei näherem Zusehen als Popanz
´von metaphysischer Natur, der durch das Transcendentalreich streift´ (Schillers Annäherung an Kant), erweist, und auch nicht der ´graziöse´und ´niedliche´, im Goldkäfig hockende Rokoko-Papagei, der sich die
´deutschen Federn´ ausgerupft hat (etwa: Wieland), vermögen dem Originaldichter Urselbst ´den Flug, der sonst sein Volksruhm war´, zu ersetzen. Der Genius ermahnt den Verleiteten, keine Wege zu suchen, ´wo dich dein
Volk nicht sieht und hört´. Kurz, die Grundposition der Popularität, der Volkstümlichkeit, die durch den Rezensenten erschüttert scheint, wird als die einzige Halt und Wert sichernde Grundlage erneut behauptet und
befestigt. “
|
|
1957
|
Hochuli, André. Der junge Schiller als Kritiker. Dissertation Universität Basel.
“[S. 10] So kann man behaupten, dass alle rezensorischen Werke Schillers Bruchstücke einer Selbstkritik seien. Es wird sich erweisen, dass gerade bei ihm jegliche Kritik aus dem Kreis
des Selbst stammt und niemals intuitiv das Fremde erfühlen kann. Mit geschlossenem Visier, in der Rüstung der eigenen Ideen, kämpft er gegen die ihn umgebende Welt.
[S. 11] Die Bürgerrezension, die in ihrer
Schärfe nur mit den frühen Stäudlinrezensionen verglichen werden kann, nimmt jedoch eine besondere Stellung ein. In der Auseinandersetzung mit Stäudlin ist der polemische Zug ohne weiteres verständlich, da dieser
Schillers direkter Konkurrent ist, den es aus dem Feld zu schlagen gilt. Bürger hingegen ist nicht Schillers Konkurrent, sondern eine gestrige Grösse. Die Härte der Rezension ist die äussere Form für die
Gewaltsamkeit der innern Entscheidung. Sie ist ein Sprung zu andern Ufern, wobei der frühere Weggefährte durch die Gewalt des Absprungs in den Abgrund gestossen wird. So erscheinen uns die frühen Rezensionen
Schillers unter dem Aspekt des Ringens, die Bürgerrezension hingegen unter dem der Entscheidung, mit der allerdings die Entwicklung nicht vollendet ist. Die Entscheidung wird willentlich und gewaltsam vorgenommen.
[S. 64] In der Bürgerrezension aber sagt er anlässlich des Gedichts «Die beiden Liebenden» : «Wir wollen nicht untersuchen, wie viel oder wenig Kunst erfordert wird, in dieser Manier zu erfinden; aber wir
entdecken bei dieser Gelegenheit an uns selbst, wie wenig dergleichen Matadorstücke der Jugend die Prüfung eines männlichen Geschmacks aushalten.» Diese Äusserung ist doppelsinnig; sie besagt nicht nur, dass
Schiller solche Produkte nicht mehr geniessen kann, sondern auch, dass er seine eigenen Jugendgedichte zum Teil für «dergleichen Matadorstücke» hält. Sie zeigt auch, dass er um diese Verwandtschaft weiss. Die
verdeckte Formulierung in diesen beiden Rezensionen wirft ein Licht auf die eigenartige Vertuschung der Tatsachen, die er in seinen Besprechungen oft vornimmt. In Schillers früher Lyrik nehmen balladeske Gedichte
wie «Bacchus im Triller», «Der hypochondrische PIuto», «Die Journalisten und Minos », die die mythologischen Gestalten ins Triviale herunterziehen, einen verhältnismässig breiten Raum ein. In ihnen wird bewusst
volksmässiger Charakter angestrebt. Bürger hatte in seiner «Prinzessin Europa» das Beispiel für eine solche Behandlung gegeben.
[S. 66] Die Rezension ist nicht nur das Manifest einer neuen Dichtung, sondern setzt ein neues Menschentum voraus. Dieser neue
Mensch, für den Mass und Haltung verpflichtend sind, steht in schroffem Gegensatz zu
Bürger, der durch seine Leidenschaft wie durch einen reissenden Strom an den Strand der Verzweiflung getrieben wird. Er kann die notwendige «Freiheit des Geistes» nicht bewahren, seine Dichtung wird zum
unmittelbaren Schrei des Affekts.
[S. 68] Man kann das Urteil eine Verurteilung nennen, denn Schillers Kritik trifft weitgehend den Menschen im Dichter. Am Schluss des ersten Teiles gibt er den kritischen
Masstab, an dem Bürger gemessen werden soll: «Kein noch so grosses Talent kann dem einzelnen Kunstwerk verleihen, was dem Schöpfer desselben gebricht, und Mängel, die aus dieser Quelle entspringen, kann selbst die
Feile nicht wegnehmen.» Anderseits macht er keinen Hehl daraus, wie sehr er die formale Begabung Bürgers schätzt. Bei seiner Beurteilung greift er hinter das Gedicht auf dessen Schöpfer zurück und stellt Forderungen
auf, die den Dichter selbst angehen. Ein bestimmtes Bild von der Beschaffenheit des Dichters wird mit dem Charakter Bürgers konfrontiert. Er nimmt keine Rücksicht auf den Bekannten und schreibt die Rezension in Form
einer unmissverständlichen Absage und Kampfschrift, die durch das am Schluss eingefügte Lob kaum gemildert wird. Im Kampf zwischen Sturm und Drang und Klassik, der in ihm selbst ausgefochten wird, ist Bürger das
Opfer. In ihm hat er sein eigenes Vorleben abgetötet und es den neuen Göttern als Opfer dargebracht. Der neuen Götter grösster ist Goethe.
[S. 70] Tatsächlich ist nicht nur der Aufbau der Bürgerrezension in
dieser Hinsicht auffallend, sondern auch der der Matthissonkritik. Nicht zufällig sind diese beiden auch seine sensationellsten Fehlurteile.
Schiller ist von einer Idee besessen, welche von ihm
konsequent durchgedacht wird. Seine rezensorische Tätigkeit besteht darin, dass er die Probe aufs Exempel macht. Er hält dem zu rezensierenden Werk Kunstgesetze entgegen, die er als objektiv ansieht, will aber nicht
merken, dass sie seine persönliche Meinung sind. So bewegt er sich ständig in einem circulus vitiosus. Seine Kritik ist programmatisch und normativ, mit allen Vor- und Nachteilen, die diese Art von Kritik in sich
schliesst. Die Bürgerrezension erweist dies besonders deutlich. Das lebendige Gefühl für die Gedichte wird kaum zu Rat gezogen. Schiller ist von seiner Anschauung erfüllt, und dieser Besessenheit ist z.T. die
Schärfe der Rezension zuzuschreiben. Der Fluss der auf rationalem Weg fortschreitenden Beurteilung lässt sich durch keine andern Rücksichten hemmen.
[S. 73] Der Volksdichter, der nach Schiller bildend auf das
Volk wirken soll, soll sittlich und geistig auf einer Stufe mit den Besten seines Jahrhunderts stehen. Seine Forderung nach allseitiger Bildung des Dichters ist nicht nur eine Forderung an Bürger, sondern auch an
sich selbst. Immer wieder stösst man im Briefwechsel auf Klagen über seine mangelnde Bildung und seine Unwissenheit. Darin sieht er einen der wichtigsten Faktoren, die ihn von Goethe unterscheiden. Die Forderung
nach sittlicher Bildung des Dichters entspricht dem tiefsten Bedürfnis seines Wesens. Er hat «den Riesenkampf der Pflicht» bestanden und kann an seinem eigenen Werk erkennen, wie eng verbunden seine menschliche und
seine dichterische Entwicklung sind. Aus dieser Erkenntnis folgert er: «Alles was uns der Dichter geben kann, ist seine Individualität.» Er führt Bürgers Konzeption des Volksdichters mit einer niederschmetternden
Kritik am Werk und einer kleinen Umdeutung des Begriffes ad absurdum und hält ihm eine Theorie der Volksdichtung entgegen, die seinen eigenen Gedichten entspricht. Damit erhebt er Anspruch auf das Erbe Bürgers als
Volksdichter.
[S. 74] Weder in der Rezension noch in der Verteidigung des Rezensenten wird genau gesagt, wie idealisiert werden müsse, weshalb es durchaus nicht schlechter Wille ist, wenn Bürger diese
Forderung als «mirabili dictu» verspottet. Durch die Oekonomie der Mittel und die Feinheit der Mischung in der Schilderung soll die Schönheit der Form und die Ebenmässigkeit angestrebt und der Gegenstand selbst von
allen individuellen und fremden Beimischungen befreit und in seiner Wesentlichkeit und Allgemeinheit dargestellt werden. Dies sind die einzigen konkreten Angaben, die Schiller in der Rezension gibt. Bürger behauptet
mit einigem Recht, solche gereinigte Empfindungen seien Abstraktionen. Das Missverständnis liegt in Schillers zu wenig geklärten Begriffen. Die Forderung nach Idealisierung wird erst ganz verständlich durch den
«Kontext» seiner ganzen Ideenwelt und derjenigen des goetheschen ·Weimar. Goethe sagte einmal, Schönheit sei ein Gesetz, das in die Erscheinung trete; nach Schiller soll das Gesetz eine Verkörperung finden. Deshalb
fordert er mit grösstem Nachdruck: «Wenn es auch noch so sehr in seinem Busen stürmt, so müsse Sonnenklarheit seine Stirne umfliessen.» Bürger, der dem beginnenden Klassizismus Schillers gegenüber das soeben
Überwundene verkörpert, kann diese Argumentation nicht verstehen, wie auch Schiller Bürgers Werk und Welt nicht mehr verstehen will. Wegen dieses Missverständnisses musste die Kritik unfruchtbar bleiben.
In der Rezension, diesem Dokument des Ringens um die Entscheidung, untersucht Schiller gar nicht, ob Bürger vielleicht einen andern Dichtertypus verkörpere. Er beurteilt ihn auf Grund der eigenen -
sentimentalischen - Ansicht über die Lyrik und erklärt das eigene Gesetz auch für ihn als verbindlich.”
|
|
1959
|
Buchwald, Reinhard. Schiller. Leben und Werk.
“[S. 520] Was in der Besprechung von Goethes 'Iphigenie´ ungesagt geblieben oder nur angedeutet worden war, das führte Schiller zwei Jahre darauf aus, als er Bürgers Gedichte in der
,Allgemeinen Literaturzeitung´ besprach. (Die Aufforderung dazu gelangte Ende Mai 1790 an ihn. Mitte Dezember war die Rezension vollendet; sie erschien am 15. und 17. Januar 1791; dazwischen fiel Schillers schwere
Erkrankung.) Was Schiller jetzt aussprach und wie er es formulierte, ist nur daraus zu verstehen und - wenn man die harte Erwidenmg Bürgers betrachtet - zu entschuldigen, daß zwei Jahre ernster Selbsterziehung in
jener antikischen und Goetheschen Richtung hinter ihm lagen und daß er sich ihrer Auswirkung bewußt war. Noch mehr als am Ende des Ringens mit der ´Carlos´-Dichtung fühlte er sich als ein verwandelter Mensch. Das
Menschliche steht dabei weit im Vordergrund, das Dichterische ist als eine Folgerung daraus begriffen. ´Es ist nur der reife, vollkommene Geist, von dem das Reife, das Vollkommene ausfließt.´ Das alles empfand er
als einen bleibenden Gewinn, und auch später hat er es rückblickend so angesehen. Hatte erst die Geschichte den Bereich seiner Erfahrungen mächtig erweitert, so hatte ihm nun der Umgang mit den Griechen das
verliehen, was er kurzweg ´Klassizität´ nannte. Die ´Manier´ seiner Jugend war, wie er fühlte, überwunden, er durfte sich zutrauen, daß seiner künftigen Dichtung ´Stil´ eignen werde. Mit Zustimmung hatte er die
Ausführungen gelesen, die Goethe nach seiner Rückkehr aus Italien über diese Grundbegriffe in Wielands ´Merkur´ veröffentlicht hatte. Was an ihm krank gewesen war - wie er denn alles Modeme als gebrochen und krank
ansah -, das durfte er als geheilt ansehen: waren doch die antiken Werke die ewigen Vermittler solcher Heilung.”
|
|
1959
|
Kaufmann, Hans. Politisches Gedicht und klassische Dichtung. Heinrich Heine.
“[S. 106] Neben anderen verwandten Formen spielt die Vagantenstrophe im 18. Jahrhundert bei den Bemühungen der Lyriker um Volkstümlichkeit eine große Rolle, und zwar entweder wie im
Kirchenlied als erster Teil einer sieben- oder mehrzeiligen Strophe (Goethe: ´Der Totentanz´; Bürger: ´Lenore´) oder auch, etwas seltener, als einfacher Vierzeiler (Goethe: ´Die wandelnde Glocke´; Bürger: ´Frau
Schnips´). Diese volkstümlichen Formen Goethes und Bürgers haben im 19. Jahrhundert am meisten Schule gemacht. Die Romantik geht jedoch in der Aneignung der Volksliedform einen Schritt weiter. Während im 18.
Jahrhundert die regelmäßige Taktfüllung noch vorherrscht (´Lenore´ u. a. rein jambisch, ´Der Totentanz´ fast ausschließlich anapästisch), finden wir jetzt häufiger den im Volkslied üblichen Wechsel von ein- und
zweisilbigen Senkungen:
´... Wohl über eine breite Haide´ (´Der Herr von Falkenstein´)
´... Da reist' ich nach Deutschland hinüber´ (´Wintermärchen´)”
|
|
1959
|
Müller, Joachim. Zu Schillers Kunsttheorie. In: Das Edle in der Freiheit. Leipzig.
“[S. 178] Das Bild des Dichters als eines männlichen Geistes, eines verantwortungsbewußten Volkserziehers festigt sich in Schiller immer mehr und profiliert sich am stärksten 1791 in
der programmatischen Einleitung zur Rezension von Bürgers Gedichten, denen er freilich schweres Unrecht tat. Doch in unserem Zusammenhang interessiert nur das Grundsätzliche, nicht die falsche Anwendung auf Bürger. “
|
|
1961
|
Pongs, Hermann. Bürger. In: Das kleine Lexikon der Weltliteratur. Stuttgart.
“[Sp. 280] Bürger, Gottfried August (1747 bis 1794): Hauptgestalt des deutschen Sturm und Drangs im 18. Jh., das verwilderte Genie, unsterblich durch seine Lenorenballade.
Pfarrerssohn aus dem Unterharz (Molmerswende), wechselte bald von der Theologie zum Rechtsstudium, wurde 1772 Amtmann in Altengleichen bei Göttingen. Das ist seine beste Zeit: Freundschaft mit den
Hainbund-Dichtern, die er alle überragt (Hölty, Voß, Miller, Cramer): am Zügel gehalten durch den älteren Boie, Herausgeber des ´Göttinger Musenalmanachs´. Damals entsteht im Wettbewerb mit Höltys Schauerballade
(´Die Nonne´) Bürgers ´L enore´ (April 1773). Großform der Gespensterball., unmittelbar aus den Niederungen des Bänkelsangs herausgehoben. Volks· und Kunslballade in eins.
Diese Sprachgewalt hat
Bürger nicht mehr erreicht; es war ihm nicht vergönnt, zu einer Klassik zu reifen. Vielmehr verfiel er einer unseligen Doppelliebe zu zwei Schwestern, einem Gefühlschaos, das er nicht mehr bewältigte. Der alternde
Witwer geriet 1790 in eine Leidenschaft, die ihn dem Spott preisgab. Schillers scharfe Rezension 1791 gab ihm den Rest, mit dem Vorwurf: daß er sich mit dem Volk gemein mache. statt ´Wortführer der Volksgefühle zu
sein´.
Wieviel ist bei Ihm großentworfen und Fragm. geblieben: eine Jamben·Ilias, von Goethe unterstützt; eine Hexameter-Ilias. Übers.: Ossian, Macbeth, Dido·Äneis. Populär machte ihn noch die Übers.
der Abenteuer M ünchhausens, aus demEnglischen von Raspe, erst durch ihn zum deutschen Volksbuch geworden. 1786.
Im Lenorenstil dichtet er noch: ´Der wilde Jäger´, mit grelleren Schauern; eine
Rührballade: ´Des Pfarrers Tochter von Taubenhain´; Biedermannsballae: ´Das Lied vom braven Mann´. Eine gerechtere Würdigung fand er durch A. W. Schlegel 1800.
[Sp. 999] Lenore: Meisterballade Bürgers, 1773, die die Erneuerung der dt. Kunstballade einleitet.
Im Wettstreit mit Hölty, unter der Begeisterung des ´Göttinger Hains´, ist April-Sept. 1733 die ´L.´
entstanden; Bürger, 25 Jahre alt, Amtmann in Gelliehausen, auf der Höhe seiner Kraft. Percys Ball. (´Wilhelms Geist´) und selbsterlauschte Töne eines ´alten Spinnstubenlieds´ im Ohr. Eben 1772 hatte er gedichtet:
´Daß meine Phantasei, voll Kraft,
vernichtet Weilten, Welten schafft,
und höllenab und himmelan
sich senken und erheben kann.´
So wird
Lenore zwischen Himmel und Hölle gestellt. Der Eingang malt Soldatenheimkehr nach dem Siebenjährigen Krieg; alle kehren zurück, Lenorens Bräutigam nicht. ´Als nun das Heer vorüber war, zerraufte sie ihr Rabenhaar´;
am Trost der frommen Mutter steigert sich die Verzweiflung zur Hybris, zum Rasen gegen Gott. ´O Mutter, was ist Seligkeit? O Mutter, was ist Hölle?´ Sie selber zieht ihn heran, den Tod: ´Stirb hin, stirb hin, in
Nacht und Graus!´ Schon trappt er heran, der Gespenstertote, der Reiter auf dem Gespensterroß, der die Braut mitnimmt im Gespensterritt durch die Nacht, am Hochgericht vorbei, zum Hochzeitsbett im Grabe. Einmalig in
der Weltliteratur, wie dieser Totenritt versinnlicht ist im rasenden Vorbei vom ersten Gespensterhauch: ´Und horch und horch den Pfortenring - ganz lose leise klinglingling´- bis zum Galopptempo: ´und hurre hurre
hopp hopp hopp´, und zur letzten Verwandlung: ´Zum Schädel ohne Zopf und Schopf, zum nackten Schädel ward sein Kopf...´
32 Strophen, achtzeilig, Strophenvollton wie im Kirchenlied (´Ermuntre dich,
mein schwacher Geist´), Gemeinschaftsgesang. Dem volksfestlichen Eingang folgt die Zwiesprache Mutter und Tochter, Seelenvertraute in Rede und Gegenrede; und die Zwiesprache Braut und Bräutigam. Zwei Teile, die das
Ganze gliedern; Gottesordnung der Mutterwelt und das Heillos-Ungreifbare der Geisterwelt. Bis in die Lautkraft der Volkale spiegeln sich die Gegenwelten: ´das hochgelobte Sakrament wird deinen Jammer lindern´.
Welche stille Gegenwart des Göttlichen! Um den Reiter ist nichts als Sausen, Fliegen, Donnern, Rasen, ´Komm, Küster, hier! Komm mit dem Chor und gurgle mir das Brautlied vor!´
Vier Schlußstrophen
antworten dem Eingangsfest. Was kann den Gespensterritt noch überbieten? Gräber, Verwandlung, Totengerippe, Höllenschlund, die Mächte der Unterwelt. Die Ballade zieht sich zusammen zum gruseligen Knalleffekt und
endet in der Predigermoral: ´Mit Gott im Himmel hadre nicht!´ Der Gespensterschauer, durch 15 Strophen gesteigert, mit aller Imagination des Sinnlich-Übersinnlichen, erfährt den Umschlag in eine übergreifende
Ordnung, in der sich der Gespensterschreck als Gottesgericht enthüllt. Die Kunstball. kehrt zum simplen Volkston zurück. “
|
|
1962
|
Buchwald, Reinhard. Das Vermächtnis der deutschen Klassiker.
“[S. 199] Was damals blitzartig in Schillers Geist aufleuchtete, hat er klar und ausführlich wiederholt, als er am Ziel dieser Selbsterziehung zu sein glaubte. Es war um die Jahreswende
von 1790 auf 1791, als Schiller zuerst den Plan seiner Wallenstein=Dichtung faßte. Kurz vorher hatte er für die >Allgemeine Literatur=Zeitung<, das literarische Organ der damaligen geistigen Vorherrschaft
Jenas, eine Kritik von Bürgers Gedichten geschrieben. Sie ist scharf und vielleicht ungerecht und nur zu verstehen und zu rechtfertigen, wenn man bedenkt, daß Schiller dadurch zugleich mit seiner eigenen
Vergangenheit abrechnete. Denn gerade über diese seine Anfänge glaubte er sich jetzt erhoben zu haben. Er hatte erkannt, was die Aufgabe der Dichtung in einer Epoche der größten Umwälzungen (ein Jahr nach der
Revolution von 1789) sein müsse, und zugleich war er sich bewußt, daß er selbst ein anderer, reiferer Mensch geworden war, der diese Aufgabe -eine aufbauende Dichtung in einer Zeit der Auflösung und des Verfalls -
werde meistern können. Ja noch mehr: er glaubte das Höchste auf sich nehmen zu können, was es für ihn in der Geistesgeschichte der Völker gab: die Erschaffung einer Volksdichtung - jenes Ziel, an dessen
Erreichbarkeit zwei Jahrzehnte zuvor Lessing in den berühmten Schlußsätzen der >Hamburgischen Dramaturgie< gezweifeIt hatte. [...]
Von hier aus bahnt sich dann Schiller in dieser Abhandlung
den Weg zu einem Programm der Volksdichtung. Bisher hatte er von den Gebildeten gesprochen - und das Wort Bildung bedeutete im Zeitalter Herders und Goethes nicht das zweifelhafte Ergebnis einer sogenannten höheren
Schulbildung, sondern den Anteil an einer geistigen Bewegung, der es um ein neues Menschenideal ging, um eine Humanität, die man vor allem an den Denkmalen der Antike erlernen wollte. Damit war zweifellos eine Elite
gemeint; aber Schiller machte in diesen Schranken nicht halt, er drängte weiter, er wollte von allen werden. Wie ließ sich für sein Volk eine aufbauende und erneuernde Dichtung schaffen? Schiller antwortet:
Keinesfalls einfach durch eine romantische Anknüpfung an altes Volksgut (soweit es vor Arnim und Brentano zugänglich war), und erst recht nicht durch Anpassung an den ´Volkston´ - so hatte es Bürger versucht -,
vielmehr nur, indem man die strengste und ernsteste Arbeit so vertiefte, daß sie endlich ganz einfach, großlinig, erlebnisnah wurde. Volksdichtung dieser Art lag also für Schiller nicht in der Vergangenheit, sondern
war eine Aufgabe rur die Zukunft; und zugleich, so sonderbar das klingt, sieht er das Ideal dafür nicht im germanischen, sondern im griechischen Bereich.
Den Komplex dieser Gedanken hat Schiller immer
festgehalten, und er selbst hat betont, daß es weiterhin nur galt, bessere Begründungen dafür zu suchen. Das hat er in den darauffolgenden Jahren, in der Zeit seiner Kantstudien, getan. Immer aber bleibt es seine
wesentlichste Forderung, daß der Dichter die notwendige geistige und seelische Gesundung zuerst an sich selbst vollziehen müsse, und immer in ernster geistiger Arbeit, und daß nur so, auf einem langen mühsamen Wege,
die Erschaffung einer Dichtung gelingen werde, die allen zum Herzen sprechen könne, weil sie tief und doch klar und nicht flach und bequem sein sollte. Es war der Entvvurf für eine Lebensarbeit, die zuletzt mit dem
´Tell´, den er selbst als ein Volksschauspiel ansah, an ihr Ziel gelangt ist.”
|
|
1962
|
Mayer, Hans. Einleitung. In: Meisterwerke deutscher Literaturkritik.
“[S. 31] Bis zu Lessing galten die Gesetze der Antike; nunmehr wird die konkrete Gesetzlichkeit im Volke gesucht und damit in der Gegenwart. Der schöpferische Künstler soll danach
streben, in seinem Schaffen dem Volke zu dienen, er soll sich um Volkstümlichkeit bemühen, während der Kunst- und Literaturkritiker zu prüfen hat, ob dieses Bemühen ernsthaft war - und ob es im einzelnen Falle
Erfolg hatte.
Bürger als Kritiker ist keineswegs ein Außenseiter. (Das ist wohl eher Lenz.) Auch Heinrich Leopold Wagner meint in der Vorrede zur Neuausgabe seiner Kindermörderin (1779), die Aufgabe des Dramatikers müsse unmittelbar darauf gerichtet sein, die menschlichen Verhältnisse zu bessern und zu verändern. [...] Die Annäherung dieser Gedankengänge Bürgers oder Wagners an die kritischen Grundprinzipien des jungen Schiller ist leicht zu vollziehen. Die Vorrede zu den Räubern hat kein anderes Grundthema als die Mannheimer Rede über die Schaubühne
als moralische Anstalt.
Hier aber liegt zugleich der Angelpunkt für die etwa um 1789 anbebende Auseinandersetzung zwischen den ästhetischen Grundanschauungen der Stürmer und Dränger und dem,
was wir heute als Ästhetik der Weimarer Klassik zu bezeichnen gewohnt sind. Goethes Aufsatz über Einfache Nachahmung der Natur, .Manier, Stil (1789) bedeutet, ebenso wie Schillers Kritik an Bürgers Gedichten (1791), nicht bloß einen Wendepunkt in der Auffassung von der Literatur und ihrer Funktion, sondern nicht minder in der Auffassung vom Aufgabenbereich der Literaturkritik.
Die Literaturkritik der Weimarer Klassik ist gesetzgeberischer Art. Der große Kritiker, wie ihn Goethe und Schiller am eigenen Maßstab zu messen pflegten, soll selbst die Normen finden und erläutern. Der
Kritiker soll die ästhetischen Gesetzestafeln aufstellen. Hier hat sich etwas Neues vollzogen: der Kritiker gehört nicht mehr zur richterlichen Gewalt, sondern zur Legislative. Wobei erkennbar wird, daß die
bisherigen Gesetze im Bereich der Kunst und Literatur in den Augen unserer Klassiker ihre Geltung verloren haben: [...]. Wenn Schiller gegen Bürger postuliert: »Eine der ersten Erfordernisse des Dichters ist
Idealisierung, Veredlung, ohne welche er aufhört, seinen Namen zu verdienen«, so ist damit ein ganz neuer Bereich gemeint. Nicht mehr der gesellschaftlich-moralische Bereich, worin Begriffe wie »Volkstümlichkeit«
und »erzieherische Wirkung« beim kritischen Urteil ausschlaggebend sein durften. Jetzt geht es um die Trennung von Kunst und Leben, von Ideal und Wirklichkeit. Die Ästhetik löst sich von der Ethik, der Pädagogik, im
weitesten Sinne vom konkreten gesellschaftlichen Prozeß. Auch die philosophische Grundlage jedenfalls des Schillersehen Klassizismus macht das erforderlich.”
|
|
1962
|
Christaller, Helene. Die junge Pfarrfrau, Basel. (Sammlung Klaus Damert)
"[S. 27] Und nun begann sie fast gierig auch die Waschtischschubladen und die Kommode aufzuziehen.
Sie lachte. Da lagen als Aufforderung zur Reinlichkeit Worte aus einem Haydn-Oratorium, das sie zusammen mit der Mutter gehört:
´Außen blank und innen rein
soll des Mädchens Busen sein..´"
|
|
1963
|
Reimann, Paul. Gottfried August Bürger. In: Hauptströmungen der deutschen Literatur 1750-1848.
S:249-260.
“[S. 249] Bürgers Leben war eine Illustration der Feststellung Knebels, daß ´die Mittel, seinen Unterhalt auf rechtliche Weise zu erhalten, für Leute von einem gewissen Stande, die
nicht von den gemeinen Volksklassen sind, so schwer sind, so daß man sicher zählen darf, daß wenigstens zwei Drittel von ihnen von der bloßen Gnade der Fürsten leben´. Bürger gehörte zu jenem Drittel der deutschen
Intelligenz, dem nicht das zweifelhafte Glück blühte, die Aufmerksamkeit eines der dreihundert deutschen Potentaten auf sich zu ziehen. Die Folge war ein ständiges Hungerdasein, das die Kräfte des Dichters derart
erschöpfte, daß er bereits im Alter von 47 Jahren starb.[...] Über dieses Doppelverhältnis Bürgers zu beiden Schwestern wurde nicht wenig Papier verschmiert. Kam es doch darauf an, einen der männlichsten
demokratischen Dichter durch Anschuldigung ´moralischer Haltlosigkeit´ zu diskreditieren. Die biographischen Dokumente über Bürgers Leben, beweisen freilich etwas anderes: daß alle drei beteiligten Personen unter
der Ungeklärtheit der persönlichen Beziehnngen litten und daß Bürger selbst die Widersprüche in seinem persönIichen Leben schwer ertrug. Goethe hat über Bürgers unglückliche Lebensumstände ganz anders geurteilt als
die Klopffechter der deutschen Reaktion.
[S. 250] Im Jahre 1784 holte Bürgers Gegner, Generalmajor Uslar, zum Schlag gegen Bürger aus, indem er ihn der hannoverschen Regierung wegen angeblich schlechter
Amtsführung denunzierte. Die Legende von Bürgers ´schlechter Amtsführung´ haben auch einzelne Biographen Bürgers übernommen, die ihn ´wohlwollend´ beurteilen. Die Frage, ob Bürger sein Amt gut oder schlecht
verwaltet hat, ist dabei völlig belanglos. Das Wesen der Frage besteht darin, daß das Amt selbst schlecht war und daß einer der besten deutschen Dichter des 18. Jahrhunderts, den Goethe als einen ´außerordentlichen
Menschen´ bezeichnete, keine andere Stelle finden konnte als eine armselige Amtmannstelle in einem abgeschiedenen Dorf. Glücklicherweise hat sich durch den Abdruck in Wekhrlins ´Grauem Ungeheur´ die Eingabe Bürgers
an die Regierung von Hannover erhalten, in der er zu dem Vorwurf der schlechten Amtsführung Stellung nimmt. Dieses wichtige. Dokument, das Bürgers Charakter in ein richtiges Licht stellt, wurde von der bürgerlichen
Literaturforschung nicht zur Kenntnis genommen.
[S. 251] Die über Bürger verbreitete Legende erklärt seine Armut daraus, daß der Dichter angeblich nicht hauszuhalten verstand. Aus seiner Eingabe geht
allerdings etwas anderes hervor: ´Es sind mir zum fixen Salario nicht mehr a!s jährlich 150 Rthlr .ausgesetzt, wozu noch 30 Rthlr Mietgeld für die Wohnung und 2 Rthlr für Schreibmaterialien zugelegt sind. Außerdem
habe ich platterdings nichts als die Gerichtssporteln. Diese sind nach dem alten Herkommen und der mir vorgeschriebenen Taxe äußerst gering. Nun sind die Untertanen dieses Gerichts größtenteils arme, dürftige Leute
und jedermann, der mich kennt, wird mir das Zeugnis geben müssen, daß mir das Talent zu nehmen, wo es nur irgends zu kriegen steht, nicht gegeben ist... Wie vieles bleibt nicht mir, der ich um ein paar Groschen arme
Leute nicht mahnen und tribulieren kann.´ Diese wirklichen Gründe der Bürgerschen. Armut, seine Rücksichtnahme auf die in gedruckten Verhältnissen lebende Bevölkerung, wurden freilidl von der reaktionären Forschung
ignoriert.[...] Die Denkschrift Bürgers stellt das Bild des Dichters in ein neues Licht. Sie zeigt, daß es sich um eine politische Auseinandersetzung handelte, in der Bürger gegen die adeligen Ausbeuter die Sache
des Landvolkes vertrat. Darum ist es verständlich, daß Bürger, obwohl es ihm gelang, Punkt für Punkt die Anklagen des Generalmajors von Uslar zu widerlegen, gezwungen war, sein Amt niederzulegen.
[S. 252] Das
Urteil über Bürger als Dichter steht noch immer unter dem Einfluß der Rezension von Bürgers Gedichten, die Schiller im Jahre 1791 in der ´Jenaischen Allgemeinen Literaturzeitung´ veröffentlichte. Dieses Urteil
Schillers, das fast von allen Literaturgeschichten übernommen wurde, war ein Ausdruck der ideologischen Wandlung, die Schiller in diesen Jahren durchmachte. Schillers Anfänge hatten mit unter dem starken Einfluß
Bürgers gestanden. Diese Haltung revidierte er unter dem Einfluß der idealistischen philosophischen Auffassungen, die er in der neuen Phase seiner Entwicklung zum Maßstab für die Beurteilung der Bürgerschen Gedichte
machte. Diese Wendung in Schillers ästhetischen Auffassungen drückte sich nicht nur in seinem Urteil über Bürgers Gedichte aus. Die Abkehr vom Realismus war ein leitender Gedanke in allen seinen ästhetischen
Arbeiten dieser Periode.
[S. 253 ] Versuche, die auch heute noch auftaudlen, Schillers Rezension mit dem Hinweis auf einige schwächere Gedichte Bürgers ohne Vorbehalte zu rechtfertigen, umgehen den Kern der
Frage. Wenn zwischen zwei so bedeutenden Vertretern der deutschen Literatur, wie Bürger und Schiller, Meinungsverschiedenheiten über grundsätzliche Fragen des literarischen Schaffens entstanden, mußten sie tiefere
Wurzeln haben. Es kommt also nicht darauf an, dem einen oder dem andern ´recht zu geben´, sondern das Wesen des Konflikts historisch zu analysieren. Neben Gegensätzen in der ästhetischen Auffassung spielte im
Konflikt Bürger-Schiller auch die politische Differenzierung eine bestimmte Rolle, die zwischen den früheren Anhängern des Sturm und Drang am Ausgang der achtziger Jahre eintrat. Während Schiller die Uberwindung der
Feudalgesellschaft auf dem Wege von Reformen anstrebte, entwickelte sich Bürger immer mehr zu einer revolutionär-demokratischen Auffassung, an die einige Jahrzehnte später Georg Büchner anknüpfen konnte.
[S.
254] Das lyrische Genre, das Goethe als ´Gelegenheitsdichtung´ bezeichnete, das heißt Dichtungen, die unmittelbarem konkretem, sinnlichem Erlebnis entsprangen, blieb Schiller im ganzen fremd. Was ihn zu Iyrischer
Dimtung bewegte, waren gedankliche, vorwiegend philosophische Probleme. Schillers Bedeutung als Lyriker, besonders in den späteren Jahren seiner Entwicklung, ist vor allem mit seinen philosophischen Dichtungen
verbunden, einem Genre, das damals auch vielfach als Gedankenlyrik bezeichnet wurde. Dagegen ging Bürger als Lyriker stets vom konkreten Material der Wirklidlkeit aus. Auf religiöse und weltanschauIiche Fragen
reagierte er gelegentlich durch leichte, satirisch gefärbte Dichtungen, die der philosophischen Tendenz der SchiIlerschen Iiterarismen Bestrebungen widersprachen. Zu diesen Gedichten gehörte auch Bürgers
humoristische Ballade ´Frau Schnips´,[...]
[S. 255] Trotz der in der Hauptlinie progressiven RolIe, die Schiller in der Entwicklung der deutschen Literatur spielte, wurde ihm -nach seinem Übergang zur
idealistischen Ästhetik - der volkstümliche Demokratismus der Bürgerschen Dichtung fremd und unverständlich. Das einseitige Urteil Schillers, das aus seiner komplizierten inneren Entwicklung in dieser Periode
begriffen werden muß, ist darum nicht geeignet, einen Maßstab für die objektive Bewertung der literarischen Leistung Bürgers zu bilden.
[S. 256] Legt man an seine Dichtungen den Maßstab des Realismus an, beurteilt man sie nach ihrem Zusammenhang mit dem
Leben, so erscheint Bürgers volle Bedeutung als Begründer der deutschen Balladendichtuug und
eines der talentiertesten Lyriker der Sturm-und-Drang-Zeit. Goethe hat diese Seite Bürgers, obwohl er einzelnen Dichtungen ´Plattheit´ vorwarf, hoch gewürdigt: ´Bürgers Talent anzuerkennen kostete mich nichts, es
war immer zu seiner Zeit bedeutend; auch gilt das Echte, Wahre daran noch immer und wird in der Geschichte der deutschen Literatur mit Ehren genannt werden.´ (An Zelter am 6. November 1830.) Bürger hat
Volkstümlichkeit nicht nur gefordert, seine besten Dichtungen waren auch volkstümlich, lebensvoll, optimistisch: Seine LiebesIyrik ´Das Mädel, das ich meine´, ´Lust am Liebchen´, ´Mollys Wert´, ´Liebeszauber´ wirkt
durch ihre frische, unmittelbare Sinnlichkeit und ihre volkstümlichen Töne. Bürger ist auch einer der stärksten politischen Lyriker Deutschlands im 18. Jahrhundert. Nur wenig deutsche Gedichte gibt es, in denen die
Empörung des Volks über Mißhandlungen einen solchen konzentrierten dichterischen Ausdruck gefunden hat wie in Bürgers ´Der Bauer An seinen durchlauchtigen Tyrannen´
[S. 259] Über eine große literarische
Leistung Bürgers wird in der Regel geschwiegen: über seine Rolle als Autor des ´Münchhausen´, der in die Ausgaben von Bürgers Werken nicht aufgenommen ist. Bürger hat seinen Münchhausen als Übersetzung aus dem
Englischen anonym erscheinen lassen. Es ist richtig, daß Bürger ein englisch erschienenes Buch Raspes als Vorlage benützte und daß er die Figur des Lügenbarons nicht erfand. Aber dennoch ist Bürgers ´Münchhausen´
weit mehr als eine bloße Übersetzung aus dem Englischen. Es hat nach Bürgers Tode noch hundert Jahre gedauert, bevor der Literaturwissenschafler Grisebach als erster die Frage nach der Beziehung Bürgers zu seinem
Original gründlich untersuchte und zu dem Resultat gelangte, daß man den ´Münchhausen´ als Originalwerk Bürgers betrachten muß. Nicht nur, daß Bürger einen bedeutenden Teil der Erzählungen selbst erfunden hat, er
gab auch dem ´Münchhausen´ die endgültige literarische Form, durch ihn wurde ´Münchhausen´ zu einem wahren deutschen Volksbuch, das die Traditionen der Schildbürger und Till Eulenspiegels wieder aufnahm.[...] Wie
stark diese antifendale Tendenz des Bürgerschen Volksbuchs von den Zeitgenossen und nachfolgenden Generationen empfunden wurde, zeigen uns verschiedene Münchhauseniaden, die in der Vormärzperiode das Bürgersche Werk
fortsetzten. Neben lmmermann, der in seinem bekannten Werk eine neue Auffassung des Münchhausen-Typus gab, muß hier auch ein anonymer Druck genannt werden, der mit Bildern von W. Cornelius unter dem Titel
´Lügen-Chronick´ 1839 von Scheibles Buchhandlung in Stuttgart publiziert wurde. In ihm ist die Bürgersche Fassung des Münchhausen durch eine dritte und vierte Abteilung ergänzt. In dieser Fortsetzung wird
Münchhausen nicht nur als Lügner und Aufschneider, sondern auch direkt als adliger Ausbeuter aufgefaßt. [...] Bürger war in seiner Zeit einer der wenigen deutschen Dichtet, die nicht nur von Volkstümlichkeit
redeten, sondern auch die wirklichen Interessen des Volkes zum Ausdruck brachten. Dieser konsequente Demokratismus stellt ihn als einen der besten Vertreter der deutschen klassischen Dichtung an die Seite von
Lessing, Herder und Forster."
Reimanns G. A. Bürger in der ONLINE-BIBLIOTHEK
|
|
1963
|
Brentano, Clemens. Rezension einer Aufführung der ´Braut von Messina´.
In: Werke, Bd. 2 München 1963. Hier nach Norbert Oellers: Schiller - Zeitgenosse aller Epochen, Frankfurt/Main 1970
“[S. 151] Einer einzelnen Stelle erinnere ich mich in der ,Braut von Messina´, welche sie, man kann nicht sagen vergriffen, denn in dieser ganzen Tragödie hat es mit allem Greifen ein
Ende, welche sie in einer Manier gesprochen, die nach allen Kunstgesetzen falsch ist, aber auf dem Theater und bei den unseligen Deklamatoren leider angenommen ist und ihren Effekt macht (alles tut seinen Effekt,
pflegte Goethes verewigte kräftige Mutter zu sagen, selbst usw.); dieses ist die malende Manier, die sogar in der Musik meist ans Lächerliche, an die Parodie grenzt. Als sie den Söhnen ihren Traum erzählte, malte
sie mit ihrer Stimme alle Ungeheuer, die sie gesehn, und alle ihre Bewegungen; sie malte sie vortrefflich, aber man malt nicht mit Tönen in der Rede, es sei denn, man sagt dabei, ich will auch dies mit Tönen zu
malen suchen. Zumsteeg hat diese Manier bis zum Lächerlichsten in seinen durchkomponierten Bürgerschen Balladen, ja man hört dort die Pfarrerstochter von Taubenhain mit Tonruten peitschen. Ich sage nochmal, diese
Künstlerin hat vortrefflich gespielt, aber nicht im Stil.“
|
|
1963
|
Staiger, Emil. Zu Bürgers ´Lenore´. Vom literarischen Spiel zum Bekenntnis. In: Stilwandel. Studien zur Vorgeschichte der Goethezeit. Zürich und Freiburg i.Br.
[S. 95] Originalität als Endergebnis eines Prozesses, der sich über ein halbes Jahr hinzieht! Wir haben uns damit abzufinden, wie sehr auch ein solches Verfahren der Ideologie des
Sturm und Drang widerspricht. Mit Bürger gehen wir einig. Er faßt gelegentlich seine ganze Poetik mit folgenden Worten zusammen:
´Poesie ist eine Kunst, die zwar von Gelehrten, aber nicht für Gelehrte, als solche, sondern für das Volk ausgeübt werden muß.´
Von Gelehrten, doch für das Volk! Das führt uns zu einer weiteren Einsicht, die gleichfalls die Entstehungsgeschichte mit wünschenswerter Klarheit vermittelt. Hölty dachte in seinen Gedichten sich jeweils den
Zuhörerkreis hinzu. In den Gespenster- und Schauerballaden sind es Knechte, Mägde, Bauern. Die Minnelieder setzen wieder einen anderen, die Oden einen hochgebildeten Kreis voraus. Das heißt, er nahm als Dichter bei
jeder Species eine bestimmte Rücksicht. Er machte sozusagen den Vorbehalt: Jetzt so, ein ander Mal anders! Es blieb bei einem leichten, in seiner Auswirkung schwer faßbaren ´Als ob´. Bürger dagegen kommt dank Herder
und dank dem Goetheschen ´Götz´ , der während der Arbeit an der ´Lenore´ erscheint, zu der beglückenden Überzeugung, daß alle wahre, große, mächtige Dichtung für das Volk bestimmt sei. Was er sich unter ´Volk´
vorstellt, mag noch so konfus und widerspruchsvoll sein. Genug, es ist die eine, die höchste Instanz. Und also gibt es nun keinen Anlaß für jenes ´ein ander Mal anders´ mehr. Der Vorbehalt wird gegenstandslos.
[S. 97] Da werden die geistlichen Wendungen einfach deshalb gewählt, weil sie volkstümlich sind, volkstümlich aber nicht, wie die Bänkelsänger es meinten, sondern in reinerem, allgemeinerem Sinn. Ob nun die
Mutter fromm zitiert:
´Was Gott tut, das ist wohl getan.´
oder, mit Bezug auf Wilhelm statt, wie Luther in ´Ein´ feste Burg´, auf irdische Widersacher des Herrn:
´Laß fahren, Kind sein Herz dahin!
Er hat es nimmermehr Gewinn!´,
Lenore dagegen lästerlich Zeilen aus Dreses ´Seelenbräutigam´, aus Rambachs ´Sei willkommen, Davidssohn´ und andern Chorälen
einflicht, ist religiös, im Hinblick auf den Dichter völlig irrelevant. Aus diesem Wortschatz schöpfen die einfachen Leute des 18. Jahrhunderts, in schicklicher oder, wie jeder beliebige Fuhrmann, der flucht,
unschicklicher Weise. So wenig es Bürger jemals einfällt, als Hüter geistlicher Güter das eine zu loben oder das andre zu tadeln, so wenig denkt er an Blasphemie. Die kernige Sprache als solche gefällt ihm; und also
bedient er sich ihrer, wo es nur angeht, mit größter Genugtuung.
[S. 99] Alle diese Mängel werden in der gültigen Fassung getilgt. Wir haben sogleich die Gebärde, die uns aufschreckt und Aufmerksamkeit
erzwingt. Die schwachen Verben ´weinte´, ´prägte´ sind beseitigt. Das ´fuhr´ entfaltet seine Klangmacht. Die Reime ´tot´ auf ´rot´, ´säumen´ auf ´träumen´ - tönen. Wir hören jenes gesättigtes Deutsch, das in den
siebziger Jahren außer Bürger nur noch Goethe schreibt. Immer wieder fühlen wir uns von der männlichen Führung der Sprache gestärkt:
´Und warf sich hin zur Erde,
Mit wütiger Gebärde.´ “
Der vollständige Beitrag in der ONLINE-BIBLIOTHEK
|
|
1964
|
Scott, Penelope E.A.L.. Gottfried August Bürgers Übersetzungen aus dem Englischen. Dissertation Zürich
“[S. 21] Ein Vergleich [der Frau Schnips] mit dem Gedicht “Wanton Wife of Bath” von Percy [...] zeigt, daß Bürger ziemlich wortgetreu übersetzt hat. Dabei ist er wie immer bemüht, die
Geschichte zu verdeutschen und das spezifisch Englische wegzulassen.
[S. 24] Blömkers Kritik [Dissertation 1930, siehe ONLINE-BIBLIOTHEK] ist nicht nur völlig fehl am Platz, sondern zeigt, wie wenig Einsicht er in Bürgers Motive und Beweggründe gewonnen
hat. Es ist wirklich erstaunlich, wie A.W. Schlegel und Blömker die englische Ballade ganz von jeglicher Derbheit lossprechen, während sie Bürger an den Pranger stellen.
Wahrscheinlich ist diese
Diskrepanz in der Beurteilung auf die altertümlichen Wörter der englischen Ballade zurückzuführen. Durch ihre Fremdartigkeit wirken diese etwas weniger grob, sie sind es aber in der Bedeutung nicht. Beispiele:
“doting knave”, “churl”, “drunken ass”, “a vile scold”, “a whore son”. Bürger mildert diese sehr starken ernstgemeinten Titulationen, indem er alles ins Komische dreht. Bürger ist äußerst vorsichtig und taktvoll
in seiner Behandlung der Gespräche zwischen “Frau Schnips” und Christus [Hervorhebung - K.D.].
[S.128] Seine eigene, stark ausgeprägte Dichterpersönlichkeit stand ihm im Wege und ließ ihn nie wie etwa Herder oder A.W. Schlegel die fremde Dichtung als etwas völlig anderes
begreifen und schätzen. Das Ergebnis war, daß er auf seiner Suche nach fremden Vorbildern überall nur sich selber fand. Der Übersetzer Bürger macht keine Entwicklung durch. Seine ersten oder letzten Übersetzungen
unterscheiden sich im Stil keineswegs voneinander. Einige empfinden wir wohl besser als andere, aber das hat nichts mit der Zeit ihrer Entstehung zu tun. Es hängt nicht von Bürgers geistiger Entwicklung ab, sondern
vom ausgewählten Text, der mehr oder weniger gut zu seiner Sturm und Drang-Persönlichkeit und seinem anekdotischen Erzählstil paßte. So kommt es, daß seine besten Übersetzungen, die sich wirklich als selbständige
Dichtungen behaupten können und uns immer wieder begeistern, das Volksbuch “Münchhausen” und die beiden komischen Balladen “Der Kaiser und der Abt” (Nach Percys “King John and the Abbot of Canterbury”) und “Frau
Schnips” (nach Percys “Wanton Wife of Bath”) sind.
Bürgers Übersetzertalent zeigt sich weniger in großen, durchgehenden Texten als in kleineren Werken. Er bevorzugt denn auch vor allem die Kurzform der Ballade,
wo er das Ganze schnell in einem Zug niederschreiben konnte, wo er nicht genötigt war, immer wieder abzubrechen, um dann lange auf die dichterische Stimmung warten zu müssen.
Auch wenn er uns nur das Volksbuch
Münchhausen gegeben hätte, bliebe sein Verdienst als Übersetzer noch groß genug. Insbesondere bei seinen Übersetzungen aus dem Englischen bewundern wir die gelungene Eindeutschung, die so vieles von der Atmosphäre
des jeweiligen Originals einfängt. Bei all diesen Arbeiten zeigt er sich aber stets bemüht, verständlich und ansprechend zu schreiben. Er sucht ständig seine Leser in den “süßen Wahn” zu versetzen, daß der
vorliegende Text gar keine Übersetzung, sondern von vornherein deutsch geschrieben sei.”
|
|
1964
|
MEYERS TASCHENLEXIKON A-Z , VEB BIBLIOGRAPHISCHES INSTITUT LEIPZIG, S.153
“antifeudaler, volksverbundener Lyriker; Schöpfer der modernen dt. Ballade (“Lenore”); seine “Münchhausen”-Bearb. wurde
Volksbuch.”
|
|
1965
|
Deutsche Literatur in der Periode der “literarischen Revolution” (Sturm und Drang) 1770-1789. In: Deutsche Literaturgeschichte in einem Band, Hg Hans-Jürgen Geerdts
"[S. 218] Popularität stellte er als höchste Forderung an die Dichtkunst, in der Verbindung mit dem Volk sah er die Wurzel alles literarischen Schaffens. In seinem Balladenschaffen
knüpfte Bürger zunächst an den bereits von Gleim in seinen tragikomischen Romanzen aufgegriffenen Bänkelsang an (´Der Raubgraf´, ´Frau Schnips´) und wandte sich bald im Sinne Herders den Traditionen echter
Volksdichtung zu. Er wählte aus Sagen, Märchen und Liedern Stoffe und Motive aus und verarbeitete sie zu etwas völlig Neuem. [...] In der Soldatenbraut Lenore, die vergeblich auf die Heimkehr ihres Geliebten aus dem
Siebenjährigen Krieg wartet, gestaltete Bürger ein erschütterndes Menschenschicksal seiner Zeit. Lenore gibt ihrer Empörung gegen Gott und ihrem Verlangen nach menschlichem Glück ergreifenden Ausdruck. In der
Ballade ´Der Wilde Jäger´ (1778) verwandte Bürger den weitverbreiteten Sagenstoff vom wilden Jäger zu einer aktuellen Kritik an dem feudalen Jagdunwesen, das eine der fürchterlichsten Geißeln der Bauern im 18.
Jahrhundert darstellte. Der Stoff der Ballade ´Des Pfarrers Tochter von Taubenhain´ (1781) war vollends aus der Gegenwart gegriffen. Das Kindsmordmotiv wurde hier wieder aufgenommen. Bürger enthüllte am Verhalten
des adligen Verführers und des Pfarrers die Verlogenheit adliger und bürgerlicher Moralauffassungen und deckte die psychologischen und gesellschaftlichen Gründe des Kindsmordes auf.
In dem
politischen Gedicht '´Der Bauer an seinen Durchlauchtigen Tyrannen´ (1773) trat zum ersten mal in der deutschen Dichtung des 18. Jahrhunderts ein Bauer als trotziger Rebell auf, der sich offen seinem adligen Herrn
gegenüber auflehnt und seine eigenen Rechte anmeldet: [...] Hier hegte Bürger keine Illusionen mehr über Reformen durch den aufgeklärten Fürsten, unversöhnlich prallen die Klassengegensätze aufeinander. [...] Unter
dem Eindruck der revolutionären Ereignisse in Frankreich erlebte Bürger jedoch 1792. einen neuen Aufschwung als politischer Dichter.
[S. 219] Die französische bürgerliche Revolution begrüßte er bereits im Februar 1790 in seiner Freimaurerrede ´Ermunterung zur Freiheit´. In Epigrammen, Fabeln (´Das
Magnetengebirge´) und Gedichten (´Straflied beim schlechten Kriegsanfang der Gallier´, ´Die Tode´), die er im Göttinger ´Musenalmanach auf das Jahr 1793´ veröffentlichte, wie in dem nachgelassenen Liedfragment ´Für
wen, du gutes deutsches Volk´ verteidigte Bürger die Revolution gegen alle Angriffe reaktionärer Kräfte und verurteilte die Intervention der europäischen Feudalgewalten gegen Frankreich. Die Einsicht in die
Notwendigkeit des revolutionären Terrors teilte Bürger nur noch mit Forster. [...] Liegt den lose aneinandergereihten Lügenmärchen des Barons Münchhausen auch eine ursprüngliche Freude am Fabulieren zugrunde, so
sind sie vor eine antifeudale Satire, die den heruntergekommenen Adel als Lügner und Aufschneider bloßstellt und den deutschen Provinzialismus geißelt."
|
|
1966
|
Kluckhohn, Paul. Die Auffassung der Liebe in der Literatur des 18. Jahrhunderts und in der deutschen Romantik.
“[S. 211] Die schärfsten Worte gegen die Ungültigkeit des ehelichen Eides, wenn das Herz ihm widerspreche, fand Schiller, der in seiner ersten Periode der glühendste Verfechter der Rechte der Sinne war, von einer radikalen Kühnheit der Darstellung,. der aber freilich auch das Unbefriedigtsein und das Zerstörtwerden durch die Steigerung nur sinnlicher Leidenschaft gestaltet hat (´Melancholie´). Diese wehe Zerrissenheit zeigt das Lehen der meisten Stürmer und Dränger, sie wurde ihnen ein Hauptproblem und führte dann wohl auch zu so bedenklichen Lösungen wie die Ehe zu dritt.
Eine solche war als reales Liebesverhältnis neben der Ehe der Laxheit der Zeit, besonders in Frankreich, geläufig, und wurde als Nebeneinander von Seelenbeziehung und natürlicher Ehebeziehung von den Anhängern
empfindsam platonisierender Liebe, auch von Rousseau, verteidigt. Lenz läßt den Maler, der Catharina von Siena liebt, diese darauf hinweisen als auf eine Beglückung für ihn trotz ihrer Eheschließung mit einem
anderen, sie
aber diesen Vorschlag als Mangel an Liebe empfinden. Das ist bezeichnend. Liebe soll keine Teilung und Trennung leiden. Die Ehe am Schluß von ´Die Freunde machen den Philosophen´ ist denn auch nur
eine Scheinehe, in der der Gatte Prado den Namen leiht und ganz zurücktritt, die volle Liebe Seraphinens aber Strephon gehört. Doch auch als Schwanken der Empfindung des Mannes zwischen zwei Frauen hat jene Zeit die
Ehe zu Dritt dargestellt.
Das Leben bot Beispiele genug für solche Beziehungen. Eben die Willenlosigkeit, das neugierig freudige Interesse, mit dem die Menschen der empfindsamen Zeit und des Sturmes
und Dranges sich ihrem Gefühlserlebnis überließen, führte leicht zu Doppelverhältnissen, zu vorübergehenden Beziehungen außerhalb der Ehe, zu einem Umhergetriebensein zwischen mehreren Frauen, ja auch einer Ehe zu
dritt. Bürgers Doppelehe ist bekannt. Typisches Beispiel der Zeit ist ferner das Erleben seines Freundes Sprickrnann, der so leidenschaftlich und so schwankend liebte und in der Ehe kein Genügen finden konnte und
der. das programmatische Wort prägte: ´Das Ideal der Dichtkunst ist der leidenschaftliche Mensch´. Gerade in geistig hochstehenden und edeldenkenden Kreisen war man leicht geneigt, kleine Eheirrungen zu
entschuldigen.
[S. 216] Aber gerade diesem neuen Kraftstil, dieser Leidenschaftlichkeit der Darstellung verdankten die Stürmer und Dränger
die große Wirkung ihrer Dichtungen und die Emsigkeit, mit der die Nachahmer sich ans Werk machten.”
|
|
1967
|
Lexikon deutschsprachiger Schriftsteller von den Anfängen bis zur Gegenwart. VEB Bibliographisches Institut Leipzig,
“[S. 201] B., dessen konsequent demokratisch-plebejische Haltung wie seine Begeisterung für die Französische Revolution bekannt waren, wurde, da er nicht von der Gnade der Fürsten leben
wollte, ein Opfer der elenden dt. Zustände. Er lebte von Übersetzungen für Verleger und als Redakteur des ´Deutschen Musenalmanachs´ (1779/94).[...] B. war einer der stärksten und ursprünglichsten Lyriker des 18.
Jh., der sich nicht scheute, seine Dichtung in den Dienst seiner politischen Gesinnung zu stellen (´Der Bauer an seinen durchlauchtigen Tyrannen´, ´Für wen, du gutes deutsches Volk . ..´). Seine überragende Leistung
liegt auf dem Gebiet der volkstümlichen Ballade, die er unter dem Einfluß Herders und der engl. Volkspoesie schuf. Mit ´Lenore´, ´Der wilde Jäger´, ´Der Raubgraf´, ´Das Lied vom braven Mann´, ´Des Pfarrers Tochter
von Taubenhain´ u. a. gelangen ihm weitverbreitete, populäre Dichtungen, die sich durch ihren antifeudalistischen und volksverbundenen Charakter, durch realistische Darstellungskraft, leidenschaftliche Anteilnahme
und Formvollendung (Spannung, Stimmungs- und Lautmalerei, volkstümliche Wendungen, erregender Rhythmus) auszeichnen. B. verstand Lyrik als persönliches Bekenntnis, als Ausdruck innerer Bewegtheit (vgl. z. B. die
´Molly-Lieder´), was u. a. in Schillers berühmter Rezension (1791) vom Standpunkt des klassischen Kunstideals getadelt wurde. B.s zum Volksbuch gewordener ´Münchhausen´ (1785), eine köstliche Satire auf den Adel,
die er anhand von zwei Vorlagen aus dem Engl. des R. E. Raspe zurückübersetzte und insgesamt um etwa ein Drittel erweiterte, gehört neben seiner Lyrik zu seinen fortlebenden poetischen Werken.”
|
|
1967
|
Kohlschmidt, Werner. Sturm und Drang. In: Deutsche Literaturgeschichte in Grundzügen. Bern und München. (Sammlung Helmut Scherer)
“[S. 234] Goethes hymnischer Titanismus und Herders Odenpathos sind in erster Linie Kraft-und Gefühlsausdruck, jedoch nicht Ausdruck einer Zerrissenheit oder einer Unbedingtheit mit
naturalistischen Konsequenzen. Diese letzten sind weit eher bei Gottfried August BÜRGER anzutreffen. Das gilt nicht nur für die makabren Züge seiner Balladen, voran der Lenore, die ihr ´Rabenhaar zerrauft´,
als der Geliebte nicht wiederkehrt, und in deren Wortschatz extreme Äußerungen: Geheul, Gewinsel und Wut gehören. Es gilt auch nicht nur für die ebenso extremen Motive (die zugleich ein naturalistisches Wortfeld
bedeuten) in andern Bürger-Balladen. Hier kann sich Der Raubgraf, gefangen und in den Hungerkäfig gesetzt, kannibalisch Glied um Glied selber auffressen oder einem unerwünschten Liebhaber das Herz ausgerissen
werden (Lenardo und Blandine). Das gleiche Motiv findet sich in Die Entführung, wo der Liebhaber den Schwur tut, er wolle nicht rasten, bis er dem Nebenbuhler das Herz ausgerissen und es dem Mädchen
´nachgeschmissen´ habe. Ein solches Schwelgen im Krassen ist auch die Unbarmherzigkeit des Vaters in Des Pfarrers Tochter von Taubenheim. Es ist dies die mißverstandene und ins Hyperrealistische pervertierte
Todes- und Schicksalstragik, die man aus der alten Balladengattung als Stilforderung herausliest. Aber ob auch geschmacklos - es ist Anwendung des Willens zum Unbedingten, wie er für den Sturm und Drang
charakteristisch ist.
Jedoch auch schon in frühen Liebesgedichten Bürgers findet sich diese naturalistische Stilnote. Verse wie ´An meinem Leben nagt die Wuth / Grausamer
Seelengeier´ oder ´Mein Kuß erstickt ihr letztes Lallen´ wären in der Liebeslyrik des jungen Goethe undenkbar. Sie beruhen auf einem vorexpressionistischen Ausdruckswillen, der vor nichts zurückschreckt, weil er
Ausgleich und Disziplinierung (wie es auch für Bürgers eigene Existenz gilt) verachtet. ´Schlagt Wellen, über mir zusammen! Ich brenne! brenne! Kühlet mich!´ So sieht in einem der Gedichte an Molly das Unbedingte im
eigenen Eros aus.[...] Schiller hätte diese Problematik Bürgers nicht besser formulieren können in seiner kritischen Rezension von Bürgers Gedichten, die später seine Freundschaft mit Goethe einleiete. Bürgers Lyrik
war in sich ein Extrem mit fast paradoxen Spannungen, die die Sprache nur widerspiegelte. Glühendes Lebens- und Liebesverlangen wechselt mit dem Wunsch, ´bis hinein ins leere Nichts entweichen´ zu wollen.
Antibürgerlichkeit und offen zur Schau getragener Tyrannenhaß wechseln mit geheimer und offener Sehnsucht nach dem Idyll, die dem Genossen des ´Hains´ kaum fremd sein konnte. Aber neben der Wollust der Leidenschaft,
des Tötens und Strafens und den entsprechenden Naturalismen des Stils der Balladen, in denen der Zweikampf im Bilde des Fleischhackens erscheinen konnte, ist Bürger paradoxerweise ein Meister des Sonetts, einer der
kultiviertesten Gattungen der Tradition. Das gehört zu seiner Psychologie und auch wohl zu seiner Phantasie. Denn diese dem Eigenwilligen anscheinend widersprechende Formwahl ist für ihn ein vielleicht gewagteres
´Spiel´ als das, was seine selbstherrliche Genialität betreibt. Daß Bürger über seinen Jünger Wilhelm Schlegel unmittelbar die romantische Spielfreude mit dem Sonett hervorruft, dürfte dies stützen.
[S. 277]
Die Bürger-Rezension macht Goethe das innere Verhältnis völlig klar. Für Goethe bestand ein dissensus zwischen Genie und Leben bei Bürger. Schillers sorgfältige Kritik von Bürgers Gedichten löst ihm diesen
Widerspruch auf. Schiller nimmt die Erscheinung Bürgers als durch die ästhetische Zeitlage bedingte. In einer Zeit, in der das Denken dominiert, ´ist es die Dichtkunst beinahe allein, welche .. gleichsam den ganzen
Menschen in uns wiederherstellt´. Diese neue Funktion der Dichtung muß aber mit der Zeit und ihren geistigen Errungenschaften gehen. Der Künstler muß also zugleich Ursprung (Einheit) und seiner Zeit gerecht sein.
Das ist der klassische Maßstab, dem freilich Bürger nicht genügen kann: ´Begeisterung allein ist nicht genug; man fordert die Begeisterung eines gebildeten Geistes.´ Diese (im klassischen Sinne) gemeinte ´Bildung´
verkörpert Bürger nicht, weil er sich ihrer als ´Volksdichter´ enthoben glaubt. Aber die Forderung ist unbedingt, die Schiller am Schluß ausspricht. Sie ist Winckelmannisch und Goethisch zugleich: ´Sich mit immer
gleicher ästhetischer und sittlicher Grazie, mit männlicher Würde, mit Gedankengehalt, mit hoher und stiller Größe zu gatten und so die höchste Form der Klassizität zu erringen.´ “
|
|
1968
|
Stern, Martin. Gottfried August Bürgers Sonett An das Herz. In: Literatur und Geistesgeschichte.
„[S. 185] Gerade wer Bürgers übrige, meist naivere Gedichte und Balladen kennt, wer seine Briefe liest und seine ästhetischen Schriften, entdeckt ohne Mühe und oft mit
Enttäuschung, daß in diesem Dichter - losgelöst vom eigentlichen Werk - kaum ein philosophisches Problembewußtsein und im ganzen ein weit primitiveres Formbewußtsein leitend war, als wir in den besten
Augenblicken der größten Gedichte zu entdecken meinen. Das ist ein den Literaturhistoriker beunruhigendes, aber auch ermutigendes Paradox. Es gibt offenbar Erkenntnisweisen, die dem künstlerischen Akt allein gegeben
sind.
Bürgers Sonett-Theorie etwa lobt die ´kleinen´ Themen und wirbt für leicht zu rundende und zu erschöpfende Stoffe von geringerem Gewicht. So bleibt des Dichters theoretische Absicht weit
hinter seiner eigenen Leistung. Und wer das Urteil über Bürgers Sonettkunst von der Reife seiner Thesen abhängig macht, wird dieser Kunst auf keinen Fall gerecht. Denn wenn in
An das Herz Höchstes
gelingt, so gerade nicht dank der Angemessenheit des Inhalts, sondern allein aufgrund der unerhörten Spannung, die zwischen der engschließenden Form und einer end- und antwortlosen Aussage entstehen muß; zwischen
der strengsten Gesetzlichkeit des Baues und dem unbezwingbarsten aller Gehalte: der Unerklärlichkeit des Lebens selbst.
Bürger hat das wohl nie im eigentlichen Wortverstand erkannt, wie
überhaupt viel Halbdurchdachtes, Dumpfes in seinen Briefen eine merkwürdige Reflexionsunfähigkeit auf dieser Ebene immer wieder zeigt. So begriff der Mensch sein Schicksal im Erleiden nie, nie die erfahrene Gewalt
der Leidenschaft, wie etwa Schopenhauer den Eros durchschaute. Er war auch nie bewußt Rebell, sondern schmerzlich erstaunt über die Unbotmäßigkeit des Triebes. Doch dieser Verwunderung entsprangen die wichtigsten
der späteren Gedichte. Schiller hat in seiner Rezension des Bandes von 1789 seinen Gegner, dem er Unreife und Zügellosigkeit vorwarf, herausgefordert, ihm ein Zeugnis seiner Kunst zu nennen, das nicht in Verletzung des Formgefühls und des Geschmacks verwildert sei. A. W. Schlegel, Bürgers Göttinger Jünger und Freund, blieb bis zuletzt der Ansicht, ein siegreiches Wort wäre in diesem Streit dem Meister möglich. Aber Bürger unterlag auf dieser diskursiven Ebene hoffnungslos. Dabei schrieb er in Krankheit, Bitternis und Not noch ein Jahr vor dem Tode als nicht 47jähriger ein Gedicht wie An das Herz, das
in jedem Zug die Forderung Schillers mühelos erfüllt, allerdings nicht im Gewand der umstrittenen Volkstümlichkeit. Aber Schiller hatte ihn darauf festgelegt. Und so blieb die Rechnung unbeglichen.“
Sterns Analyse in der ONLINE-BIBLIOTHEK
|
|
1968
|
MEYERS KLEINES LEXIKON, VEB BIBLIOGRAPHISCHES INSTITUT LEIPZIG
"Plebej.-demokrat. Schriftsteller des Sturm und Drang; war beispielgebend für die volkstüml. deutsche Balladendichtung (´Das Lied vom braven Manne´, ´Lenore´). B., der sich für die
Französ. Revolution begeisterte, kämpfte in Gedichten und Prosaschriften gegen die Tyrannenherrschaft. Seine Bearbeitung der satir., gegen den Adel gerichteten ´Wunderbaren Reisen des Freiherrn von Münchhausen´
(1786) wurde ein vielgelesenes Volksbuch."
|
|
1968
|
Schöne, Albrecht. Weltliche Kontrafaktur Gottfried August Bürger. In: Säkularisation als sprachbildende Kraft. Studien zur Dichtung deutscher Pfarrersöhne.
"[S. 185] Bürgers theoretische Schriften enthalten eine Fülle solcher Äußerungen [z.B. im Vorbericht der >Ilias<-Übersetzung] über die Sprache und den dichterischen Umgang
mit ihr, die gekennzeichnet sind durch einen Anspruch, dessen Unbeding[t]heit den Bereich des ´wirkenden Menschengeistes´ auf das Religiöse hin öffnet. Literarische Tätigkeit wird ins Heilige und Göttliche erhöht,
als edelste Bestimmung des Menschen überhaupt und als Gnadengabe verstanden, die nur den Auserwählten zuteil geworden: Dichtung wird zum Gottesdienst der Wortverwaltung. Das aber wird keineswegs als ein
Übertragungsvorgang begriffen und in seiner Problematik bedacht, sondern erscheint als ein durchaus unreflektierter Akt und wird sichtbar allein als sprachlicher Vorgang. Die ästhetischen Erörterungen ziehen ihr
Vokabular zu wesentlichen Teilen aus den religiösen Texten, nutzen gleichsam die Beglaubigungskraft dieser Worte, die ihnen von ihrem Ursprung her anhaftet ohne daß dabei doch dieser Herkunftsbereich selber noch als
Maßstab und Bewertungsgrundlage gegenwärtig bliebe. Es geht nicht mehr um didaktische Verweisungen, sondern um ästhetische Bereicherung. Das ,Pfarrhaus' wird abgebrochen, damit, was brauchbar und ansehnlich scheint
unter den alten Steinen, für den Bau des neuen Hauses verwendet werden kann. Diesen Bezug auf die religiöse Sprache, auf den Luthertext insonderheit, hat Bürger sich bis in stilistische Einzelheiten hinein bewußt
gemacht. In seinen »Gedanken über die Beschaffenheit einer Deutschen Übersetzung des Homer« etwa heißt es, nachdem der Verfasser die von ihm bevorzugte Anfangsstellung des Hauptzeitwortes
besprochen hat: ´Ich habe keinen Platz zu Beispielen, aber man wird ihrer genug finden, welche dies Alles bestätigen. Man schlage nur Luthers Bibel-Übersetzung und seine übrigen Schriften nach; auf jeder Seite sind
welche. Die poetischen Bücher der heiligen Schrift hat Luther mit dem besten Geschmacke, für seine Zeiten, so echt Deutsch und so feurig übersetzt, daß man darüber erstaunen muß. Ein fleißiger Sprachforscher müßte
unsere neuere Sprache mit den vortrefflichsten Schätzen aus den Schriften dieses bewundernswürdigen Mannes, wovor unseren Hominibus delicatulis so ekelt, bereichern können.´
[S. 189] Nichts anderes als eine
Übertragung des reformatorischen Verhältnisses zur Schrift und seine Anpassung an den Umgang mit dem dichterischen Wort ist sein Verantwortungsgefühl und seine Treue gegenüber dem unverrückbaren Text, ja der Glaube,
daß am Buchstaben das Heil hängen könne. Gleichgültig, welcher Grad von bewußter Einsicht in diese Zusammenhänge auch vorgelegen haben mag: Bürgers Äußerungen über solche Fragen speisen sich unablässig aus der
religiösen Sprachquelle. [...] Im engsten Zusammenhang damit muß nun Bürgers Glaubensartikel von der ´Popularität´ der Poesie gesehen werden. Denn wenn von der kirchlichen Wortverkündigung her das ´Amt,
Lehrerin der Menschen zu seyn´ auf die Dichtung übertragen wird, so fällt ihr zugleich die Pflicht zu, ins Breite zu wirken, einem unbegrenzten Leserkreise zugänglich und verständlich zu sein. Bürger nennt als
´seine Maxime, wenn nicht Allen, dennoch den Meisten, -versteht sich, ohne weder sich selbst, noch der Dichtkunst etwas zu vergeben, -zu gleicher Zeit zu gefallen.´
[S. 194] Die
auffallend häufige Verwendung solcher zusammenfassenden, abrundenden, auflösenden, erklärenden, pointierenden Schlußbeschwerungen, die der Dichter dem christlichen Sprachbereich entlehnt, muß durchaus als
Charakteristikum Bürgerscher Gedichtsstruktur verstanden werden.
Über die Bestimmung ihrer sprachlichen Herkunft hinaus sind diese beschwerten Ausgänge in einigen Verwendungsfällen nun auch auf eine genauer
bestimmbare Form des Sprechens zu beziehen. Da endet etwa ´Die Entführung´ mit den Versen:
So segne dann, der auf uns sieht,
Euch segne Gott, von Glied zu Glied!
Auf! Wechselt Ring' und Hände!
Und hiermit Lied am Ende! (I 181)
Das ist die Sprechweise des Geistlichen, und in der Tat nimmt ja hier am Ende des höchst weltlichen Balladengeschehens
der Vater des entführten Fräuleins mit Segen und Ringwechsel eine priesterliche Handlung vor. Diese personale Gleichung macht aufmerksam auf eine grundsätzliche typologische Entsprechung zwischen der
Schlußbeschwerung des Gedichtes und geistlicher Redeweise. Nicht nur das durchgehend religiös bestimmte, liturgische Sprechen endet mit einer gewichtigen Schlußformell des Gebetes, Segens oder Lobpreises; auch die
nicht mehr formgebundene, freie Rede, das Gespräch, die Ansprache so zu schließen, daß weltliches Sprechen am Ende durch einen religiösen Bezug, ein präformiertes Redestück erhöht, gekrönt, gewichtig beschlossen
wird, ist für den Geistlichen offenbar bis heute bezeichnend.
[S. 199] Mit jener Sprechweise des Geistlichen, auf welche die Schlußbeschwerung deutete, hängt diese Form der HeiIsverkündigung aufs engste zusammen. Sie steht in Bürgers Werk durchaus nicht vereinzelt; die im religiösen Sprachgebrauch ausgebildeten Formmodelle finden hier zahlreiche und vielfältige Entsprechungen, die um so deutlicher erkennbar werden, als sie noch immer merkliche Spuren auch des ursprünglichen Gehaltes tragen. Sie erweisen sich als weltliche Kontrafakturen der religiösen Vorbilder, von denen sie nicht allein das organisierende Formprinzip beziehen, sondern zugleich jenen Zuwachs an Bedeutungshöhe und Wirkungskraft, den das Modell nur dann hergibt, wenn es selbst noch als bedeutungshaltig und wirkungsfähig intakt bleibt. Die Annäherung auch der inhaltlichen Erfüllung dieser säkularisierten Formen an den christlichen Denk-und Sprachbereich befördert, ja begründet ihre reichhaltige Erscheinung in Bürgers Lyrik.
[S. 212] Man braucht nur die in den Dialogstrophen der ´Lenore´ und in den beiden Schlußstrophen verwendeten Substantive (soweit sie nicht am Ende der Ballade ausschließlich auf den gegenständlichen Vorgang
bezogen sind) zu isolieren und zu ordnen, um zu erkennen, aus welchen Quellen dieser Wortschatz gespeist wird: Welt, Wahn, Mutter, Leib, Zunge, Meineid, Herz, Arme, Sünde, Nacht, Graus, Leid, Jammer, Verzweiflung,
ich Arme, Gericht, Hölle, Feuerfunken, Gewinsel, Geheul, Tod, Gruft, die Toten; Vorsehung, Erbarmen, Gott, Vater, Kind, Beten, Vaterunser, Geduld, Sakrament, Gewinn, Glauben, Licht, Himmel, Bräutigam, Seligkeit. Es
ist das Vokabular der Lutherbibel und des evangelischen Gesangbuches. Und deren Einfluß reicht nun über das Einzelwort weit hinaus. Schon in den rhetorischen Figuren werden Anregungen der Kirchenlieder deutlich, und
ganz unverkennbar wird dieser Tatbestand in den Trostreden der Mutter, die Bürger nicht nur aus verschieden stark abgewandelten, sondern auch aus wörtlich aufgenommenen Gesangbuchversen zusammengesetzt hat. Drei
solcher Entsprechungen hat Herbert Schöffler entdeckt, sie können soweit vervollständigt werden, daß ein lückenloses Geflecht kontrafaktischer Beziehungen zwischen den Reden der Mutter und den lutherischen
Kirchenliedern sichtbar wird.
[S. 222] Kontrafaktische Säkularisation schafft so die hintergründige Gewalt des Gedichtes; aus dem Bereich christlichen Sprechens und dem Bilderschatz der religiösen Texte
stammt das Überwirkliche, Grauenerregende, Wunderbare, Inkommensurable, das in Bürgers Versen lebt. A. W. Schlegel hat - als er in seinem Bürger-Aufsatz die Gleichsetzung der vom Dichter postulierten Popularität mit
einer vollkommenen Einsichtigkeit angriff - von solchen Bezügen manches gespürt; er schrieb, daß die Poesie aus den Tiefen des Unbegreiflichen hervorgehe und dieses Unbegreifliche niemals völlig auflösen wolle.
Beispiele wahrer Popularität entdeckte er so in der Bibel und dem alten Kirchenlied - weil in ihnen etwas lebe, was ´das Gemüth plötzlich trifft, und es in die Mitte desjenigen versetzt, was ihm durch förmliche
Belehrung nicht zugänglich werden würde. Mit einem Wort, wer für das Volk etwas schreiben will, das über dessen irdische Bedürfnisse hinausgehen soll, darf in der weißen Magie, oder in der Kunst der Offenbarung
durch Wort und Zeichen, nicht unerfahren seyn.´
[S. 223] Aber der Balladendichter war kein ´Kopfhänger und Andächtler´, ihm war die ´AlltagsleyerMelodey´ durchaus nicht mehr das Wichtigste, und in dem ´innren
Seelenstückchen´ seiner ´Lenore´ ging es ihm weder um die Erhaltung des alten Gottesglaubens noch um seinen Zerfall, sondern vielmehr darum, daß die kirchlich-dogmatische Versicherung, wie sie in der versteiften
Gesangbuchsfrömmigkeit der Mutter vertreten ist, nicht mehr ausreicht, den unendlichen Schmerz des liebenden Mädchens um den Verlust des Geliebten zu stillen; darum, daß die Gewalt ihrer Leidenschaft alle Inbrunst,
die der Christ auf den Erlöser richtet, alle Klage, mit der er seinen Tod beweint, alle Freude, mit der er seine Auferstehung und Verklärung feiert, alle an Christus gebundene Gewißheit um Seligkeit oder Verdammnis
nun auf den Geliebten wirft. Denn aus dieser Umsetzung bezieht seine Ballade ihre eigentliche Kraft. Nicht Glaubenszerfall ist hier gedichtet, sondern jene Unbedingtheit der Liebe, die in tragische Verfehlung
stürzt, die in dem Toten den heimkehrenden Lebenden, im apokalyptischen Reiter den Bräutigam, der sie zur Hochzeit führt, im Tod das Leben und die Seligkeit zu finden glaubt. Auch darin mag man noch eine
Gotteslästerung sehen - aber es wäre nicht die, welche Wackernagel als Grundidee des Gedichtes feststellen wollte, sondern die gleiche, deren Bürger sich auch seinem Brief über Molly schuldig machte und die er
zeitlebens ohne Scheu begangen hat: die der Verwendung des heiligen Wortes für eine weltliche Sache.”
Der Beitrag in der ONLINE-BIBLIOTHEK
|
|
1971
|
Schulte-Sasse, Jochen. Schiller. In: Die Kritik an der Trivialliteratur seit der Aufklärung.
“[S. 76] Ohne diese durch ein breites Publikum des 18. Jahrhunderts kultivierte ästhetische Genüßlichkeit wird die plötzliche Allergie gegen ,sinnliche' Kunst nicht verständlich. Hinter
der rein ästhetischen Auseinandersetzung mit empfindelnder Modeliteratur wird darüberhinaus ein verdeckter Streit um die soziale Funktion der Kunst im Bürgertum sichtbar. Der Bürger, der nach einem arbeitsreichen
Tag zum Buch greift oder ins Theater geht, bzw. die Frauen des Bürgerstandes, deren Konsum an Massenliteratur besonders groß ist, wollen Erholung und nicht die von dem Künstler geforderte geistige Anstrengung.
Trivialliteratur stößt im 18. Jahrhundert in diese durch die Kunst selbst geschaffene Lücke vor und sättigt den legitimen Unterhaltungsbedarf des Bürgertums. Schiller freilich gibt diesem ökonomischen scharfe
Wertakzente und leugnet den Bedarf erholsamer Lektüre (den er freilich später durch den Geisterseher praktisch anerkannte).
[S. 78] Die Ungerechtigkeit Schillers gegenüber der dichterischen Leistung
Bürgers stößt vor allem bei den Bürger-Interpreten auf Unverständnis und wird als Taktlosigkeit und Gefühlsroheit hingestellt. Die von der Schiller-Forschung hiergegen vorgetragenen Milderungsgründe schränkt Benno
von Wiese mit Recht ein, denn ´auch die oft angeführte Entschuldigung, daß Schiller hier mit seiner eigenen Jugendlyrik gleichsam abgerechnet habe, bedürfte einmal dringend der näheren Nachprüfung, da sie
sich aus den vorhandenen Zeugnissen kaum belegen läßt´. Die Bürger-Rezension ist weder eine Abrechnung mit der eigenen Vergangenheit auf Kosten eines Dritten, noch allein ein unrühmliches und bedauerliches
Fehlurteil in der Geschichte der Literaturkritik; sie ist literaturpolitische Auseinandersetzung mit dem literarischen Leben der Zeit an einem exemplarischen Fall. Schiller meint in Bürgers Lyrik allgemeine Stilzüge unzulänglicher Literatur der Zeit zu entdecken und greift den genialen und eben deshalb einer persönlichen Kontroverse würdigen Bürger als Repräsentanten,der Modeliteratur heraus, um durch die Kritik an ihm gegen allgemeine Zeitsymptome zu polemisieren.
[S. 79] Schiller kommt im Verlauf seiner Rezension zu dem Urteil, daß Bürger dieses Ziel angestrebt hat. Bürger zieht, so wirft er ihm vor, das Volk nicht zur Kunst herauf, sondern macht sich ihm gleich.
Hinter seiner Verurteilung werden all die polemischen Auslassungen sichtbar, die er zur gleichen Zeit gegen die Modeliteratur gerichtet hat. Wie diese Modeliteraten hat Bürger in den Augen Schillers mehrmals eine grundsätzliche Entscheidung für eine ´angenehme´ und ´sinnliche´ Kunst und gegen eine geistbezogene getroffen, denn Bürgers Muse hat ihm ´überhaupt einen zu sinnlichen, oft gemein-sinnlichen Charakter“, die von Bürger gestaltete Liebe ist ihm ´selten etwas anders als genuß oder sinnliche Augenweide“ und ´die Gemälde, die er uns aufstellt“, sind ihm ´eine Kompilation von Zügen“. Schiller verurteilt demnach an Bürgers Gedichten nicht so sehr einzelne dichterische Fehlleistungen als vielmehr eine künstlerische Fehlhaltung.”
Schulte-Sasses Beitrag über Schiller in der ONLINE-BIBLIOTHEK
|
|
1971
|
Landmann, Michael [1913-1984]. Lenore. In: Das Ende des Individuums, Antropologische Skizzen. Stuttgart
“[S. 39] Daß wir für die Philosophie erst im dritten Jahrsiebt erwachen, bietet die Chance, daß sich anhand unmittelbaren, ästhetischen und geschichtlichen Erlebens ursprünglichere
und reichere Kategorien in uns ausbilden als die der abstrahierenden, darum aber auch wirklichkeitüberspringenden, zudem meist einseitig tendenziösen Philosophie. Zwischen der Philosophie, die wir lernen, und der,
die der meditativ Veranlagte schon mitbringt - und die er unter dem Übergewicht jener dann nicht mehr entfaltet - läuft nur eine schmale Brücke. Diese Philosophie müßte jene füllen, jene müßte diese systematisieren.
Ein Grundbuch meiner Kindheit neben Grubes ´Geschichtsbildern´ war Echtermeyers ´Auswahl deutscher Gedichte´. Hier fand ich mit sieben Jahren Wilhelm Müllers ´Alexander Ypsilanti´, ein
Gedicht, das ich mir und andern immer wieder vorsprach, hier Schillers Balladen, hier später Proben Platens, der dann mein langjähriger Liebling wurde. An einem freien Nachmittag vielleicht mit zehn Jahren stieß ich
auf Bürgers ´Lenore´, war gefangen, las sie mehrfach und lernte sie schließlich bis zum Abend nach meiner Gewohnheit auswendig (bis heute steigt sie - so wie Partien Hölderlins und anderer - oft ungerufen in mir
auf). Hier hatte ich ein Gegengewicht gefunden gegen das Klassische, das sonst in meiner Bildungswelt dominierte und das mich auch selbst anzog. Noch ehe ich von literarhistorischen Stilen etwas wußte, hatte eine
andere Seh- und Gestaltungsweise, mit ihr aber auch eine Welt- und Lebenskunde, sich mir unverlierbar eingeprägt. Daß das Phantastische das Enthüllende ist, weil nur das Irreale die normalerweise verdrängten
Problem- und Tragikböden der Realität, ihre untergründige Gefährdung, zurückruft, daß Wahrheit nicht Abbild ist, sondern über das Gegebene hinausgeht, daß somit Finden auch Schaffen heißt: dies lernte ich vor Kafka
und Picasso vorbegrifflich, am Beispiel, das doch schon das Allgemeinere durchscheinen ließ, durch Lenore. Aber nicht nur dies. Für das Kind war der nächtliche Ritt mit dem Toten kein bloßer Fiebertraum. Das
erflehte Ungegönnte kann einen dämonischen Moment lang Erlebniswirklichkeit werden, aber im Zerbrechen dieses Moments zerbrechen wir mit. “
|
|
1972
|
Tunk, Eduard von. Geschichte der Deutschen Literatur. Band 1 Zürich. (Sammlung Helmut Scherer)
“[S. 592] Schiller hat die Poesie Bürgers einer sehr scharfen Kritik unterzogen (1791) und beklagt, daß in ihr die menschliche Durchbildung hinter der künstlerischen zurückgeblieben
sei, hat aber andrerseits die elementare Gewalt dieser Poesie zugeben müssen, die, natürlich von den Sonetten abgesehen, mit allen Mitteln volkstümlicher Darstellung arbeitet (Sangbarkeit der Strophe, Klangmalerei,
Stabreim, Kehrreim usw.), sie aber leider oft forciert und mißbraucht, so daß etwas Renommistisches, ja Gemeines an demagogische Rhetorik denken läßt. Bürger, dem Göttinger Hain verbunden, ist doch eher ein Stürmer
und Dränger aus dem Straßburger Kreis. Dieser literarischen Einreihung entspricht auch der äußere Fortgang seines Lebens: Er hatte sich 1774 mit Dorette Leonhart, der ältesten Tochter des benachbarten Amtmanns zu
Niedeck, verheiratet, doch schon am Traualtar empfunden, daß sein Herz nicht seiner Frau, sondern deren erst sechzehnjähriger Schwester Auguste, der «Molly» seiner Lieder, gehöre. Da er nicht die Kraft besaß, die
Leidenschaft niederzukämpfen, und seine Liebe erwidert wurde, ward zur häßlichen Wirklichkeit, was Goethe in der ursprünglichen Fassung seiner ´Stella´ und Lenz in seinem Lustspiel ´Die Freunde machen den
Philosophen´, beide selbst mit den Wogen des Sturmes und Dranges ringend, als phantastischen Traum hingestellt hatten. 1784 starb Dorette, 1785 heiratete er seine geliebte Auguste-Molly, die schon ein halbes Jahr
darauf starb. Einige Jahre später habilitierte sich Bürger als Privatdozent an der Universität, wurde 1789 sogar Extraordinarius (jedoch ohne Gehalt), mußte weiterhin durch Privatunterricht und literarische Arbeiten
sein Brot verdienen, heiratete trotzdem 1790 das ´Schwabenmädchen´ Elise Hahn aus Stuttgart, das ihm in einem Gedicht Herz und Hand angetragen hatte, und ließ sich 1792 von ihr scheiden. Mit vollem Recht gilt auch
von Bürger das Wort Goethes über J. Chr. Günther, mit dem er viel Ähnlichkeit hatte: ´Er wußte sich nicht zu zähmen, und so zerrann ihm sein Leben wie sein Dichten.´ “
|
|
1972
|
Grote, Ludwig. Die Inkunabeln der nazarenischen Malerei. In: Joseph Sutter und der nazarenische Gedanke. München.
“[S. 61] Zum ersten Male trafen sich die künftigen Ordensbrüder auf Einladung von Overbeck und Pforr am 9. Juli 1808 in dem Atelier des Kupferstechers und Verwalters der
Akademiebibliothek Karl Egger. Er hat an den Zusammenkünften teilgenommen, aber sich nicht an den Übungen beteiligt, wurde auch nicht Mitglied. Bei dieser ersten Zusammenkunft wurde vereinbart,künftig einmal in der
Woche zusammenzukommen, um die gegenseitigen Arbeiten zu besprechen und freundschaftlich zu kritisieren sowie sich der Reihe nach Kompositionen aufzugeben. Als erstes Thema brachte Overbeck ´Jakobs Werbung um Rahel´
in Vorschlag. Im Jahre 1808 wurden folgende Themen behandelt: eine Szene aus Ifflands Jägern - Frau Madalis [Magdalis] von Bürger - Elia von einem Engel gespeist - Odysseus von den Phäaken zu Ithaka an Land gelegt -
Tod des Max Piccolomini.“
|
|
1972
|
Herrmann, Rudolf. Rudolf Hermanns zweiter Brief an Johannes Fichtner vom 31.10.1959 In: Bibel und Hermeneutik
“[S. 192] 8. Zunächst schon im Ganzen: Wie will man die als Ersatz für das Bisherige ins Auge gefaßten Wörter, die oft eine ganz andere Silbenzahl haben, ja bisweilen Umschreibungen sind (´Bausch des Gewandes´ anstatt ´Busen´!) in den Fluß und Gang der Lutherrede hineinbekommen - um jetzt nicht das in der Kommission anscheinend schon mißliebig gewordene Wort ´Rhythmus´ zu gebrauchen (zu entbehren wird es freilich auch nicht sein). Und gerade in kirchlichen Kreisen gewöhnt man sich leider sowie so gar zu leicht an rhythmische Sünden. So halte ich die Abänderung des wundervollen Chrysostomischen Bittgebetes durch ein 5 (oder 7?)-maliges ´Lasset uns zum Herrn beten...´, sowie die Hineinflickung von rebus omnibus et quibusdam aliis in den Text für eine rhythmische Untat.
(Nehmen Sie dies, - streng genommen - auch nicht Hierhergehörige bitte möglichst nicht für die Geschwätzigkeit des Alters.) Aber wenn eine min der Kirche nicht weniges immer fremder wird - Sie erhalten in
einiger Zeit ein Separatum von mir darüber -, so möchte man die Bibelrevision gern von irgendwie damit Verwandtem nicht ergriffen sehen. Und was ´den Busen´ anbetrifft, so wirkt er in Haydn's ´Jahreszeiten´ doch
nicht fremdartig, wo es im ´Spinnerlied´ (Winter) ja heißt:
´Drille Rädchen, lang und fein, drille fein ein Fädelein, mir zum Busenschleier...
Außen blank und innen rein, muß des Mädchens Busen sein, wohl deckt ihn den Schleier.´
Wie wollte man da den ´Bausch des Mädchengewandes´daraus machen?”
|
|
1973
|
Bichel, Ulf. Problem und Begriff der Umgangssprache in der germanistischen Forschung.
“[S. 68] Bürgers Verständnis der »neueren Schrift- und höheren Umgangssprache« als Sprache der Gebildeten Norddeutschlands
In den Belegen des »Deutschen Wörterbuchs« taucht das Kompositum ;;Umgangssprache« zum ersten Mal bei Bürger auf, und auch in meinen Unterlagen findet sich kein früherer Beleg [auch
Charles Reining 1912 führt dieses Wort nicht auf -K.D.]. Bürger gebraucht das neue Wort in dem Fragment »Hübnerus redivivus« (entstanden 1791, postum veröffentlicht 1797/98), einer Schrift, von der es im Untertitel
heißt: »Das ist: kurze Theorie der Reimkunst für Dilettanten«. In dem hier wesentlichen Abschnitt geht es um die Reinheit der Reime. Nach der Verteidigung der Reinheit einiger im Schriftbild nicht übereinstimmender
Reime fährt Bürger fort:
Ich bin geneigt,..´. auch reime, wie diese: Hals, Salz; Gans. Kranz; Tag, sprach; Pflug, Buch, - für richtig zu erklären, weil die
Verschiedenheit in der echt hochdeutschen Aussprache äußerst ... unmerklich ist ... [...] Das neue, in Ober-Sachsen
entstandene, von den obern Volks-Classen dieser und anderer sächsischer Provinzen und ihren classischen Schriftstellern
fortgebildete Deutsch herrschet nun einmal, und kein Elsasser, kein Schwabe, kein Baier, kein Österreicher wird es mehr
wegherrschen ... Alle vernünftigen und billigen Provinzialen sehen das auch sehr wohl ein, und fügen sich ohne Widerrede den
Hochdeutschen Sprachgesetzen, soweit sie ihnen nur immer bekannt sind. Nur der Pöbel übertritt sie aus grober Unwissenheit.
oder mit trotzigem Vorsatz.
Schon ein flüchtiger Vergleich der
Formulierungen läßt erkennen, daß Bürger sich weitgehend Adelungs Standpunkt in der Frage »Was ist Hochdeutsch?« zu eigen gemacht hat.
Gezwungen durch sein Thema, muß er jedoch noch weiter als Adelung in
das Gebiet der Lautlehre vordringen und auch Lauterscheinungen berücksichtigen, die nicht im Schriftbild erkennbar sind. Deshalb stellt er mit noch größerem Nachdruck als Adelung neben das Vorbild der neueren
Schriftsprache ein die rechte Lautung betreffendes Vorbild, das er »höhere Umgangssprache« nennt. Dabei ist aber »unsere neuere Schrift- und höhere Umgangssprache« eindeutig als einheitliche Sprachform verstanden.
Von ihr repräsentiert die »höhere Umgangssprache« im wesentlichen einen Aspekt, nämlich die Lautgestalt (vgl. Cordes). Nach modernen Begriffen muß man hier von einem in sich geschlossenen Sprachsystem sprechen, das
sich phonetisch und phonologisch beschreiben ließe. Man könnte nach dem bisher Gesagten fast versucht sein, »höhere Umgangssprache« dem modernen Begriff »Hochlautung« gleichzusetzen. Das wäre aber nicht richtig.
Auch »höhere Umgangssprache« meint das gesamte System. Es ist die Sprache, die die Gebildeten Norddeutschlands im Umgange miteinander sprechen. Daß der Begriff im wesentlichen für die Lautung steht, beruht darauf,
daß Bürger über Spracherscheinungen schreibt, die in der Schrift nur unvollkommen wiedergegeben werden können, so daß ihm eine Berufung auf die Schrift nicht mögiich ist. Dagegen sind diese Erscheinungen in der
Situation des Umganges zu beobachten, und deshalb verweist er auf die in dieser Situation zu hörende Sprache, auf die »Umgangssprache«.
Obgleich sich Bürger offensichtlich der Ausdrucksweise
Adelungs bedient, sind doch einige Unterschiede bemerkenswert: Er legt die gemeinte Sprachform nicht so genau geographisch fest. Wie Adelung gibt er zwar an, dies neue Deutsch sei in Ober-Sachsen entstanden; aber er
fügt hinzu, daß es auch »von den obern Volks-Classen ... anderer sächsicher Provinzen und ihren classischen Schriftstellern« fortgebildet worden sei. Entsprechend vermeidet er den von Adelung gern gebrauchten
Begriff »Hochdeutsche Mundart«. Außerdem ist der Hinweis auf die Funktion, in der die gemeinte Sprachform erscheint, nicht so genau wie bei Adelung, der angibt, daß es sich um die Sprache des gesellschaftlichen Umgangs handele. Diese gesellschaftliche Funktion schätzt Adelung immerhin als so wesentlich ein, daß sich bei ihm (und bei Wieland) gelegentlich das Kompositum »Gesellschafts-Sprache« einstellt. Bei Bürger tritt demgegenüber der Gedanke an eine im persönlichen mündlichen Verkehr stehende Gruppe als Träger der Sprachform zurück, Er scheint eher an so etwas wie eine Bildungsschicht zu denken. Und in dieser Hinsicht besteht in der Tat ein tiefgreifender Gegensatz zwischen der Auffassung Bürgers und der Adelungs, der in Bürgers Schrift »Über die deutsche Sprache. An Adelung« (1783) abgehandelt wird. Hier wendet sich Bürger heftig gegen die These, daß der wirtschaftliche Wohlstand Obersachsens dieser Landschaft einen besonderen Vorzug in sprachlichen Dingen geben könne, und vor allem gegen die Ansicht, daß »der Geschmack der obern Klassen die Sprache zur Schriftsprache mache«. Bürger fragt dagegen:
Und wodurch bekommen denn die oberen Classen ihren Geschmack? Wieder durch Niemand anders als durch die Gelehrten,
und zwar hauptsächlich durch die schreibenden Gelehrten.
Hinter
dieser Stellungnahme steht Bürgers Überzeugung von der Aufgabe des Dichters und der Dichtung. Er hat nämlich insbesondere die Dichter im Sinn, wenn er von »Gelehrten« spricht. und er denkt nicht an traditionelle
Schulgelehrsamkeit, sondern er hofft mit Klopstock, daß bald »der Natur Recht vor dem Schulrecht« herrsche. Die Dichtung aber soll sich nicht an eine besondere Klasse wenden. Bürger erklärt - u. a. ermutigt durch
die Lektüre Herders - daß er Volkspoesie »als die einzige wahre anerkenne« und sagt:
... so kann ich doch nicht aufhören, die Poesie für eine Kunst zu halten, die zwar von Gelehrten, aber nicht für Gelehrte als
solche, sondern für das Volk ausgeübt werden muß. In den Begriff des Volkes aber müssen nur diejenigen Merkmale
aufgenommen werden, worin ungefähr alle, oder doch die ansehnlichsten Classen überein kommen.
Den Ehrentitel eines Volksdichters wünscht Bürger selbst verdient zu haben durch sein
... Bestreben nach Klarheit, Bestimmtheit, Abrundung, Ordnung und Zusammenklang der Gedanken und Bilder; nach Wahrheit,
Natur und Einfalt der Empfindungen, nach dem eigenthümlischsten und treffendsten. nicht eben aus der todten Schrift-, sondern
mitten aus der lebendigsten Mundsprache aufgegriffenen Ausdrucke derselben. nach der pünktlichsten grammatischen
Richtigkeit, nach einem leichten, ungezwungenen, wohlklingenden Reim-und Versbau ...
Bei dieser Einstellung ist klar, daß Bürger keine GeseIlschaftssprache ins Auge fassen und nur in einem weiteren Sinn als Adelung den Gebrauch einer gehobenen Bevölkerungsklasse zum Maßstab für den rechten Reimgebrauch machen konnte. Im Grunde müßte er eine radikal andere Sprachprogrammatik entwickeln als die von Adelung vertretene. Gewisse Ansätze finden sich dazu im letzten Zitat. Aber der letzte Hinweis auf »die lebendigste Mundsprache« gibt doch nur wenig Anhalt. Letztenendes bleibt alles dem Urteil der Schriftsteller, genauer: eines gewissen Kreises dazu befähigter Schriftsteller, überlassen. Und auf diesen kaum recht faßbaren Kreis bezogen ist auch die Wortprägung »Umgangssprache«, als eine - verglichen mit »Gesellschaftssprache« -weniger genau festgelegte Bezeichnung für einen mündlichen Sprachgebrauch. Es ist bemerkenswert. daß die Wortprägung zuerst in einem derart wenig fest umrissenen Zusammenhang auftaucht.
[S. 337] Bei G. A. Bürger spielen in dem besprochenen Aufsatz über Reimkunst phonetische Fragen eine dominierende Rolle. Es ist bemerkenswert, daß in diesem Aufsatz, in dem zum ersten Mal das Wort
»Umgangssprache« erscheint, in Auseinandersetzung mit den Ausspracheregeln Adelungs auch erstmals die Termini »Achlaut« und »Ichlaut« geprägt werden.”
|
|
1973
|
Newald, Richard. Von Klopstock bis zu Goethes Tod. In: Geschichte der Deutschen Literatur, München. (Sammlung Helmut Scherer)
“[S. 214] Zwischen dem übertriebenen Lob, eine neue Kunst erahnt zu haben, und Schillers vernichtendem Urteil in der Allgemeinen Literaturzeitung (1791), zwischen Verherrlichung und
übler Nachrede, zwischen verstehendem Mitleid, dass seiner Haltlosigkeit gerecht zu werden sucht, und moralischer Entrüstung über sein Eheleben ist es schwer, ein Bild Bürgers zu entwerfen. das dem Menschen und
seinen Leistungen gerecht wird. Er wußte, daß er zu wenig Herr seiner Neigungen war, und war nicht imstande, sich von ihnen zu befreien. Er machte sein träges und weiches Temperament, seine Nachgiebigkeit für sein
Schicksal verantwortlich. Er glaubte zu wissen, daß manche seiner Tugenden aus Eigenliebe, Eitelkeit und Ruhmsucht kamen. Schiller sprach ihm das Recht ab, sich Volksdichter zu nennen, es fehle ihm der milde, sich
immer gleichende, immer helle männliche Geist, es fehle ihm die Kunst, zu idealisieren, Mag Schiller in den Werken Bürgers Gefahren wittern, die sein eigenes Schaffen bedrohten, oder den Weg erkennen, den er hätte
gehen können, wenn ihn Ideal und Ethos nicht seiner Sendung zugeführt hätten? War das ergebnislose Ringen Bürgers um festen Halt und moralische Maßstäbe das verhängnisvolle Erbe eines geistig wenig regsamen Vaters
und einer sinnlichen, boshaften Mutter? Solche Fragen sind kaum mit festen Aussagen zu beantworten.
[S. 216] Unter den Göttingern ist Bürger das männlichste lyrische Talent. Trotz leidenschaftlicher
Kraftentfaltung, forcierter Energie und dem Streben nach aufrüttelnder Wirkung fehlt ihm, wie schon A. W. Schlegel bemerkte. die ruhige sichere Kraft der Darstellung. Die ´fruchtbare Leichtigkeit´ des Schaffens war
ihm nicht gegeben. Mühe und ängstlicher Fleiß sind seine Gefährten. Man muß ihn aufsuchen, wo er müde und schwer in melancholischer Stimmung Anklagen gegen sich selbst erhebt, mit der auflodernden Leidenschaft ringt
und sich um ihre Rechtfertigung quält, wo er erkennt, daß ihm der Aufstieg zum Höchsten versagt ist. Da wo sich sein natürliches Erzählertalent entfaltet, mit einer Übersetzung [Münchhausen] , von der er sich wenig
Ruhm erwartete. hinterließ er die tiefste Spur seines Wirkens. “
|
|
1974
|
Berghahn, Klaus L. Volkstümlichkeit ohne Volk? Kritische Überlegungen zu einem Kulturkonzept Schillers. In: Popularität und Trivialität, Fourth Wisconsin Workshop. (Hg.) R.
Grimm, J. Hermand
“[S.52] Aber ohne eine entschiedene Parteinahme für die unteren Schichten dürfte es kaum erkennbar werden, wie sehr das einfache Volk im Literaturbetrieb der Jahrhunderte von einer
Elite bevormundet oder gar verachtet wurde und wie wenig volkstümlich die hohe Literatur im Grunde war. ´Die herrschende Ästhetik, der Buchpreis und die Polizei haben immer eine beträchtliche Distanz zwischen
Schriftsteller und Volk gelegt´, notierte Brecht, als er 1938 im Exil über Volkstümlichkeit meditierte. Nimmt man, wie Brecht und Sartre, die Bildungsinteressen der breiten Lesermassen ernst und fragt man sich, wie
diese in der Literaturtheorie berücksichtigt werden, so kommen einem Zweifel jedenfalls an jenem Volkstümlichkeitskonzept, das zur Zeit der deutschen Klassik formuliert wurde und noch heute Gültigkeit beansprucht.
[S.54] Indem die Klassiker nämlich gegen die Unterhaltungsliteratur und den Lesepöbel ästhetisch zu Felde zogen und aus der Diskriminierung ihre eigene Ästhetik entwickelten, die weitgehend am literarischen
Geschmack eines exklusiven Kreises orientiert war, verloren sie breiteste Leserschichten und damit die Möglichkeit, eine echt volkstümliche Kultur vorzubereiten.Eine solche These mag überraschen, gilt Schiller doch
als der ´Zeitgenosse aller Epochen´, der immer wieder als volkstümlich gerühmt wird. Hat er nicht selbst ein für allemal in der Bürgerrezension festgelegt, was volkstümliche Dichtung zu sein habe? Doch sei man
vorsichtig, sich gegen den naiven Bürger vorschnell auf die Seite Schillers zu schlagen, ohne recht zu wissen, für welch herablassende Volkstümlichkeit man sich da entscheidet.
[S.60] Damit sind wir bei der
zweiten Frage, die für Bürgers dichterisches Selbstverständnis entscheidend war: Für wen schreibt er? Sicher nicht für die Bildungselite oder die Paläste, sondern für die Hütten, für die unteren Schichten. Die
Kleinbürger, Handwerker und Bauern wollte er ins kulturelle Leben einbeziehen: ´Und diese [die Poesie] sollte nicht für das Volk, nur für wenige Pfefferkrämer sein? Ha! als ob nicht alle Menschen -Menschen wären.´
In diesem plebejisch demokratischen Ton polemisiert er auch gegen die Bildungsprivilegien der oberen Stände, die nicht deshalb einen besseren Geschmack haben, weil dieser ihnen angeboren, ´sondern weil die oberen
Klassen mehr Vermögen und Gelegenheit haben, ihre Söhne auf diese Stufe der Vollkommenheit [...] emporzuhelfen´. Um die Sprachbarriere zwischen dem gebildeten Poeten und dem einfachen Volk zu durchbrechen, empfiehlt
er den Dichtern, aus den Volksliedern zu lernen, wie das Volk ansprechbar sei. In diesem Zusammenhang enwähnt Bürger auch eine Reihe von Berufsgruppen, für die der Volksdichter schreibt: ´Bauern, Hirten, Jäger,
Bergleute, Handwerksburschen, Kesselführer, Hechelträger, Botsknechte, Fuhrleute.´ Von seiner Lenore hoffte er, daß sie in Spinnstuben gesungen werde. Diese Aufwertung der unteren Schichten und der Volkspoesie, die
durchaus als Kritik an der höfischen Kultur und der klassizistischen Gelehrtendichtung zu verstehen ist, hatte zur Folge, daß Bürger in seinem Streben nach Popularität den Geschmack des einfachen Volkes ernst nahm,
ja sich danach richtete. Volkstümliche Dichtung bedeutet für ihn nicht länger, sich herabzulassen als Gebildeter, um auch einmal ein Gedicht für das gemeine Volk zu schreiben; sie bedeutet für ihn vielmehr,
Lebensweise, Gefühle und Handeln der unteren Schidtten in sein Schaffen einzubeziehen. Damit erhält Bürgers Volkstümlichkeitskonzept eine soziale und politische Tendenz, die den rein literarischen Rahmen sprengt:
nämlich dem gemeinen Mann durch Volkspoesie ein Bewußtsein seines eigenen Wertes zu vermitteln. Daß Bürger dem einfachen Volk so viel einräumte, haben ihm viele seiner Kritiker seit Schiller und bis heute nicht
verziehen. Am abfälligsten urteilte wohl Gundolf über Bürger; er nannte ihn einen ´Plebejer con amore´.
[S.61] Während sich Bürger, wie wir sahen, den plebejischen Volksschichten verbunden fühlte und ihren
Standpunkt vertrat, ohne auf das gebildete Publikum gänzlich zu verzichten, versagt es sich Schiller, vom Standpunkt des Volkes für das Volk zu schreiben, denn so tief könne man Kunst und Talent nicht herabsetzen,
´um nach einem so gemeinen Ziele zu streben´. Schiller meint, der Dichter müsse sich von den Forderungen des Publikums frei machen und durch die Erhabenheit seiner Kunst das geteilte Publikum vereinigen: Wahre
Volkstümlichkeit bedeutet für ihn, ´dem ekeln Geschmack des Kenners Genüge zu leisten, ohne dadurch dem großen Haufen ungenießbar zu sein´.So kann man es natürlich formulieren, wenn auch die Priorität klar erkennbar
ist. Es dürfte keine Frage sein, was wem untergeordnet wird. Das wird im folgenden noch deutlicher. Schiller stimmt Bürgers Grundsatz, wonach die Popularität eines Gedichtes das Siegel der Vollkommenheit sei,
scheinbar zu, um ihn dann in seinem Sinne umzubiegen. Der Sophismus der Schillerschen Argumentation besteht nämlich darin, daß er Bürgers These als Enthymem interpretiert und zu einem Schluß kommt, dem Bürger
niemals zustimmen würde: Die Vollkommenheit eines Gedichtes ist ein absoluter innerer Wert. Bei der ästhetischen Beurteilung von Poesie spielt die Frage nach dem Publikum daher keine Rolle, sie ist ´durchaus
unabhängig von der verschiedenen Fassungskraft seiner Leser´. Erst wenn diese ´erste unerlaßliche Bedingung´ erfüllt ist, das Gedicht ´die Prüfung des echten Geschmacks´ bestanden hat und ´mit diesem Vorzug noch die
Klarheit und Faßlichkeit verbindet, die es fähig macht, im Munde des Volkes zu leben: dann ist ihm das Siegel der Vollkommenheit aufgedrückt´. Mit einem Wort: Kunst kommt vor Volkstümlichkeit. Schiller verteidigt im
Grunde das höchste Niveau der Kunst gegen den Geschmack breiter Publikumsschichten. Volkstümlichkeit wird damit lediglich eine Zugabe, ´ohne der Kunst etwas von ihrer Würde zu vergeben´. ´Grundsätze des Geschmacks´
wird Schiller niemals der Popularität opfern. Eher verzichtet er auf die Masse der Leser, als den Kenner zu verstimmen oder ´von den höchsten Foderungen der Kunst etwas´ nachzulassen. Damit wird zugleich die
gesellschaftlich-politische Bedeutung des Volkstümlichkeitskonzepts von Bürger aufgegeben. Die Kunst wird autonom. ´Die Ästhetik löst sich vom konkreten gesellschaftlichen Prozeß´, wie Hans Mayer es einmal
formulierte.
[S.63] Schillers Neuprägung und ästhetische Begründung des Begriffs setzte sich -Bürgers Antikritik zum Trotz -durch. Das hatte verhängnisvolle Folgen für die Entwicklung der Literatur wie der
Bildungspolitik; denn die Kluft zwischen Masse und Elite ließ sich auf diese Weise nicht überbrücken. Schon Mitte des vorigen Jahrhunderts rügte Robert Prutz vergeblich: ´So ist das traurigste Schicksal über die
deutsche Literatur gekommen: geschrieben zu werden von Literaten für Literaten. Die Massen haben wir preisgegeben: was Wunder, daß sie ihre Unterhaltung anderswo suchen.´ Überraschenderweise findet Schillers
Volkstümlichkeitskonzept noch heute gelehrte Verteidiger und hat daher fast kanonische GeItung.
[S.74] Auch Rezeptionsmythen müssen endlich einmal unzeitgemäß werden; und gegen überholte ästhetische
Bildungsideale richtete sich diese Kritik eigentlich. Wir haben uns solche Mühe gegeben, Schillers ästhetisches Erziehungsprogramm systemimmanent zu verstehen und seine Widersprüche historisch zu erklären, daß wir
am Ende doch der ´Einschüchterung durch Klassizität´ erlegen sind, vor der Brecht einmal warnte. Solange Schillers ästhetisches Volkstümlichkeitsideal noch Gültigkeit hat und die ästhetische Komponente im Verhältnis
zwischen Kunst und Gesellschaft den Vorrang vor der politischen behauptet, wird man kaum mehr als die berühmten fünf Prozent der Bevölkerung erreichen. Schillers kulturkritische Diagnosen und idealistische
Lösungsversuche mögen als historisch bedingte Antworten auf die Anfänge der modernen Massengesellschaft verständlich sein. Aber sein zeitbedingtes Kulturkonzept unserer Epoche als Muster aufzudrängen hieße doch
wohl, unsere Probleme auf geradezu klassische Weise verfehlen.” [Die hier fehlenden Anmerkungen finden sich im vollständigen Beitrag]
Berghahns ´Volkstümlichkeit ohne Volk?´
in der ONLINE-BIBLIOTHEK
|
|
1975
|
Münchow, Ursula (Hg.) Otto Krille [1878-1954], Unter dem Joch. Berlin.
“[S. XII] Heimliches, weil verbotenes Lesen war für den Militärzögling Rettung vor der geistestötenden Wirkung des Drills. Da er schon als Kind kleine Gedichte geschrieben hatte, findet
er am leichtesten den Weg zur Lyrik des 18. und 19. Jahrhunderts. Hinter Schränken verborgen, liest er Goethes Gedichte. Heine ist dem schwärmerischen Knaben zu unseriös, Ironie und Satire sind ihm noch fremd. Der
junge Schriftsteller findet später ein positiveres Verhältnis zu Heine. Der Schüler lernte lieber Gedichte Bürgers und Höltys auswendig.“
|
|
1976
|
Gille, Klaus F.. Schillers Rezension “Über Bürgers Gedichte” im Lichte der zeitgenössischen Bürger-Kritik. In: Wissen aus Erfahrungen. Werkbegriff und Interpretation heute.
[S. 174] In der bisherigen Forschung wird Schillers Aufsatz als Dokument des Aufbruchs zur deutschen Klassik und der Abrechnung mit dem abgedankten Sturm und Drang gesehen. Die
Erneuerung der Literatur, besonders der Lyrik, erscheint um 1790 als Notwendigkeit in dem von der Philosophie Kants' geprägten Zeitalter. Schiller sei der programmatische Wortführer dieses Anliegens, das seine
praktische Erfüllung in dem klassischen Jahrzehnt finde. So richtig diese Sicht von einer auf Schiller bzw. die deutsche Klassik fixierten Forschung her ist, so sehr muß eine wirkungsgeschichtliche
Betrachtungsweise, die die literarische Situation um 1790 anhand der Aufnahme von Bürgers Gedichten durch die Zeitgenossen erhellen will, auf die zeitgenössische Kritik überhaupt abheben, in deren Zusammenhang
Schillers Aufsatz bereits ein Spätling ist.
[S. 175] Schillers Kritik ist, unabhängig von der vorangegangenen öffentlichen Rezeption, Ausdruck einer ganz persönlichen Krise, die von einer Stokkung der
poetischen Produktion und von Querelen im Zusammenhang mit seiner Professur, seiner Verlobung und Heirat geprägt war. In diesem Zusammenhang bot die kritische Exekution eines sehr erfolgreichen poetischen
Werkes als »Auseinandersetzung mit einem bekannten, verbreitete Vorzüge und Schwächen repräsentierenden Gegner die beste Möglichkeit zur Selbstverständigung«.
[S. 178] Das rational fundierte Laienurteil,
das in der Frühaufklärung jedermann zugestanden wird, wird im weiteren Verlauf des Jahrhunderts auf das klassengebundene Kunstgefühl eingeengt. Illustriert wird diese Entwicklung etwa durch die Polemik des
Baumgarten-Schülers Georg Friedrich Meier (I746), der sich gegen das »Vorurteil« wendet, »ein ieder, der gesunden Verstand hat, müsse vermögend seyn ein Gedicht zu verstehen«. Bürger, einer der Exponenten der
plebejischen Unterströmung der Aufklärung, bewahrt dieses »Vorurteil«. Gegen ihn, der die Gemeinverständlichkeit zum leitenden Prinzip und Wertmaßstab der Dichtung erklärt, richtet sich schon in der Frühzeit seines
Auftretens der Literaturpapst Friedrich Nicolai.
[S. 180] Bei Schiller tritt neben die Kritik an Bürgers theoretischen Überlegungen zum Begriff des Volksdichters als weiterer Schwerpunkt die
Auseinandersetzung mit Bürgers poetischer Praxis. Schiller entwickelt ex negativo, d. h. aus einzelnen Gedichten Bürgers, den vieldeutigen Begriff der »Idealisirung«, der hinsichtlich des Stoffes die Aspekte der »
Veredelung«, der Auswahl und Zusammenfassung zum Zwecke der Typisierung, sowie der Asthetisierung (Verschönerung) enthält. Der Begriff begründet den artifiziellen Charakter des Kunstwerkes, der in der Stimmigkeit
der Einzelmerkmale SpracheIBild, Inhalt/Gedanke und Versifikation zum Ausdruck kommt, damit sich eine ´harmonische Wirkung des Ganzen« ergebe.
[S. 185] Dazu kam ein höchst aktueller philosophischer
Ausgangspunkt: Ein Novum von Schillers Kritik war, wie der junge Novalis in einem Brief an Schiller scharfsinnig erkannte, daß ´Sie darin, nicht, wie viele getan haben, von der Erfahrung mehrerer Jahrhunderte
abstrahierten, sondern ihn [sc. den Maßstab] a priori aus einem den Gesetzen der Sittlichkeit korrespondierenden Gesetze aufstellten«, mithin der Kantsche Ansatz, der Bürgers Parteigänger Friedrich Leopold von
Stolberg zu der gehässigen Bemerkung veranlaßte, der »anonyme Journalist« [Schiller] scheine »versificirende Kantianer auf dem Parnaß zu wünschen«. Größe und Abstraktheit des theoretischen Anspruchs waren insofern
problematisch, als er für Schillers Vergangenheit Selbstkritik bedeutete und für seine Zukunft Einlösung erforderlich machte. Mit Recht vermerkte Bürger: »Denn wie kann man so von Gott und sich selbst verlassen
werden, allen seinen eigenen sowohl gebornen als ungebornen Kindern Rattenpulver zu legen?«
[S. 186] Die normative Einschränkung des Dichters auf die Zielgruppe des gebildeten Bürgertums und dessen
Erwartungshorizont hat bei unserm Rezensenten die völlige Verkennung der Tatsache zur Folge, daß Bürgers Balladen (Romanzen) gerade nicht affirmativ gemeint sind, sondern die gesellschaftskritische Tendenz gerade
mit der Durchbrechung der bürgerlichen Ästhetik unterstützen wollen. Es kennzeichnet die Hilflosigkeit dieser Kritik, daß sie zeitkritische (»Frau Schnips«) oder gar jakobinische Balladen (»Geschichte des wilden
Jägers«, »Die Pfarrerstochter von Taubenhain«) nur unter ästhetischen Gesichtspunkten behandeln und ablehnen kann. Ein revolutionäres Gedicht wie »Der Bauer An seinen Durchlauchtigsten Tyrannen« bleibt völlig
unbeachtet.
[S. 187] Eine Kritik, die anhand des» Wilden Jägers« und der »Pfarrerstochter« lediglich Bürgers Verstoß gegen den Primat der Schönheit vor der Wahrheit zu rügen weiß, macht die problematische
DoppeIgesichtigkeit der von Schiller inaugurierten ästhetischen Erziehung sichtbar. Die »Sammlung aller progressiven Teile des Volkes um das Ideal der bürgerlichen Kulturnation« bedeutete eben auch eine Vertagung
des politischen Themas, wodurch die emanzipatorische Tendenzdichtung in den Bereich der Subkultur abgedrängt wurde.
[S. 189] Indem aber Schlegel Bürgers Dichtungen auf dem Hintergrund und nach dem Maßstab der
»wunderbaren Dichtungen alter Volkspoesie« des spanischen und englischen Mittelalters behandelt, verfehlt er die Einsetzung Bürgers in dessen eigenen historischen Kontext, die allein eine Korrektur des Schillerschen
Bildes ermöglicht hätte. Gegenüber den historischen Vorbildern wird Bürgers Behandlung seiner Stoffe als vergröbernd und häßlich disqualifiziert. Der Gehalt von Bürgers Balladen wird einem romantischen
Irrationalismus ausgesetzt, von dem aus die emanzipatorisch-aufklärerische Tendenz Bürgers, die Schlegel im Gegensatz zu Schiller sehr wohl erkennt, abgelehnt wird. So bemerkt Schlegel zur Gesellschaftskritik in der
»Pfarrerstochter«: »Des menschlichen Elendes haben wir leider zu viel in der Wirklichkeit, um in der Poesie noch damit behelligt zu werden.« Ausdrücklich wird der emanzipatorische Anspruch des Volksdichters
bestritten: »Unser Dasein ruhet auf dem Unbegreiflichen, und die Poesie, die aus dessen Tiefen hervorgeht, kann dieses nicht rein auflösen wollen.«
Die Problematik einer solchen zeitabgewandten Kunstkritik ist
für eine heutige Einschätzung Bürgers evident. Die Literaturgeschichten des 19. und 20. Jahrhunderts haben mit erstaunlicher Stereotypie die Urteile Schillers und August Wilhelm Schlegels konserviert, auch nachdem
sie die anfänglich noch genannten Gewährsmänner vergessen hatten. Bis weit in unser Jahrhundert hinein hat sich das Relikt von Schillers Charakterzeichnung Bürgers in den Formeln von »Sinnlichkeit«, »Leidenschaft«
und »sittlicher Schwäche« erhalten; man findet bei ihm den »trüben Naturalismus einer >volkstümlichen< Dichtung« ; wird die dichterische Leistung anerkannt, so bleibt die politisch-gesellschaftskritische Lyrik
ausgespart oder wird ästhetisierend abgewertet.
K. F. Gilles Schiller Rezension in der ONLINE-BIBLIOTHEK
|
|
1976
|
Koopmann, Helmut. Der Dichter als Kunstrichter. Zu Schillers Rezensionsstrategie. In: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft.
“[S. 242] Schiller selbst hat sich in aller Klarheit darüber ausgesprochen, was ihm an Bürgers Gedichten so maßlos mißfiel, nachdem er seitenlang an die »höchsten Forderungen der Kunst«
erinnert hatte. Über die von ihm proklamierten Kunstgesetze -die Forderung, daß der Künstler seine Individualität zu veredeln habe, bei »glücklicher Wahl des Stoffes und höchster Simplizität in Behandlung desselben«
-ist hinreichend genug geschrieben worden; sie interessieren hier auch nicht primär. Uns beschäftigt Schillers Strategie: und die ist eben die, die ihm die Rezensionstradition seit Bodmers Bemerkungen über den
Kritiker und sein schwieriges Geschäft vorschreibt. Es ist zugleich, nur ins Kolossale verschoben, die seiner frühen Rezensionen. Schiller verfährt übrigens auch innerhalb dieser Rezension im Kleinen so, wie er im
Ganzen vorgeht: einzelne Gedichte werden am jeweils noch einmal vorgestellten ästhetischen Gesetz gemessen.
[S. 243] Bürger verfaßte damals seine Antikritik, die von seiner Verwirrung ebenso zeugt wie von
seiner Überraschung. Er mochte nicht anerkennen, daß da neue »Geschmacksnormen« festgeregt worden waren, denen er sich so bedingungslos unterwerfen sollte. Aber SchiIler hat in seiner Verteidigung des Rezensenten noch einmal seine Kunstrichterrolle bekräftigt: »Herrn Bürgers Sache wäre es gewesen, die Anwendung der vom Rez. aufgestellten Grundsätze auf seine Gedichte, nicht aber diese Grundsätze selbst zu bestreiten, die er im Ernst nicht wohl leugnen, nicht mißverstehen kann, ohne seine Begriffe von der Kunst verdächtig zu machen«. Das ist eine nur zu deutliche Bestätigung seiner Rezensionsstrategie, der die »Grundsätze« über alles gehen und der die poetische Individualität und Eigengesetzlichkeit nichts bedeutet.
Schiller ruft Maßstäbe in Erinnerung, um an diesen dann das lyrische Werk Bürgers zu prüfen. Wir haben es fast überdeutlich mit dem im 18. Jahrhundert dominanten Typus der normierenden Rezension zu tun: hier
manifestiert sich noch einmal das Grundsatzdenken des Jahrhunderts, und damit ist Schillers Bürger-Rezension eine einzigartige Verteidigung ästhetischer Gesetzlichkeiten an sich. Es muß dem Künstler darum gehen,
»das Individuelle und Lokale zum Allgemeinen zu erheben«, Das wirkt fast wie eine Umkehr des Lessingschen Satzes aus den Abhandlungen über die Fabel, daß das Allgemeine nur im Besonderen existiere und nur im
Besondem anschauend erkannt werden könne.
[S.245] Bürger verstand das alles nicht; er begriff nicht, wieso er Gesetzen genügen sollte, die ein anderer ersonnen hatte, und warum er nach ästhetischen
Grundsätzen verurteilt wurde, die er nicht gekannt hatte. Doch aus seiner Antikritik spricht, nachträglich besehen, nicht nur der konfus gewordene Volksdichter, dem plötzlich verleidet werden sollte, was viele an
ihm gerühmt hatten. Er verspottet das »höhere Genie«, das sich hier ein Kunstrichtertum angemaßt hatte, wozu es in Bürgers Augen nicht legitimiert war. Und er schrieb: »Wäre nun mein Beurteiler kein höheres, sondern
ein Kunstgenie bloß meinesgleichen, so würden unsere einander entgegenstehenden Autoritäten, wie zwei gleiche unabhängige Kräfte sich wenigstens die Wage halten, und sein Geschmack müßte von dem meinigen, wie ein
Souverain von dem andern, wo nicht mit schüchterner, doch mit bescheidener Achtung sprechen.« Es war eine etwas simple Verteidigungsstrategie, die Bürger da einschlug aber sie scheint über die von ihm aus so
gesehene persönliche Fehde doch ein neues Zeitalter in den Beziehungen des Kritikers zu seinem Gegenstand einzuläuten. Denn was Bürger, wenn auch nur andeutungsweise, vertritt, ist die Idee von der
Eigengesetzlichkeit der jeweiligen Kunstmaximen und die These, daß jeder nach seinen eigenen Werten beurteilt zu werden verdiene. Für Bürger liegen die ästhetischen Maßstäbe nicht in einer allgemeinen
Gesetzlichkeit, sondern im jeweiligen Literaturwerk selbst. Es ist nichts Geringeres als die Auflösung der Ästhetik des 18. Jahrhunderts, die sich hier ankündigt, der Einzug neuer Wertungskriterien, die Ahnung
dessen, daß die Zeit allgemeiner Kunstregeln und einer fraglosen Kunstrichterei vorbei sei. Mit Schillers Bürger-Rezension endigt eigentlich schon die Ära einer Kritik nach unbezweifelbaren Grundsätzen und den
»Grundbegriffen des Vollkommnen und Schönen«, Und die Epoche, in der literarische Wertung zum Problem werden sollte, beginnt.”
Koopmanns Dichter als Kunstrichter in der ONLINE-BIBLIOTHEK
|
|
1976
|
Brentano, Clemens. Brief an Steinle (15. März bis 10. April 1842). Palmsonntag. In: Dieter Dennerle. Kunst als Kommunikationsprozess - Zur Kunsttheorie Clemens Brentanos. Frankfurt/M.
“ [S. 172] Ich habe heute die Kritick von Overbecks Bild [Der Triumph der Religion in den Künsten] erhalten und gelesen. Ich hatte nicht daran gedacht, daß die Frankfurter welche so
große Modisten sind, in der Literatur so modest ein Jahr mit dem Journalkurs zurück sein könnten, so daß, wenn diese Blätter über ein Jahr an Leser und Leserinnen, an den Junker von Falkenstein kommen, um der
Pfarrerstochter von Taubenheim in der Bohnenlaube vorgelesen und illustriert zu werden, diese vielleicht bereits durch Zahnweh und Ekel am Zuhören gehindert, oder [...].“
|
|
1976
|
Hoffmann, Dieter. Gottfried August Bürger. In: Sub Rosa. Historische Portraits. Das Neueste Gedicht, Darmstadt
"Gottfried August Bürger
Welch ein Name: Bürger
in einer feudalistischen Zeit.
Wie gebrandmarkt, wie stolz!
Er scheiterte immer.
An der Arbeit, der Liebe.
Dorette und Molly
starben kurz nacheinander,
von seiner dritten Frau
ließ er sich scheiden.
Als Barde im Wolfsfell
war er gefürchtet,
im Göttinger Hain, von den Bauern.
Gutspächter schließlich,
der Schreibtisch
inmitten der Stimmen von Tieren
ekelte ihn.
Gedichte behielt er im Kopf.
Als er selber gestorben war,
schaute Lichtenberg zu
beim Begräbnis
durch das Fernrohr von weitem,
voll Trauer,
Distanz, Neugierde, Wissendurst."
|
|
1977
|
Kluge, Gerhard. Gottfried August Bürger. In: Deutsche Dichter des 18. Jahrhunderts: ihr Leben u. Werk.
“[S.595] 2. Bürger der Dichter der Lenore und einiger Balladen, die Schiller durch sein Schweigen über sie noch eher tolerierte als die Nachwelt; über die restlichen seit 1773 in kaum
zwei Jahrzehnten entstandenen Werke hat die Literaturgeschichte das Urteil Schillers übernommen, ohne es neu zu überdenken. Schillers Einwand betrifft, wie man weiß, die mangelnde Klassizität der Form der Gedichte
Bürgers, d.h. der ästhetischen Darstellung der ihr zugrunde liegenden Empfindungen. Er wendet sich gegen eine Sprache der Distanzlosigkeit, des erregten Ausdrucks. Die Ausdruckskraft gefährde den Kunstcharakter, und
mehr als dieses “Todesmal der Bürgerschen Poesie” nehmen auch die späteren Interpreten nicht wahr. Seine Lyrik drohe “sich aufzuheben in einer Form, die keine Form mehr ist. Bürgers Lyrik gibt sich öfters dem
Ungestalteten und Chaotischen anheim”. Daß Bürger, gemessen am klassizistischen Formbegriff formlos erscheinen muß, ist logisch; einen so formbewußten Künstler wie Bürger der Formlosigkeit schlechthin zu zeihen,
geht gleichwohl nicht an.
3. Bürger sah sich als Volksdichter, und als solcher gilt er, ohne daß man dieses als Auszeichnung zu verstehen gewillt wäre, merkwürdigerweise trotz Schillers Versuch, ihm auch den Rang eines “Volkssängers” streitig zu machen. Obwohl Bürgers Verständnis von Volkstümlichkeit, eine allen Klassen und Ständen verständliche Darstellung, “wenn nicht Allen, dennoch den Meisten “ zu gefallen, immer wieder und nicht zu Unrecht wegen ihrer zu dürftigen und anspruchslosen Programmatik angegriffen worden ist, beschränkt sich in West und Ost, wo man inzwischen das Volkstümliche in Bürgers Lyrik auf plebejische Traditionen im 18. Jahrhundert bezieht, sein Ansehen auf die Schöpfung der volkstümlichen deutschen Ballade und nationaler Volksdichtung überhaupt - so ausschließlich, daß wir inzwischen zwar eine Reihe gut versorgter Gedichtausgaben haben, aber noch keine historisch-kritische Gesamtausgabe seines Werkes, die bei einem Dichter höchst notwendig wäre, der bis zur letzten Ausgabe seiner Gedichte selbst an den ältesten noch feilte. Der Übersetzer, der Erzähler wird kaum beachtet, seine Arbeiten zur Rechtschreibe- und Sprachreform sind überhaupt vergessen worden.[für die vielen, hier nicht aufgeführten, Anmerkungen siehe die Originalarbeit]”
|
|
1977
|
Conrady, Karl Otto. Vorwort. In: Deutsche Literatur zur Zeit der Klassik.
“[S. 10] Zu den anderen Kennmarken Schillerscher Überlegungen, die in diesen Zusammenhang gehören, zählen »Idealisierung«, »Veredlung«. Die
Bürger-Kritik, Ende 1790 fertiggestellt, postuliert: »Eine der ersten Erfodernisse des Dichters ist Idealisierung, Veredlung, ohne welche er aufhört, seinen Namen zu verdienen.« Später revidiert Schiller den Begriff
»Veredlung«: »Etwas idealisieren heißt mir nur, es aller seiner zufälligen Bestimmungen entkleiden und ihm den Charakter innerer Notwendigkeit beilegen. Das Wort veredeln erinnert immer an verbessern, an eine
moralische Erhebung.« Man sollte sich über die Schwierigkeiten im klaren sein, die solche Begriffe und ihre Erläuterungen bieten. Denn sie bedürfen selbst wieder der Interpretation und sind allenfalls an poetischen
Werken selbst zu verifizieren, was aber nur die Schwierigkeit verschiebt, weil der Sinn eines Werkes auch seinerseits auslegungsbedürftig und auslegungsfähig ist. Über den »Charakter innerer Notwendigkeit« und seine
poetische Gestaltung läßt sich offenkundig streiten. So unrecht hatte der von Schillers theoretischen Ansprüchen arg gezauste Gottfried August Bürger nicht, als er in seiner Antikritik von 1791 anmerkte: »Besonders
wünschte ich dem Begriffe einer idealisierten Empfindung, diesem mirabili dictu, nur eine einzige interessante Anschauung aus irgendeinem alten oder neuen, einheimischen oder fremden Dichter, der das mirabile so
recht getroffen hätte, untergelegt zu sehen.«
Im Fortgang unserer fragmentarischen Anmerkungen verdient hervorgehoben zu werden, daß »Idealisierung« jedenfalls nicht in der vorhandenen
Realität sich vollziehen kann. Dieser Zwiespalt zwischen Ideal und Wirklichkeit, entschieden gefördert durch die Anschauung der griechischen Kunst, bleibt für Schiller bestimmend.
[S. 12] Schiller hat in der
Rezension von Bürgers Gedichten in die damals schon seit längerem laufende Diskussion um »Popularität« und um die Vorstellung des» Volksdichters« eingegriffen. Sein Ziel ist deutlich: ein wahrer Volksdichter habe
´in jedem einzelnen Liede jeder Volksklasse genug zu tun«. Damit ist kein Zugeständnis an einen Publikumsgeschmack gemeint, dem er einmal im Fortsetzungsroman Der Geisterseher entgegengekommen war, und auch
nicht eine Rücksichtnahme auf das »immer allgemeiner werdende Bedürfnis zu lesen, auch bei denjenigen Volksklassen, zu deren Geistesbildung von seiten des Staates so wenig zu geschehen pflegt« (Vorrede zu den Merkwürdigen Rechtsfällen ). Aber es wird schwierig, wenn Kenner und (des Lesens überhaupt kundige) Masse zufriedengestellt werden sollen. Es hat gewiß wenig Sinn, die Standpunkte Bürgers und Schillers gegeneinander auszuspielen. Grundsätzlich unterschiedliche Auffassungen über die Funktion und die daraus resultierende Art von Dichtung sind im Spiel. Bürger richtet sich, unbeschadet seiner nicht widerspruchsfreien und sich wandelnden Vorstellung vom»Volk«, an untere Schichten als an die Adressaten, auf die es ihm zuvörderst ankommt. Das schließt nicht aus, daß er »sowohl in Palästen als Hütten« gelesen werden möchte. Auch Schiller erkennt an: »Welch Unternehmen, dem ekeln Geschmack des Kenners Genüge zu leisten, ohne dadurch dem großen Haufen ungenießbar zu sein«; doch wenn er fortfährt: »ohne der Kunst etwas von ihrer Würde zu vergeben, sich an den Kinderverstand des Volks anzuschmiegen«, dann ist der Vorrang der Ansprüche der Kunst nicht zu verkennen. In leichter Zuspitzung darf durchaus gefolgert werden: »Kunst kommt vor Volkstümlichkeit. Schiller verteidigt im Grunde das höchste Niveau der Kunst gegen den Geschmack breiter Publikumsschichten.« Das ist innere Konsequenz der Schillerschen Kunstauffassung. Denn was Kunst leisten soll: daß »sich jede Schönheit doch endlich in allgemeine Wahrheit auflösen läßt«, kann sie nur, wenn von diesem hohen theoretischen Anspruch nichts Gewichtiges abgezogen wird.”
|
|
1977
|
Borges, Jorge Luis. G. A. Bürger. In: Obra Poética, Buenos Aires
|
[S. 502] G.A. BÜRGER
No acabo de entender
por qué me afectan de este modo las cosas
que le sucedieron a Bürger
(sos dos fechas están en la enciclopedia)
en una de las ciudades de la llanura,
junto al rio que tiene una sola margen
en la que crece la palmera, no el pino.
Al igual de·todos los hombres,
dijo y oyó mentiras,
fue traicionado y fue traidor,
agonizó de amor muchas veces
y, tras la noche del insomnio.
vio los cristales grises del alba,
pero mereció la gran voz de Shakespeare
(en la que están las otras)
y la de Angelus Silesius de Breslau
y con falso descuido limó algún verso,
en el estilo de su época.
Sabia que el presente no es otra cosa
que una particula fugaz del pasado
y que estamos hechos de olvido:
sabiduria tan inútil
corno los corolarios de Spinoza
o las magias del miedo.
En la ciudad junto al rio inmóvil,
unos dos mil anos después de la muerte de un dios
(la historia que refiero es antigua),
Bürger está solo y ahora,
precisamente ahora, lima unos versos.
|
Ich höre nicht auf zu verstehen,
warum mich auf diese Weise die Dinge berühren,
die Bürger geschahen
(seine beiden Lebensdaten stehen im Lexikon)
In einer der Städte in der Ebene,
an einem Fluß gelegen, der nur ein Ufer hat,
an dem die Palme wächst, nicht die Pinie.
Ebenso wie alle Menschen,
log er und wurde belogen
wurde er verraten und war Verräter,
lag oftmals aus Liebe im Sterben,
und nach der schlaflosen Nacht,
sah er die grauen Kristalle der Morgenröte,
aber er zeichnet sich durch die Wortgewalt Shakespeares aus
(in der die anderen sich befinden)
und der von Angelus Silenius von Breslau
und mit oberflächlicher Nachlässigkeit
feilte er manche Verse
im Stil seiner Epoche.
Er wusste, dass die Gegenwart nichts anderes ist
als ein flüchtiges Teilchen der Vergangenheit
und dass wir zum Vergessen gemacht sind:
dass das Wissen so unnütz ist
wie die Korollarien Spinozas
oder die Zauberkräfte der Angst.
In der Stadt am unbeweglichen Fluss,
ungefähr zweitausend Jahre nach dem Tod eines Gottes
(die Geschichte, die ich erzähle ist alt)
Ist Bürger einzig und jetzt,
genau jetzt, feilt er einige Verse.
|
|
Für den Hinweis auf dieses Gedicht und die Übersetzung danke ich Frau Dr. Barbara Beetz (Aseleben) ganz herzlich. Zur Erläuterung fügte sie hinzu:
´Man sollte vielleich zum Verständnis des Textes und als eine Antwort auf die Frage, warum sich Borges mit Bürger beschäftigt, hinzufügen, dass er
eine Wortverwandtschaft seines und des Namens Bürgers sah und sich in dem Gedicht vielleicht auch mit ihm identifiziert. So könnte der Fluss mit
nur einem Ufer der Rio de la Plata in Buenos - Aires sein, an dem Borges viele Jahre seines Lebens gelebt hat. Das Gedicht ist dort entstanden. Auch
der Schluss des Gedichts weist darauf hin.´ K. Damert, 12.05.2013
|
|
1978
|
Köpf, Gerhard. Friedrich Schiller: “Über Bürgers Gedichte”. Historizität als Norm einer Theorie des Lesers. In: Jahrbuch des Wiener Goethe-Vereins 1977/1978/1979
“[S.271]Schiller formuliert seinen Vorwurf der Distanzlosigkeit gegenüber G. A. Bürger in der Kategorie der Sinnlichkeit, mit der er Bürgers Poesie behaftet sieht. Dadurch nämlich
dominiert das Individuelle gegenüber dem Allgemeinmenschlichen, das die ´Gattung Mensch´ bezeichne. Bürger ist aufgrund seiner eigenen Persönlichkeit außerstande, als Repräsentant der ´Gattung Mensch´ zu schreiben.
Damit verfehlt er Schillers Forderung von Literatur für Leser. Argument ist Schiller dabei eine künstIerische Fehlhaltung, deren Folgen eine adäquate Wirkung und Rezeption verstellt.
[S. 271] Schiller sieht
Bürger vor allem hinsichtlich der Balladendichtung auf seiner Seite. Das ´längst entschiedne einstimmige Urteil des Publikums´ wird deshalb akzeptiert, da es sich nicht auf ein spezifisches Publikum, sondern auf die
Gesamtheit der Leser bezieht. Diese Gesamtheit akzeptiert Schiller und lobt daher Bürgers Balladendichtung. In diesem Falle erscheint die immer wieder im theoretischen Entwurf geforderte Vereinigung von Auswahl und
Masse perfekt. Schiller selbst hat dieses Ziel jeweils nur bedingt erreicht. Der Konflikt seiner Aporie besteht darin, daß einerseits das lesende Publikum zwar in seiner Gesamtheit erfaßt werden soll, andererseits
aber von den höchsten Forderungen an die Literatur ungeachtet des jeweiligen Vermögens der Leser keine Abstriche gemacht werden dürfen.
[S.272] Zusammenfassend läßt sich festhalten : In seiner
poetologisch-theoretischen Konzeption rückt Schiller vom Verlangen des lesenden Publikums in seiner Mehrheit ab. Aus Gründen der Zeitkritik wird ihm das wahre Bedürfnis des gesamten Publikums relevant. Die Wünsche
der breiten Leserschaft werden in ihren Abhängigkeitsfunktionen erkannt und als solche abgelehnt. Anpassung an diese (breite) Leserschicht setzt Schiller gleich mit Stabilisierung und Reproduktion jener
Verhältnisse, die sein Bewußtsein von Geschichtlichkeit für änderungsbedürftig erklärt. Schillers gesellschaftspolitischer, pädagogischer und emanzipatorischer Anspruch liegt gerade in der Nonkonformität und
Verweigerung der Anpassung begründet. Eben weil Schiller der Literatur die große Aufgabe zuweist, durch ihre erzieherische Wirkung das Publikum zu einen, zu humanem Zusammenleben und zur Totalität literarischer
Kompetenz zu führen, muß sie für ihn Forderungen erfüllen, die den gegenwärtigen Wünschen einer lesenden Mehrheit zuwiderlaufen.”
|
|
1978
|
Fritz, Marianne. Eine befremdliche Entdeckung. In: Erzähler des S. Fischer Verlages 1886-1978
“[S. 84] ´Es tut alles so weh und es ist so dunkel.´
´Diese heilsame Nacht haben Hände für deine Augen geschaffen; es ist nur jene Dunkelheit, die deine Augen schützt. Der Schmerz, den du spürst, das ist nur eine Erregung, die du vergessen wirst, als hättest du
sie nie gekannt. Ich hin deine Muschelschale. Du mußt deinem Atem nicht nachlauschen. Du bist eine Muschel. Eine Muschel hat sowas nicht nötig. Sag: Wie heißt du? Ich will ehrlich sein: Ich habe deinen Namen schon
erfragt. Du bist Lenore. Man hat mir auch genau erklärt, wie du aussiehst. Schläfst du schon?´
´Nein. Ich bin noch wach und warte.´
´Nein. Nein. Kümmere dich nicht um deine Augen und was mit ihnen werden
wird. Dein Augenlicht wird dir wiedergegeben. Das weiß ich. Komm, Lenore. Deine Muschelschale wird sich jetzt unmerklich öffnen, damit mein Freund, Gottfried August Bürger, zu dir schlüpfen kann. Er ist ein wenig
geschwätzig, das geb ich zu, aber er liebt Muscheln. Siehst du: Er ist schon da, und sein Kommen hat dich nicht einmal erschüttert. Du kannst ihm zuhören, wenn du magst. Er wird von Lenore schwätzen. Hab' Nachsicht
mit ihm, meine Muschel. Er ist so dankbar, wenn er jemand findet, der ihn hören mag. Dann wird er munter hopp hopp hopp!
Lenore fuhr ums Morgenrot
Empor aus schweren Träumen:
´Bist untreu, Wilhelm, oder tot´?
Wie lange willst du säumen?´ -
Er war mit König Friedrichs Macht
Gezogen in die Prager Schlacht
Und er hatte nicht geschrieben,
Ob er gesund geblieben.
Als ich wieder erwachte, erzählte mir Helga, daß ich im Laufe der vierzehnten Strophe eingeschlafen sei, in der Wilhelm seine Heimkehr ankündigte:
´Holla, holla! Tu auf, mein Kind!
Schläfst, Liebchen, oder wachst du?
Wie bist noch gegen mich gesinnt?
Und weinest oder lachst du?´ -
Die Hände
des Chirurgen hatten mir keine Glasaugen einsetzen müssen, vielmehr gaben sie mir mein Augenlicht wieder und mit Hilfe der Optik sind meine Augen wirklich wieder ganz mein geworden.”
|
|
1979
|
Autorenkollektiv. Patriotisch-politische Lyrik. Der “Göttinger Hain” und sein Umkreis. Bürger. In: Geschichte der Deutschen Literatur. Sechster Band.
"[S. 594] Doch Bürgers Verarbeitung der verschiedenen Vorbilder übertraf die Bemühungen der ´Hain´-Mitglieder an Kraft und Originalität bei weitem. In einigen prinzipiellen Fragen
bezog Bürger zudem Standpunkte, die engere Beziehungen zum ´Hain´ ausschlossen: Er teilte weder den Haß auf alles Französische und die sich damit rechtfertigende Feindschaft gegen Wieland noch die enge
christlich-religiöse Bindung und den entsprechenden Tugendkult. Er hatte die Miserabilität der deutschen Wirklichkeit so sehr zu spüren bekommen - unter den Hain-Bündlern hatte allein Voß Ähnliches hinter sich -,
daß er vor jeglicher Idyllisierung der Auseinandersetzungen zwischen dem Feudaladel und den Bauern bewahrt blieb. Schwärmerei und Philisterturn entsprachen seiner sinnlich-robusten, lebenshungrigen Natur, die ihn
Lust und Leid mit außerordentlicher Intensität empfinden ließ, zudem ohnehin nicht. So gewann Bürgers Lyrik nach spielerischen Versuchen aus der Studentenzeit (bereits die ersten Trinklieder kündigten die erwachende
Begabung an) bald eine realistische Kraft und Selbständigkeit, wie sie in dieser Zeit außer ihm nur Goethe erreichte.
[S. 595] Die trostlose Trauer Lenores über das Schicksal ihres Bräutigams mündet in
verzweifelte Auflehnung gegen die herrschende ´Ordnung´, als deren Schöpfer und Erhalter ein unbarmherziger Gott angeklagt wird. In diesem spontanen Aufbegehren und in dieser Anklage konnten das Bürgertum wie auch
die unteren Schichten ihre Bedrängnis und ihre Freiheitssehnsucht so überzeugend poetisch ausgesprochen finden wie in wenigen anderen Dichtungen der Zeit. Bürger verband Elemente des balladesken Stils (besonders die
Dialogisierung) mit der drastischen Rhetorik des Bänkelsangs, ohne dessen ironisch-distanzierende Haltung zu übernehmen. Die reichen sprachlichen Mittel ermöglichten eine nuancierte und dramatisch bewegte Vers-und
Strophenführung. Vor allem mit Hilfe der Lautmalerei schuf Bürger belebte Naturbilder, die die deutsche Lyrik lange Zeit beeinflußten.
[S. 596] Die Verbindung von Sagenstoff und aktueller Gesellschaftskritik
kennzeichnet auch Bürgers Balladen ´Der Raubgraf´ (1773) und ´Der wilde Jäger´ (1773/1781). Eine der ´Lenore´ vergleichbare dramatische Dichte und sprachliche Eindringlichkeit erreichte Bürger noch einmal in ´Des
Pfarrers Tochter von Taubenhain´ (1781), indem er das aktuelle Thema des Kindesmordes, das er ursprünglich für eine Tragödie bestimmt hatte, mit äußerster Schärfe als ein Ergebnis des bürgerlich-feudalen
Klassenkonfliktes gestaltete; auch die heuchlerische Frömmigkeit und Sittenstrenge bestimmter bürgerlicher Schichten wurde dabei nicht geschont. [...] Aus der Zeit seiner besten Balladen stammt das deutlichste und
angriffslustigste Gedicht dieser Gruppe: ´Der Bauer an seinen durchlauchtigen Tyrannen´ (1773). Mit dem kompromiß-und iIlusionslosen, rebellischen Gehalt dieser Strophen - vorgetragen in knappen Frage-und
Anklagesätzen, auf jeden ablenkenden oder versöhnenden Schmuck verzichtend - übertraf Bürger alle bäuerlichen Rollengedichte der Zeit, von den mehr idyllisierenden ´Hain´-Arbeiten bis hin zu Goethes
fürstenerzieherischem ´Sebastian Simpel´. Bürgers Gedicht endet mit der unwiderruflichen Absage an die feudalabsolutistische ´Obrigkeit´ und ihr angemaßtes Gottesgnadentum.
[S. 597] In dem programmatischen
Gedicht ´Die Elemente´ (1776) suchte Bürger (ähnlich wie schon im ´Danklied´ von 1772) einen göttlichen Welteros poetisch zu definieren; unorthodoxe christliche Religiosität, von der sich Bürger niemals ganz löste,
materialistische Gedankengänge in Anlehnung an antike Quellen und pantheistische Vorstellungen gingen dabei eine widerspruchsvolle, für Bürgers weltanschauliches Ringen typische Verbindung ein.
Wo er
auf philosophische Ausweitung verzichtete, erreichte Bürger in seinen Liebesgedichten volksliedhafte Schlichtheit, Innigkeit und Lebenswahrheit (´Schön Suschen´, 1776), Um 1780 traten immer stärker die Konflikte
seines Lebens zwischen zwei Frauen in den Vordergrund seiner Lyrik; auch dies gehörte zu den Folgen des objektiven Eingeschlossenseins in einen engen, nicht zu sprengenden Lebenskreis. Die Wirkung jener späteren
Gedichte (´An die Menschengesichter´, 1778; ´Überall Molly und Liebe´, 1789; ´Für sie, mein eins und alles´, 1789; Sonette) beruht vor allem auf der erschütternden Aufrichtigkeit des Dichters.
[S. 598]
Gemeinsam mit Lichtenberg, der ihm in Göttingen zeitweise am nächsten stand, fügte Bürger in die Lügengeschichten des anonym erschienenen englischen Buches zahlreiche aktuelle Anspielungen ein und erfand neue
Abenteuer hinzu (darunter den Ritt auf der Kanonenkugel und die Rettung aus dem Sumpf am eigenen Zopf). Vor allem verstärkte er die satirische Tendenz des Stoffes, indem er sie gegen den zeitgenössischen Adel
richtete. Erst durch Bürgers Übertragung erhielt der ´Münchhausen´ zudem die wirkungsvolle sprachliche Durchformung, die ihn zu einem bedeutenden Volksbuch machte.
[S. 599] Die poetischen Zeugnisse seiner
Revolutionsbegeisterung, vor allem seiner entschiedenen Bejahung auch derjenigen revolutionären Maßnahmen, die die meisten deutschen Zeitgenossen in die Enge ihrer Kompromiß- und Reformbestrebungen zurücktrieben,
besitzen wir in einer Reihe von Dichtungen, die Bürger im ´Musenalmanach auf das Jahr 1793´ veröffentlichte (´Unmut´, ´Die Tode´, ´Das Magnetengebirge´'). Die Zensur verbot Bürger daraufhin jede weitere
Veröffentlichung zu diesem Thema. Bürger quittierte das Verbot im ´Musenalmanach´ für 1794 mit den ironischen Versen ´Entsagung der Politik´.
[S. 600] Die deutschen Verhältnisse, die ihn auf einen engen
Erfahrungsbereich einschränkten und zugleich die Vervollkommnung seiner Bildung verhinderten, waren das stärkste Hemmnis für eine umfassendere Entfaltung der Bürgerschen Begabung. Hinzu kam eine Undiszipliniertheit,
die sich in manchen seiner Gedichte als Weitschweifigkeit und sprachliche Kraftmeierei äußerte. Bürger war sich dieser Mängel weitgehend bewußt und arbeitete an ihrer Korrektur. Um so härter traf ihn die
erbarmungslose Rezension seiner Gedichte, die SCHILLER 1791 anläßlich der zweiten Sammlung veröffentlichte.
[S. 601] In erster Linie auf die programmatische Verkündung eines Prinzips der klassischen deutschen
Ästhetik bedacht, verknüpfte Schiller seine berechtigte ästhetische Kritik mit Urteilen über die ´Individualität´ Bürgers, die dem Dichter nicht gerecht wurden - weder seinem persönlichen Schicksal und der
demokratisch-plebejischen Tendenz seines Schaffens noch seinem Streben nach unmittelbaren Wirkungen. [...] Schillers Verdikt beeinflußte das Urteil der Nachwelt über Bürgers Werk nachhaltig. Dabei wurde oft
übersehen, daß die Rezension einerseits, Bürgers Gedichte andererseits verschiedenen Stadien der literarischen Entwicklung verpflichtet waren.”
Der Beitrag “Bürger” in der ONLINE-BIBLIOTHEK.
|
|
1980
|
Mecklenburg, Norbert. Balladen der Klassik. In: Balladenforschung. Königstein/Ts.
“[S. 187] Das archaische Moment, das der Gattung Kunstballade von Anbeginn, mit ihrer literarischen Zeitgemäßheit eigentümlich identisch, anhaftete, blieb auch auf der neuen Stufe, die
sie in dem Jahrzehnt um 1800 erreichte, bestehen. Goethe hielt am mythologischen Motiv, das er nun zu ,humanisieren' suchte, fest. Schiller vertrieb, die Gattung gegenüber Bürger philosophisch ,reinigend', aus ihr
zugleich die zeitgenössischen Stoffe. Mit dem Zeitalter schritt die Ballade, darin ganz Ausdruck der ,deutschen Klassik', auch gegen das Zeitalter fort.
[S. 188] Dieses in die Abrechnung mit Bürger
gekleidete Programm [Schillers Rezension] schien sich nun gerade in den Balladen Schillers durch gelungene praktische Umsetzung zu bestätigen. Schillers Ballade als Versuch, die junge, aber schon zur rührenden
Romanze heruntergekommene Gattung veredelnd emporzuheben, wurde als wichtiger Schritt in Richtung auf Klarheit, Einfachheit, Popularität hingestellt, auf eine ,Klassik', die den Abstand zwischen Bildungs-und
Massenpublikum durch den Rückgang aufs Allgemein-Menschliche überbrückt habe. Doch den Durchbruch zu breiter Popularität fand die klassische Ballade, die sich wenig in die sonstigen klassizistischen Bestrebungen
schicken wollte, eigentlich erst in der Romantik, die als europäische Bewegung den deutschen Typ der Kunstballade ins Ausland, nach Frankreich, England, Italien, exportierte. Die Schillersehe Ballade mußte ihre
Beliebtheit sozusagen um den Preis erkaufen, daß sie auf dem Niveau der Uhlandschen rezipiert wurde. Zu fragen wäre weiter, warum das deutsche Bürgertum ausgerechnet auf eine Gattung ansprach, deren Autoren es
geradezu ostentativ verschmähten, ihre Helden und Themen in der bürgerlichen Welt zu suchen; warum Gedichte, die auf einer Stoffwahl aus vorbürgerlichen, feudalen Traditionswelten, auf einem geistesaristokratischen
Literaturprogramm und auf strengster Separation von der politisch-gesellschaftlichen Wirklichkeit beruhten, zu bürgerlichen Lieblingswerken werden konnten.
[S. 194] Die Ästhetik von Schillers Balladen wird
nicht mit der Kategorie des Realismus, eher mit der des Sensationellen getroffen, das in ihnen die wirkungsvolle Vermittlung von Stoff und Gehalt, empirischer Realität und Idee leisten soll. Das Programm einer
Aufpeitschung der Sinne verbindet Schillers klassische Balladen mit jener Balladentradition, von der er sich distanzierte, deren Protagonist Bürger sich gewünscht hatte, daß es dem Leser bei der Lenore ´eiskalt über
die Haut laufen´ müsse. Nur sollen die Sensationen bei Schiller zugleich der Mobilisierung für die Idee dienen. Mit dem Interesse am Sensationellen knüpft Schillers Ballade an die Bänkelsangtradition bewußt an,
deren massenwirksame Techniken Schiller für seine Ziele zu nutzen suchte, wie er überhaupt die Unterhaltungsliteratur seiner Zeit aufmerksam studierte. Doch haftet den Versuchen, Sensation und Idee,
Bildungshumanismus und Popularität in den Balladen zu verbinden, auch etwas Gewaltsames an. Es fragt sich, ob Schillers Rechnung, produktionsästhetisch: mangelnde Anschauung durch suggestive Stilisierungstechnik zu
kompensieren, wirkungsästhetisch: den Massen spektakuläre, kolportagehafte, nervenkitzelnde Stoffe in den Rachen zu werfen, damit sie die darin verpackten Ideen schlucken, immer ganz aufgegangen ist. Schillers
moderner, aufgeklärter Rationalismus widerspricht den altertümlichen Inhalten teilweise ebenso wie sein idealistischer Klassizismus dem Zurückgreifen auf grell sensationelle, triviale Effekte. Das ist ablesbar an
dem für Schillers Balladen typischen Ineinander von Spektakel und Ethos, Nervenschauspiel und Freiheitsdemonstration (Der Handschuh), Mysterium und Krimialpsychologie (Die Kraniche des Ibykus),
Wahrscheinlichkeitsrechnung und Moira (Der Ring des Polykrates), quasi sportlicher Leistung und menschlichem Drama (Die Bürgschaft, Der Taucher). “
|
|
1980
|
Trautwein, Wolfgang. Höllensturz des Absolutismus - Bürger: Der wilde Jäger. In: Erlesene Angst - Schauerliteratur im 18. und 19. Jahrhundert
“[S. 120] Gegen Ende des 18. Jahrhunderts häuften sich die Klagen der Bauern über den Flurschaden, den die Jagden und die Wildhaltung anrichteten. Indem Bürger dieses Vorwissen des
zeitgenössischen Publikums anspricht, erzielt er eine weitere, textexterne Verallgemeinerung. Im Gottesurteil erreicht Bürgers Strategie der Generalisierung dann ihren Höhepunkt. Exemplarisch verurteilt Gott den
Grafen:
Zum Schreck der Fürsten jeder Zeit,
Die, nur verruchter Lust zu fronen,
nicht Schöofer noch Geschöpf verschonen!
Das Gottesurteil verleiht dem Einzelfall
überzeitliche Gültigkeit und bezieht damit auch die Gegenwart des 18. Jahrhunderts ein. Der Interpretationsspielraum zwischen restriktivem und explikativem Relativsatz gibt dem obigen Zitat implizit ein kritisches
Potential, das dem Adel insgesamt die Legitimation abspricht. Nachdem das Schauergeschehen hierzu keine Gelegenheit mehr bietet, stellt der übergeordnete Rahrnenteil der Schlußstrophe nochmals den generalisierenden
Gegenwartsbezug her: Oft erscheine noch heute die wilde Jagd dem »Wüstling« zur Warnung. Strophe 36;6 setzt den Wüstling implizit mit dem Jäger gleich; das Jagdrecht aber hat nur der Adel. Das Andauern der wilden
Jagd verdeutlicht dadurch erneut, daß die Ballade nicht nur vergangene, sondern auch aktuelle Mißstände attackiert.
Die implizite Theologie in Bürgers »Der wilde Jäger« richtet somit die
religiöse Angst, die die Kirchen zugunsten des gesellschaftlichen Status' quo verwalteten, gegen den Absolutismus und die orthodoxe kirchliche Lehrmeinung. Lore Kaim-Kloocks Kritik, ´Der wilde Jäger´ entlarve die
Religion nicht als Instrument der Klassengesellschaft, sondern stelle sie in den Dienst der Gerechtigkeit, muß präzisiert werden. Fraglos bleibt die Gültigkeit der religiösen Normen unbestritten. Jedes andere
Verfahren würde sich, wie auch Kaim-Kloock bemerkt, beim intendierten Publikum von vornherein diskreditieren. Dennoch enthält die Ballade, indem sie das Gottesgnadentum in Frage stellt, einen zwar unausgesprochenen,
deshalb aber um so geschickteren Angriff auf die Kirchen, die mit dem Absolutismus gemeinsame Sache machten.
[S. 121] Indem die neuartigen Schauerelemente zu Beginn des Ungleichgewichts (26;3-28;2) den
Herrschaftsraum des Grafen zerstören und ihn aus der Sozialhierarchie isolieren, verwirklicht sich im Schauergeschehen das bürgerliche Gleichheitsprinzip. Das Gottesgericht präzisiert dies als Gleichheit vor einem
allgemeinverbindlichen Gesetz. Wie wir gesehen haben, sanktioniert das religiöse Sünde-Strafe-Schema auch die sozialen Normen, die der Graf gegenüber dem Bauern und dem Hirten verletzt hat. Diese Normen definieren
ebenfalls bürgerliche Werte: Unverletzlichkeit der Person, Unantastbarkeit des Privateigentums, angemessene Achtung der produktiven Arbeit. Das Gottesurteil, das den ´Wütrich teuflicher Natur, frech gegen Gott und
Mensch und Tier´ (29;1 f.) der Hölle überantwortet, stellt die gottgewollte Weltordnung wieder her; diese ist ideologisch nicht neutral, sondern enthält die genannten bürgerlichen Wertvorstellungen. Anstelle eines
Gottesgnadentums des Adels, dessen Nichtigkeit die Ballade demonstriert, setzt sie, durch den überlieferten Sagenstoff, dessen theologische Aufbereitung und die Suggestivkraft des Schauers dreifach abgesichert, ein
Gottesgnadentum bürgerlicher Werte.”
|
|
1980
|
Bürger, Christa. Tradition und Subjektivität.
“[S. 131] Die klassische Literatur vollzieht jedoch gerade eine Ablösung von dieser Institutionalisierung. Die Autonomieästhetik bedeutet auf der Ebene der Werksgehalte daher den
Verzicht auf die (eingreifende) Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen und normativen Problemen der Epoche. Die Normproblematik wird in den klassischen Werken in die philosophische Frage nach der rationalen
Begründbarkeit von normativen Geltungsansprüchen zurückgenommen. Die damit verbundene Esoterisierung der Form nehmen die Autonomieästhetiker in Kauf, ebenso wie die Ablösung vom bürgerlichen Lesepublikum. Die
negative Seite dieses Trennungsprozesses, die mit der Dichotomisierung der Kultur angesprochen ist, wird faßbar in den Ausgrenzungsstrategien der Literaturproduzenten. Manches spricht dafür, daß der Kampf gegen die
Unterhaltungsliteratur, der mit Schillers Polemik gegen Bürgers Konzept einer populären Kunst eingeleitet wird, auch als Kampf gegen die Aufklärung und deren Literaturvorstellung aufzufassen ist. Diese
Dichotomisierung der Literatur legt die Frage nach dem Gehalt dessen nahe, was das 19. Jhdt. als Bildung bezeichnet hat.
Besitz und Bildung, die Formel, deren konkrete Dimension in Fontanes Frau
Jenny Treibel faßbar wird, weist darauf hin, daß es gerade nicht die kritischen oder utopischen Momente der Kunst, nicht die auf rationale Wirklichkeitserkenntnis gerichteten Werksgehalte gewesen sind, die eine
bürgerliche Ich-Identität haben stabilisieren helfen, sondern vielmehr das Bewußtsein, Träger einer »höheren« Bildung zu sein. Wenn in der deutschen Geschichte Literatur wirklich Bildungsfaktor gewesen ist, dann
meist in problematischer Weise, von ähnlichem Ursprung und in ähnliche Richtung weisend wie die Geschichte des Irrationalismus. Wagner-und Georgekult, Nietzscheverehrung - das sind Stationen einer Geschichte, die in
großartig einseitiger Weise Georg Lukács als Zerstörung der Vernunft beschrieben hat, damit zugleich auf die praktischen Folgen der Abtrennung der bürgerlichen Intellektuellen von der Offentlichkeit hinweisend.
Als Statussymbol hat Literatur Wirkung gezeitigt, in der von der Elementarbildung sich abgrenzenden Ideologie der höheren Bildung, die mit der Verfügung über die klassischen Werke identisch gesetzt
wird. Diese Entwicklung, von Schillers utopischem Programm der ästhetischen Erziehung des Menschengeschlechts bis zur Instrumentalisierung der Bildung im Dienst der sozialen Auslese wiederholt im Bereich der
Institution Kunst jenen SubstanzverIust bürgerlicher Ideologien, den die Kritische Theorie aufgedeckt hat.”
|
|
1980
|
Promies, Wolfgang. Lyrik in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In: Deutsche Aufklärung bis zur Französischen Revolution 1680-1789, München Wien. (Sammlung Helmut Scherer)
“[S. 602] Der Verwendungszweck der meisten Freiheitsgedichte macht deutlich, daß sie weniger der unmittelbaren Aufklärung und Agitation dienten, als ein neues Gemeinschaftsgefühl durch
eine neue Art Gemeindelied befördern wollten - August Wilhelm Lamey verfaßte zwischen 1789 und 1795 über hundert revolutionäre Gedichte, die zum Teil in den ´Vernunfttempeln des Elsaß nach alten Kirchenweisen
gesungen wurden´. Die geringe Breitenwirkung, die die Ideen der neufränkischen Revolution in Deutschland hatten, kann unter anderem darauf zurückgeführt werden, daß sie sich der Sprache des gebildeten Bürgerlichen
bediente! Bürgers Aufruf zur ´Popularität der Poesie´, niedergeschrieben in der progressiven Phase des deutschen Bürgertums, erhält in diesem Zusammenhang erneute Aktualität. Er wurde aber nicht befolgt, sondern von
einem berühmten deutschen Schriftsteller sogar für verfehlt erklärt. Die Rede ist von Friedrich Schiller und seiner Rezension ´Über Bürgers Gedichte´, die ihrer grundsätzlichen Ausführungen wegen Epoche gemacht hat
und eigentlich den hier zu behandelnden Zeitabschnirt beschließt.
Schiller geht von der Feststellung aus, daß ´unser philosophisches Zeitalter´ den musischen Künsten mit
Gleichgültigkeit begegnet, und diese Gleichgültigkeit die lyrische Gattung am empfindlichsten treffe, deren Verfall auch die ´jährlichen Almanache, die Gesellschaftsgesänge, die Musikliebhaberei unserer Damen´
schwerlich aufzuhalten vermögen. In dieser Situation ist ihm ein Dichter, der sich ausdrücklich als ´Volkssänger´ ankündigt und Popularität zu seinem höchsten Gesetz erklärt, umso problematischer, als er für die
Gegenwart den ungeheuren Abstand konstatiert, der zwischen dem ´großen Haufen´, der ´Masse´ einer Nation und der ´gebildeten Klasse´, der ´Auswahl´ einer Nation besteht. Der ´gebildete Mann´ ist demnach der Adressat
einer lyrischen Dichtkunst, deren würdigste Bestimmung Schiller in folgendem sieht:
Die Sitten, den Charakter, die ganze Weisheit ihrer Zeit müßte sie, geläutert und veredelt, in ihrem Spiegel sammeln
und mit idealisierender Kunst aus dem Jahrhundert selbst ein Muster für das Jahrhundert erschaffen. Dies aber setzte
voraus, daß sie selbst in keine andre als reife und gebildete Hände fiele.
Dem Dichter vom Schlage Bürgers spricht Schiller diese ´Krone der Klassizität´ ab, da seine von ihm abwertend so
genannten ´Gelegenheitsgedichte´ der ´idealische(n) Reinheit und Vollendung´ ermangeln, weil ihr Dichter selbst eine unvollkommene Individualität darstellt. Jene Zeilen Schillers beinhalten eine Grundlegung der
klassischen Dichtkunst und ihrer gesellschaftlichen Mission, greifen dabei jedoch auf frühaufklärerische Positionen von der Identität zwischen der ästhetischen Schönheit des Kunstwerks und der sittlichen Schönheit
des Künstlers zurück, die man längst überwunden geglaubt hatte! Entsprechend der Definition, daß wir uns von dem Dichter in eine ´wohltätige harmonische Stimmung´ versetzt sehen wollen, entwirft Schiller das Bild
des Dichters, das Klassizität als - skandalösen - Zwang zur Harmonie begreift:
Nur die heitre, die ruhige Seele gebiert das Vollkommene. Kampf mit äußern Lagen und Hypochondrie, welche
überhaupt jede Geisteskraft lähmen, dürfen am allerwenigsten das Gemüt des Dichters belasten, der sich von der
Gegenwart loswickeln und frei und kühn in die Welt der Ideale emporschweben soll. Wenn es auch noch so sehr
in seinem Busen stürmt, so müsse Sonnenklarheit seine Stirne umfließen.
Schillers Aufsatz hat über Bürger und über die Weimarer Klassik hinaus Bedeutung. Sein Verdikt gegen den Stoff, die Materie, die es zu dem Idealschönen zu veredeln gilt, verhindert die konkrete
Auseinandersetzung mit der Realität. Seine Schüler und Epigonen übersetzen Wirklichkeit in die sentimentalische Idee von der Wirklichkeit, eignen sie sich aber nicht sprachschöpferisch an: das ästhetische Problem
der deutschen Lyrik in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Schillers Definition der lyrischen Dichtkunst als Produkt eines gebildeten Dichters für den Kunstverstand des gebildeten Mannes trägt entscheidend zu
jener Absonderung der Kunstdichtung von den ästhetischen Bedürfnissen der Gesamtgesellschaft bei, die bis zum heutigen Tag das Stigma der deutschen Kulturgeschichte geblieben ist. Goethe hat im Alter diese
Entwicklung offenbar genau erkannt. Gegenüber Eckermann äußerte er am 3. Mai 1827 wenigstens:
´Von meinen eigenen Liedern was lebt denn? Es wird wohl eins und das andere einmal von einem hübschen
Mädchen am Klavier gesungen, allein im eigentlichen Volke ist alles stille.´
Im Gegensatz zu Schiller trachtet er danach, die sich verfestigende Dichotomie der Lyrik zu überwinden:
In dieser Situation bot sich ihm das Gelegenheitsgedicht als willkommenes
Modell einer Poetik an, deren Ziel es war, die endgültige Zweiteilung der Lyrik in einen angeblich kunstlosen, aber lebensvoll-wirksamen Zweckbereich und in einen zwar als kunstvoll bezeichneten, aber
lebensfern-wirkungslosen Autonomiebereich zu verhindern, um so die Einheit der Lyrik als Kunst zu erhalten, ihr konkrete gesellschaftliche Funktionen zu sichern und damit die Poesie vor einer ihr drohenden
Selbstisolierung zu bewahren. Die weitere Geschichte der deutschen Lyrik beweist, daß mit ihren ästhetischen Fortschritten auch ihre gesellschaftliche Isolierung fortgeschritten ist. “
|
|
1980
|
Kinematographenbilder, Veröffentlichungen der Berliner Zensurstelle.
In: 'Verzeichnis in Deutschland gelaufener Filme. Entscheidungen der Filmzensur 1911-1920. Berlin, Hamburg, München, Stuttgart' (Dank an Christof Schöbel vom Deutsches Filminstitut - DIF e.V. für diesen Hinweis)
“Stück 9832/12
Leonore, nach dem Gedicht von Bürger
(Akt I und II.)
Udo Konrad und Paul Baumann, Berlin - F.-No. fehlt.
- Ausschnitte: Akt II: Szene ´Den Tod im Nacken (ein
Mann, dem ein Todengerippe folgt) und Szene, in der
die Gesichter des Teufels und zweier Hexen gezeigt werden´.
Länge des gekürzten Films Akt II: 228,30 m.
Nach Kürzung für Kinder verboten. “
|
|
1981
|
Höger, Alfons. "UND ETWAS ANDERS NOCH..." Galanterie und Sinnlichkeit in den Gedichten G.A. Bürgers. In: TEXT&KONTEXT 9.2
“[S. 250] G.A. Bürger, geboren am 1. Januar 1748, gestorben am 8.Juni 1794, ist vor allem wegen seiner Balladen gerühmt worden. Zwei andere thematische
Bereiche werden oft gar nicht erwähnt oder nur flüchtig gestreift, nämlich seine politische Lyrik und die Gedichte die erotischen Beziehungen gewidmet sind.
An Sprachkraft ist Bürger gerade auch hier
ein Dichter für das VoIk. Er versteinert die Sprache nicht, zwängt sie nicht in abstrakte Gedankenkäfige, hängt sich nicht an das Programm des Weimarer Klassizismus, sondern zieht und saugt die Nahrung aus der
Volksdichtung.
Auch heute noch werden die Gedichte Bürgers jedem, der sich dem Volk zugehörig fühlt, verständlich sein, weil in ihnen jene Sinnlichkeit und jener Humor liegt, der der
Verstandesdichtung total abhanden gekommen ist. Nur so lässt sich auch jener Backenstreich Schillers in der Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung vom 15. und 17. Januar 1791 (Nr. 13, 14) erklären, von einem
'Anonymus' verübt, der Bürger, damals schon krank und geschwächt, an seinen eigenen Qualitäten zweifeln liess und ihn später zu Retouchen im klassizistischen Stil anhielt.
Bürger wollte sich aber
gerade in den 70er und 80er Jahren nicht mehr dem Geschmack der 'Philosophunculos' und damit der Elite-Literatur anpassen, sondern Breitenwirkung im Volk, das aus Adel, Bürger und Bauern besteht, anstreben. Er
wollte hierbei das Natürliche nachbilden, es - seiner Meinung nach - künstlerisch als Schönheit zum Ausdruck bringen und durch diese kunstvoll ästhetische DarsteIIung den ´inneren' Sinn des Menschen berühren. [...]
Diese Übernahme ausländischen Kulturguts, wobei Bürger vor allem an die Antike und Frankreich denkt, ist 'totes Kapital', eine wertlose ´Münze', die nicht gebraucht werden kann.
Wenn
besonders berühmte Dichter, wobei er wohl vor allem an Klopstock, an die Gottschedianer, den Berliner Kreis um Nicolai denkt, wenn diese nur eine 'Göttersprache reden', nicht aber das Volkstümliche übernehmen, wenn
sie nicht 'menschliche, sondern himmlische Szenen (d .h. idealisierte und keine realistischen - A.H.) malen, dann ist dies die Ursache dafür, dass das Publikum, das von ihnen - den Elitedichtern -als 'kalt und
träge' apostrophiert wird, Vernunftprodukte nicht annimmt.
[S. 252] Was an dieser Bemerkung - im übrigen oft zitiert -besonders fasziniert und was in der Bürger-Forschung noch kaum diskutiert worden ist, das
ist Bürgers Erkenntnis, dass die Kunst die Rolle der Religion als Vermittlerin des Heils übernehmen soll, und zwar eines Heils, das auch in diesem 'Jammertale' die Menschen von Blindheit, Taubheit, dem Krüppeldasein
und dem Aussatz befreien soll, wobei diese Ausdrücke bildmäßigen Charakter haben.
Bürger, als Protestant, hat nur zu gut den kalten Dogmatismus, die Spiessbürgerlichkeit des Reformismus erlebt,
der nicht, wie dle katholische Kirche, eine Heilsverwaltung besass. Bürger glaubte deshalb in der Kunst und vor allem in der Volkskunst den 'Odem Gottes', das Numinose zu spüren und durch ein entsprechendes Einleben
und Einverständnis mit dem Allgemein-Menschlichen jene Gemeinsamkeit erzeugen zu können, die auch die 'Dame am Putztisch' mit dem 'rohen Bewohner des Waldes' sich identifizieren lässt. Kunst ersetzt damit den
Rationalismus der Religion, sie ist das Gegenstück zum Elend des `Jammerta!s', sie wird das einigende Band.
Damit erhebt sich die Frage, ob Bürger wirklich glaubte, dass sich in der Kunst der 'Odem Gottes' ausdrücke.
Beginnen wir mit dem Gedicht Danklied , das 1772 geschrieben wurde, und wo sich eine Lösung des ·Problems abzeichnet.
[S. 255] Im Menschen kommt das Göttliche als Geist (=Geist der Natur) in seiner reinsten
Gestalt zum Ausdruck, und dieser Geist schafft Schönheit und damit Kunst, die nicht nur in der Natur entdeckt, sondern auch selbst dargestellt werden kann. Dieses geistige Element, wenn es nur gehandhabt wird,
bindet alle Menschen zusammen und lässt sie das zukünftige Glück, auch auf Erden, schauen.
Bürger hat diesen Aspekt schon damals verstanden und ihn in seinem Danklied ausgedrückt, dem weitere
Gedichte wie Die Elemente (81-83), An die Menschengesichter (94-95) und Naturrecht (120) folgen, wo das entscheidende, verbindende Element Gott, Natur und Lust ist, gegen die die strenge Moral des Bürgertums sich
versündigt.
Bürger sieht also ganz allgemein in den 70er Jahren Natur und den Geist der Natur als identisch mit Gott an, während er den Rationalismus als kalte Vernunftherrschaft betrachtet. Deshalb
soll der Künstler auch nicht dem Rationalismus unterliegen, sondern als Vermittler und DarsteIler jener vom Geist beherrschten Natur, die als `Odem Gottes` den 'inneren' Sinn des Publikums berühren soll,
funktionieren.
Bürger sah also selbst die Natur als die einzig bestimmende Kraft an und erteilte damit der bürgerlich·puritanischen Moral in vielen seiner Gedichte eine starke Abfuhr, z.B. in Frau
Schnips, An Göckingh, Schnick und Schnack und Veit Ehrenwort.
Charakteristisch für die Verherrlichung des Heils und den Nasenstüber, den er dem Asketismus der christlichen Religion gibt, sind
z. B. die folgenden Sonette: Der versetzte Himmel und Naturrecht.
[S. 260] LaMettrie sieht dagegen allein in der körperlichen Lust das grösste Vergnügen, wobei gefühlsmässige Individualliebe keine
entscheidende Rolle spielt. Eher dreht es sich um die Schönheit und Attraktivität der Angebeteten.
Bürger steigert dieses physische Lustgefühl jedoch durch das an ein Individuum gebundene
Liebesgefühl, wo das Himmlische sich konkret in einer Person offenbart.
Dieser Faktor wird geistig als Programm in den Molly-Gedichten an den Leser weitergegeben, der diese Nachbildnerei
wohl erkennt und nicht länger, wie es die bürgerliche Moral verlangt, Liebe von Sexualität trennt, sondern einsieht, dass sich Liebe eben nur im sexuellen Akt auf die vollkommenste Weise verwirklichen lässt.
[S. 265] Neben der Anakreontik und der Erlebnislyrik Bürgers finden sich Gedichte, die, vom bürgerlichen Geschmack aus als frivol, obszön oder gar pornographisch beurteilt werden. Nun, sagen wir es einmal ganz
ehrlich, diese Bezeichnungen werden vor allem auf die Volksdichtung angewandt, weil eben gerade hier der Kontrast zur christlich-asketischen Moral seinen Ausdruck im Humor und im Witz findet. Nicht die kalte,
vernünftlerische Argumentaion, sondern das überraschende und oft witzige Erlebnis ist die Hauptursache der Breitenwirkung volkstümlicher Poesie.
Das Paradebeispiel für Bürgers Frivolität ist der Text
Frau Schnips. Dieses im Juli 1777 geschriebene Gedicht wurde von Boie, Goeckingk, Voss und schliesslich sogar von Bürgers Verleger Dietrich abgelehnt, bis es endlich im Göttinger Musen-Almanach 1882 erschien, wobei
es gewaltigen 'Ärger in geistlichen Kreisen' erregte.
[S. 266] Für Frau Schnips gilt jedenfalls, dass hier eine Satire auf die Heiligen, die Apostel und Berühmtheiten des Alten Testamentes vorliegt, deren
Fehler und 'Sünden' grösser als die der Frau Schnips sind, die sich ´Im Lustpfuhl dieser Erde´ gewälzt hat. Mord, Betrügerei, Verleumdung, Hurerei werden dem 'lustvollen' Leben der Frau Schnips gegenübergestellt,
und wenn Jakob, David, Maria Magdalena und Petms in den Himmel kommen, warum soll dann nicht das 'verirrte Lamm', Frau Schnips, ihren Platz dort finden? Die ´Apologie´ jedenfalls verweist darauf, dass diejenigen,
die aus 'erlogner Pflicht' diese Satire verdammen, darüber im klaren sein sollen, dass sie, wenn sie zelotisch gegen die 'Liebe' (= die Nächstenliebe) lästern, selbst verdammt werden. Wahrheit, auch wenn man
unzüchtig lebt, ist besser als der Betrug der Orthodoxie und des Katholizismus, die ihre Verfehlungen unter dem Deckmantel überholter und doch bürokratisch zweckmässig verwalteter Religiosität verbergen.”
Der vollständige Beitrag in der ONLINE-BIBLIOTHEK.
|
|
1981
|
Emme, Dietrich. Arthur Schopenhauer und Gottfried August Bürger. In: Göttinger Jahrbuch
“[S. 227] Es ist nicht verwunderlich, daß Schopenhauer von Bürgers Dichtung besonders angezogen war. Welcher Dichter hat wie Bürger die Gabe gehabt, die Höhen und Tiefen der Liebe in
formvollendeten, tief empfundenen und zu Herzen gehenden Versen zu besingen?
Liebe, deine Wunderkraft
Hat mein Leben neu geboren,
Hat zum Glück der Götterschaft
Mich hienieden schon erkoren.
Bürger gelang es nicht, der leidenschaftlichen Neigung zur jüngeren Schwester seiner Frau Herr zu werden. Die Herzensverwirrungen dieser Dreiecksbeziehung haben ihren
Niederschlag in Bürgers Liebesgedichten gefunden.
Ich erstarre, ich verstumme,
In Verzweiflung tief versenkt,
Wann mein Herz die Leidenssumme
Dieser Liebe überdenkt.
So beginnt Bürgers Gedicht ´An die Menschengesichter´, in dem er mit bewegten Worten schildert, daß die Liebe als eine Naturkraft dem Verstand nicht gehorcht. Dieses Gedicht
hat Schopenhauer als eine Bestätigung seiner Lehre angesehen, wonach das wahre letzte Wesen der Dinge, das ´Ding an sich´, nicht der Verstand, die Erkenntnis, das Bewußtsein, also die ´Vorstellung´ ist.
[S.
228] Schopenhauer zitiert Aristoteles, der, die Schwerkraft erläuternd, sagt: ´Wenn irgendein Teilchen der Erde in die Höhe gehoben und losgelassen wird, so stürzt es herunter und will nicht
bleiben.´ ´Im Deutschen sagt Bürger: ,Hinab will der Bach, nicht hinan!´ Dies ist ein Zitat Schopenhauers aus Bürgers bereits erwähntem Gedicht ´An die Menschengesichter´:
Die Sonne, sie leuchtet; sie schattet, die Nacht;
Hinab will der Bach, nicht hinan;
Der Sommerwind trocknet; der Regen macht naß;
Das Feuer verbrennet. - Wie hindert ihr das?
O laßt es gewähren, wie's kann!
Schopenhauer benutzt gern Beispiele aus der Literatur, um seine philosophischen Aussagen zu
verdeutlichen. Seine zahlreichen Hinweise auf Bürgers Dichtung lassen erkennen, wie sehr er mit den Werken dieses Dichters vertraut war und welche Bedeutung er ihm beimaß. Bürgers ´unsterbliche Balladen´ gehören
nach Schopenhauers Ansicht zum Wertvollsten, was seine Zeit an Dichtung hervorgebracht hat. Sind Schopenhauer zufolge Schillers Balladen ´kalt und gemacht´, ist das Urteil des Philosophen über Bürgers Dichtung
geradezu enthusiastisch: ´Danach´, meint Schopenhauer, ´messe man mir die Nation und das Jahrhundert, danach´.
[S. 229] Schopenhauer hatte seine im Juli 1815 abgeschlossene Schrift ´Über das
Sehn und die Farben´ zur Begutachtung an Goethe geschickt. Dieser ließ den jungen Philosophen mit Schreiben vom 23. Oktober 1815 wissen, es erfordere in seiner ´gegenwärtigen Lage zu große Anstrengung, zu
gewaltsamen Anlauf, mich wieder in die sonst so geliebte und betretene Region zu versetzen´, weshalb er, Goethe, vorschlage, Schopenhauer solle seine Arbeit einem Herrn Dr. Seebeck vorlegen, den er auf seiner
letzten Reise kennengelernt habe. Schopenhauer weist dieses Ansinnen Goethes entrüstet zurück: Bei diesem Vorschlag sei ihm sogleich die Tochter des Pfarrers von Taubenhayn eingefallen, ´welche Ansprüche auf die
Hand des gnädigen Herrn macht, der ihr hingegen seinen wackern Jäger zudenkt´. [...] Trotz Wertschätzung seiner Dichtung hat Schopenhauer in späteren Jahren ein distanziertes Verhältnis zu Goethe gehabt.
Aufschlußreich ist eine handschriftliche Notiz Schopenhauers, die sich auf der Rückseite des Vorsatzblattes zu Band 31/32 der Werke Goethes befindet. Schopenhauer besaß die Werke in der vollständigen Ausgabe letzter
Hand von 1830. Die Notiz Schopenhauers lautet auszugsweise: ´Bürger nicht erwähnt! Jean Paul, der 3 Jahre in Weimar gelebt, nicht erwähnt ... Zach. Werner persönl. auch nicht, obwohl er 1/2 Jahr mit ihm umgieng ...
Und dann rühmt er sich nicht neidisch zu seyn´. In sein Buchexemplar ´Briefe an und von Johann Heinrich Merck´ notiert Schopenhauer: ´Goethe's Neid, Egoismus und
Unverschämtheit´.
Goethe
konnte es nicht verwinden, daß seine Gedichte weniger populär waren als die von Bürger, dem ´von seiner ganzen Nation angebeteten Volks-Dichter´ - so wurde Bürger in einem an ihn gerichteten Brief von dem Leipziger
Philosophieprofessor Friedrich Gottlob Born bezeichnet.
[S. 230] Bürger wird vorgeworfen, ihm mangele die ´Idealisirkunst´ und seine Muse trage ´überhaupt einen zu sinnlichen, oft gemeinsinnlichen Charakter´.
In breiten Erörterungen versucht der anonyme Rezensent seine - wie Ludwig Reiners in seiner ´Stilkunst´ sagt - ´wunderliche Ansicht´ glaubhaft zu machen, die Dichtkunst müsse ´die Sitten, den Charakter, die ganze
Weisheit ihrer Zeit ... geläutert und veredelt, in ihrem Spiegel sammeln, und mit idealisirender Kunst aus dem Jahrhundert selbst ein Muster für das Jahrhundert erschaffen´. Bürger traf diese, seine Dichtung
verkennende und herabsetzende Kritik deshalb besonders schmerzlich, weil er Kunde erhielt, der von ihm hochgeschätzte Schiller sei der Verfasser der Rezension, was allerdings bis heute nicht erwiesen ist und was
auch Bürger nicht glauben konnte. Nach Schopenhauer hingegen darf einem Dichter die Moral nicht über die Wahrheit gehen, denn das Hauptthema des Dichters seien die Leidenschaften. Schopenhauer meint, große Poesie
habe das Innere der ganzen Menschheit abzubilden, ´und alles, was Millionen gewesener, seiender, künftiger Menschen in denselben, weil stets wiederkehrenden Lagen empfunden haben und empfinden werden, findet darin
seinen entsprechenden Ausdruck´.
[S. 231] Wie Bürger ist auch Schopenhauer ein Meister des deutschen Stils. [...] Ist Schopenhauer unter den deutschen Philosophen ein Meister des anschaulichen Stils, so gilt
dies hinsichtlich der Dichtung für Bürger.“
Der vollständige Beitrag in der ONLINE-Bibliothek
|
|
1982
|
Meyer, Jochen. Wilhelm Raabe. Unter Demokraten, Hoflieferanten und Philistern. Eine Chronik seiner Stuttgarter Jahre. Stuttgart
“ [S. 61] 9. Juli 1868. Raabe findet bei Gottfried August Bürger die Motto-Verse zum ´Schüdderump´:
´Ergötzet ihr
Nicht lieber euch am lächerlichen Tand
Der Torheit? Oder an dem heitern Glück.
Womit am Schluß des drolligen Romans
Die Lieb´ ein leichtgenecktes Paar belohnr?
Vielleicht! - ´
[Prolog zu Sprickmanns Eulalia auf einem Privat-Theater.]“
|
|
1982
|
Jünger, Ernst. Brief Rom, 23. März 1968. Sämtliche Werke. Erste Abteilung. Tagebücher IV. Band 4 Strahlungen III Siebzig verweht I, Stuttgart.
“[S. 406] Noch zum Gegensatz von Prognose und Augurium. Aus der Verfälschung durch das ´Wenn´ ziehen die Priesterschaften Gewinn und Ansehen. So im berühmten Orakelspruch zu
Delphi, an dem Krösos scheiterte. ´Wenn Krösos - - -´H, das ist nicht einmal eine Prognose, sondern Hinterlist. Hingegen erfährt Laios, auch zu Delphi, ein echtes Orakel: Ödipus wird ihn töten, die Mutter heiraten,
und das geschieht wider jede Wahrscheinlichkeit. Mein Großvater, der Knabenlehrer, zitierte gern eine Sentenz von Bürger:
Der Mann, der das Wenn und das Aber erdacht,
Hätt sicher aus Häckerling Gold schon gemacht.
Das kann gelingen. Und dann die Verknüpfung von Religion und Moral, das fundamentale Geschäft. “
|
|
1982
|
Eintrag in filmportal.de
Absender: Gottfried August Bürger
Regie: Heinz Liesendahl
Drehbuch: Michael Krausnick, Heinz Liesendahl
hat Vorlage: Gottfried August Bürger (Briefwechsel mit Elisa Hahn)
Kamera: Anton »Toni« Stupica, Bernd Fähse
Musik: Wolfgang Wiland
Darsteller:
Maria Schell Elise Hahn
Martin Benrath Bürger
Produktionsfirma: Süddeutscher Rundfunk (SDR) (Stuttgart)
Länge: 38 min
Format: 16mm, 1:1,33
Bild/Ton: Farbe, Ton
Aufführung: Uraufführung (DE): 24.08.1982, ARD
|
|
1983
|
Noch, Curt. Nachwort.
In: Gottfried August Bürger. Wunderbare Reisen zu Wasser und Lande, Feldzüge und lustige Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen. Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig
"[S. 96] Die endgültige Bestätigung seiner Autorschaft erbrachte ein 1872 aufgefundener Brief Bürgers an seinen Verleger.
[S. 97] Bürgers persönlicher Anteil an den
Münchhausengeschichten ist beachtlich, er beträgt umfangmäßig ein Drittel des Ganzen. Im ersten Teil stammen - neben den siebzehn der englischen Vorlage dreizehn aus seiner Feder, und den Seeabenteuern, die Raspe
erfand, fügte er ein weiteres Stück hinzu. Nicht zuletzt ist die sprachliche Gestaltung sein Verdienst, die das Werk erst befähigte. zum Volksbuch zu werden. Allein der Vergleich mit dem ´Vade Mecum´·Texten und
ihrem trockenen, papiernen Stil beweist es. Durch gefühlsbetonte Wörter. die dort nicht zu finden sind, durch Verkleinerungssilben, wie die Volksdichtung sie liebt, durch Vermeiden von Wendungen, die allein der
Schriftsprache eigen sind. und durch Einführung von Ausdrücken aus der Jägersprache, die den Erzähler als Weidmann charakterisieren sollen, erzielte der Dichter größere Frische und Lebendigkeit als seine Vorgänger.
Auch dem englischen Text gegenüber erlaubte er sich eine gewisse Freiheit. Es finden sich eine ganze Reihe von kleinen Zusätzen Bürgers, satirische Anspielungen auf zeitgenössische Zustände und Vorfälle. so die
´hochpreislichen wohlfürsorgenden Landesregierungen´, den ´höflichen Postmeister´, dessen gegenteilige Eigenschaft durch verkehrten Druck kenntlich gemacht wurde, die ´bärbeißigen Gelehrten und Philosophen´, mit
denen er ja Umgang hatte, die ´Stall-, Jagd- und Hundejunker´, seine Angriffe gegen die deutschen Fürsten, die er unter dem Bilde des Kaziken - wenn auch in sehr zahmer Form lächerlich macht. Es war die Zeit der
beginnenden Bewußtseinsbildung des deutschen Bürgertums. Als man anfing, sich gegen die feudale Oberschicht aufzulehnen, trugen solche Ausfälle zur Beliebtheit eines Buches bei, in dem es sich um einen adligen
Aufschneider handelte.
[S. 98] Bei seinem Erscheinen fand es trotz unverständiger Kritiken die beste Aufnahme. Es wurde immer und immer wieder neu aufgelegt. Auch Nachahmungen, sehr schwache, traten hervor,
die auf die Beliebtheit des Buches spekulierten. [...] Im allgemeinen weiß man nicht, wie die Volksbücher entstanden; hier aber vermögen wir einmal einer Entstehung mit sozusagen aktenmäßiger Genauigkeit
nachzugehen."
|
|
1983
|
Autorenkollektiv. Gottfried August Bürger. In: Sturm und Drang. Erläuterungen zur deutschen Literatur. 6. Auflage. Volk und Wissen Volkseigener Verlag Berlin
"[S. 265] Goethes Ausspruch (in ´Dichtung und Wahrheit´): ´Die Meisten, welche in den 60ger und 70ger Jahren Wirkung thaten, waren Autodidacten, die sich in einem zerstreuten Leben
gebildet hatten´, trifft auf Bürger voll zu. Nur so erklärt es sich, daß man bei Bürger trotz seines siebenjährigen Studentenlebens von einem Mangel an Bildung sprechen muß. Das sporadisch auf den verschiedensten
Gebieten zusammengeraffte Wissen bildete kein einheitliches Ganzes, es verschaffte ihm nicht die notwendige Übersicht über die historische Situation. die allein eine begründete Theorie auf wissenschaftlichem,
poetischem und politisch-gesellschaftlichem Gebiet hervorbringen konnte. [...] Jene Biographen, die sich in der Verurteilung von Bürgers Leichtsinnigkeit nicht genug tun können, finden jedoch keine Anerkennung
dafür, daß Bürger trotz der großen Not, der ständigen Schulden und des steten Zwanges, sich mit Nebenarbeiten das Notwendigste zu verdienen, seit 1770 zu den fleißigsten Studenten der Universität gehörte und bei
seinem Abgange die besten Zeugnisse erhielt, und das in einem Fach, welches keineswegs seinen wirklichen Interessen entsprach.
[S. 266] Bürgers praktische Tätigkeit, die in den ersten Jahren sein
Selbstvertrauen stärkte, die ihn mitten in die sozialen Kämpfe auf dem Lande stellte und seine ständige tätige Anteilnahme an den menschlichen Schicksalen forderte, mußte auch eine neue Phase in seiner literarischen
Entwicklung einleiten. Die soziale Tendenz und der rebellische Ton charakterisieren in dieser Zeit seine Gedichte, und die Frage einer Dichtung ´für das Volk´ steht im Mittelpunkt seines Denkens: ´Man lerne das Volk
im ganzen kennen, man erkundige seine Phantasie und Fühlbarkeit ...´
[S. 267] In seinen Gedichten an Molly behandelt Bürger mit einer für die damalige Zeit erstaunlichen Offenheit seine privaten Probleme.
Alle Leidenschaften und alle Qualen der Liebenden sind in diesen Versen eingefangen. Er klagt die Gesellschaft, ´Menschensatzungen´ und Christentum an, daß seine Liebe als Verbrechen geahndet werde. Der Dichter
steht hier in der Tradition der Barockdichtung und vor allem Johann Christian Günthers, des ihm in Leben und Dichtung brüderlich verwandten unglücklichen Poeten. Hat Bürgers Selbstbewußtsein zwei Wurzeln, die
praktische und die poetische Tätigkeit, so empfindet er auch seine Unterdrückung von zwei Seiten: von seiten der Aristokratie und von der Seite des Unternehmer-Bürgertums in der Gestalt des Verlegers Johann
Christian Dieterich. Bürger hatte dieses Problem in seiner ´Notgedrungenen Epistel des Schneiders Johannes an seinen großgünstigen Mäcen´ (1775) eingefangen, einem satirischen Bittgesuch, in dem er mit scharfem und
bitterem Witz die Abhängigkeit des Genies von der besitzenden Klasse und die Ungerechtigkeit der Welt verspottet.
[S. 268] Schillers Idee einer ´ästhetischen Erziehung des Menschen´, die ihren Niederschlag
auch in der Bürger-Rezension findet, stellt für den Dichter als Erzieher und Vorbild der Nation neue Maßstäbe auf. Am Ideal eines ´klassischen´ Nationalautors gemessen, von dem Schiller sowohl breite Wirkung als
auch tiefen Gehalt fordert, sowohl Verbindlichkeit als auch höchste künstlerische Qualität, mußten die meisten Dichter seiner Zeit als den Anforderungen nicht genügend erscheinen. Schiller schreibt seine Rezension,
um Ideale aufzustellen, Forderungen zu erheben; ihm geht es keineswegs darum, das bisher Erreichte auch zu würdigen und dabei die historischen Bedingungen zu berücksichtigen. Aus diesem Bestreben ist Schillers Härte
und Kälte gegenüber dem Menschen Bürger zu verstehen, sein mangelndes Verständnis sowohl für dessen Leistung als plebejischer Dichter als auch für die Wirkung der Rezension auf den vom Schicksal schon genugsam
Heimgesuchten. Bürger war ein Sturm-und-Drang-Dichter, und nur als solchen konnte man ihn gerecht einschätzen.
[S. 269] Trotz allem aber scheute Bürger nicht das öffentliche Bekenntnis zu den Gedanken der
Französischen Revolution, nicht die Mißstimmung der Herren in Hannover über die mangelnde Regierungstreue ihres Universitätslehrers. Der Almanach [auf das Jahr 1793] enthielt rund vierzig Stücke allein von Bürger.
Ein Teil davon war gegen Schiller gerichtet, der größere Teil jedoch beschäftigte sich mit brennenden politischen Problemen. Die schärfsten Polemiken, in denen der radikale Standpunkt Bürgers am deutlichsten zu
Worte kam wie etwa in dem Epigramm ´ Uns, die wir nicht wie ihr vom Recht zu herrschen denken... ´ - , mußten allerdings vom Druck ausgeschlossen bleiben. Erst rund achtzig Jahre später wurden sie aus seinem Nachlaß
veröffentlicht. Mit verschärften Zensurvorschriften, Polizeibespitzelung und Verboten der öffentlichen und geheimen Verbindungen versuchte man, die demokratischen Bewegungen zu ersticken. Bürger erwartete mit Recht,
daß sein Almanach ein ´ziemliches Zetergeschrei´ auslösen würde. Die Reaktion war noch einschneidender, als er erwartet hatte. Er mußte seine Gedichte für den Almanach 1794 in der Schublade liegenlassen und
entschuldigte sich dafür beim Publikum mit dem Epigramm ´Entsagung der Politik´. Daß sich Bürger trotz zeitweiliger Resignation der Losung der Französischen Revolution ´Friede den Hütten, Krieg den Palästen´ mit
ganzer Seele verschrieben hatte, das beweist die Fabel ´Das Magnetengebirge´, in der er sich grundsätzlich zur revolutionären Gewalt bekannte. Bürger gehört zu den wenigen kompromißlosen Schriftstellern in
Deutschland, die der Revolution auch in der jakobinischen Phase treu blieben und denen patriotische und demokratisch-revolutionäre Gesinnung eins waren.
[S. 270] Bürgers Denken war auf alles sinnlich Faßbare,
Gegenständliche, Vorstellbare gerichtet, und diese Eigenart bestimmte auch das Wesen und die Vorzüge seiner Dichtung, sie ist selbst in seinen theoretischen Schriften wiederzufinden. Das Theoretisieren,
Philosophieren lag ihm nicht.
[S. 271] In seiner Gleichung ´Volksdichter´ = ´Dichter der Nation´ zeigt sich bereits, daß ´Volk´ hier nicht mehr allein die unteren werktätigen Schichten bedeutet, sondern daß
alle Stände mit eingeschlossen sind. Bürgers Absicht, auf die oberen und unteren Stände zu wirken, hat sich in der Praxis tatsächlich mit seiner ´Lenore´ und mit seiner ersten Gedichtausgabe erfüllt. Seine Lieder
wurden auch in Hofkreisen populär, und sein Pränumerantenverzeichnis enthält eine beträchtliche Anzahl hoher und höchster Fürstlichkeiten. Im Grunde war deren Begeisterung ein Widersinn, denn gegen sie war,
ausgesprochen oder verborgen, Bürgers Dichtung gerichtet.
[S. 272] Bürgers Bevorzugung des Liedes und der Ballade hat ihren Grund nicht nur in der Richtung seines Talents, sondern auch in seiner Stellung zum
Publikum. Sie sind die poetischen Formen, die durch die Möglichkeit des Vortrages und des gemeinsamen Gesanges am stärksten gemeinschaftsbildend wirken und zum kollektiven Mitschöpfen auffordern. Bei ihnen stellt
sich sofort eine enge Verbindung zwischen Autor und Hörer her. Nur beim Theater ist noch ein ähnlich direkter Kontakt und ein ähnlich kollektives Erlebnis der Poesie vorhanden.
[S. 273] Bürgers Grenzen
theoretischer Einsicht offenbaren sich vor allem in der Nichtbeachtung wichtiger ästhetischer Probleme und in seinen Dichtungen selbst. Eine große Schwäche Bürgers lag in der Bereitschaft, die lenkende und leitende
Funktion der Literatur aufzugeben und sich zugunsten der populären Wirkung einem breiten Publikumsgeschmack unterzuordnen. Eine andere Schwäche bestand darin, daß er das Wesen der realistischen Kunst ungenügend
erfaßte und im Naturalismus steckenblieb.
[S. 277] Bürger erreichte in den Sonetten eine Vollendung der sprachlichen und metrischen Form, einen Wohlklang der lyrischen Aussage, wie sie früher nur selten bei
ihm zu finden waren. Doch der gedankliche Gehalt geht kaum über den ... engen privaten Kreis hinaus, und nur selten gelangt Bürger hier zu großen Verallgemeinerungen. Diese Gedichte entsprechen nicht dem von ihm
selbst aufgestellten Ideal der volkstümlichen Poesie, es fehlt ihnen dazu der nationale Gehalt. [...] Als Bürger 1793 im ´Musenalmanach´ mit den literarischen Früchten seiner politischen Anteilnahme öffentlich
hervortrat, war er unter den Professoren ein völliger Außenseiter. Die Zensur sorgte dafür, daß der nächste Almanach wieder zahm und unbedeutend wurde, und Bürger entschuldigt sich beim Publikum mit dem Gedicht
´Entsagung der Politik´.
[S. 278] Zu den bekanntesten Beiträgen Bürgers zur Frage des gerechten und des ungerechten Krieges gehört sein Gedicht ´Die Tode´. Es ist eine kurzgefaßte, gereimte, didaktische
Abhandlung über die verschiedenen Möglichkeiten des Heldentodes. Der Bezug auf die aktuellen Vorgänge ist nicht zu übersehen. [...] Die beiden letzten Strophen unterscheiden sich wesentlich von den ersten. Hier
nimmt der Dichter Stellung zu Fragen, die in Deutschland für das Volk aktuell waren, und das war in den Jahren 1792/93 nicht die Frage des Heldentodes fürs Vaterland, noch weniger für die Revolution. Die deutschen
Soldaten wurden von ihren Fürsten in einen ungerechten Krieg getrieben, das war die deutsche Wirklichkeit. Diesen unrühmlichen Tod prangert Bürger an. Seine Sprache ändert sich mit einem Schlage, sie verliert ihren
hohen rhetorischen Schwung, sie wird plebejisch. Bürger steigt herab von seiner Kanzel, gesellt sich unter das Volk, spricht in dessen Sprache. [...] Verschwunden ist die unrealistische Tugendpredigt. Bürger greift
zur Abschreckung auf die anschauliche, im Volk verbreitete Vorstellung der Hölle zurück. Die Attribute der Schändlichkeit sind realer als ´Zepter, Wag' und Schwert in tugendhafter Hand´: es sind ´Rad und Galgen´.
Auch die Benennung der falschen, im Solde der Despoten stehenden Helden läßt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: es sind ´Straßenräuber´, ´Mörder´.
[S. 283] Die Tatsache der ungeheuren Verbreitung
einiger Biirgerscher Balladen bestätigt, daß die ungemein breite und andauernde Wirkung mancher poetisch nicht vollkommener Balladen Bürgers Fähigkeit zuzuschreiben ist, den Geschmack der breiten Massen
nachzuempfinden und ihm entgegenzukommen, sowohl in der Stoffwahl als auch in der Gestaltung. Es darf also nicht genügen, diese Bürgerschen Balladen als ´Verirrung´ abzutun. Es ist stets dabei zu fragen, wieweit
diese poetischen Verirrungen auf das Konto der speziellen Auffassung Bürgers über ´Popularität´ zu setzten sind, das heißt, wie weit hier die Erfahrungen über die Wirkung der niedrigen Literatur in den unteren
Publikumsschichten die Gestaltung beeinflußten.
[S. 292] Es ist Bürger hoch anzurechnen, daß er in dieser Ballade [Des Pfarrers Tochter von Taubenhain], deren Stoff der Moritat nahe steht und zur Moral reizt,
das Moralisieren vermeidet, mit keinem Wort von außen als Richter auftritt und damit bis zum Schluß die realistische Behandlung des Themas durchhält. In dem tragischen Schluß, der die Ungerechtigkeit triumphieren
läßt, liegt der schärfste revolutionäre Akzent.
[S. 296] Bürgers großes Verdienst um dieses Gedicht wird keineswegs dadurch geschmälert, daß er ein so glückliches Vorbild gefunden hat. Um daraus die Ballade
´Der Kaiser und der Abt´ zu schaffen, gehörte sowohl sein sicherer Griff nach dem ihm gemäßen Stoff, sein Talent, diesen entsprechend den nationalen deutschen Gegebenheiten umzuformen und weiterzuentwickeln, als
auch die Gabe, für den Stoff einen vorbildlichen sprachlichen Ausdruck zu finden.
Sturm und Drang. Erläuterungen zur deutschen Literatur in der ONLINE-BIBLIOTHEK.
|
|
1983
|
Widdel, Wolfgang. Nachwort. Gottfried August Bürger - Versuch einer Annäherung. In: Gottfried August Bürger. Die Weiber von Weinsberg. Buchverlag Der Morgen Berlin
"[S. 187] Freundlichkeit, die nicht darüber hinwegtäuschen kann, daß Goethe, froh, dem heiklen Thema mit gefälligen Worten entronnen zu sein, weiß, wohin Vorurteile, Legenden und
Gerüchte - und die sind über Bürger im reichlichen Maße im Umlauf - führen: auf unverschämt direktem Weg an der Wahrheit, der inneren und äußeren Biographie vorbei in überdauernde Falschbilder und furchtbare
Uberwucherungen hinein.
[S. 189] So reift unter den ständigen Angriffen und Verleumdungen seiner ärgsten Widersacher (zweimal wird Bürger durch verschiedene Mitglieder der Familie von Uslar wegen angeblicher
Amtsversäumnisse bei der Regierung in Hannover angeklagt) eine Entscheidung: gegen die treue Pflichterfüllung, für die Gewissensfreiheit!
Für Anstand und Moral in seinem Amtsbereich sorgt er, aber
nicht im Sinne seiner Vorgesetzten. Den kleinen menschlichen Nöten und Schwächen (Aufsässigkeit und Ehebruch, Ruppigkeit bis hin zur ausgewachsenen Schlägerei und anschließendem Trinkgelage) begegnet er mit
Nachsicht und Milde. Dem ungesetzlichen Vorgehen der Obrigkeit setzt er Härte entgegen: So gelang es Bürger einmal durch energisches Einschreiten die Befreiung eines schwächlichen Schneiders zu erwirken, dem die
Werber im Rausch die Montur angezogen und das Handgeld in die Tasche gesteckt hatten.
Der Schritt vom Amtmann zum Aufklärer ist daher nur unter dem Eindruck der ungeheuerlichen Erfahrungen und Einwirkungen möglich:
»Du Fürst hast nicht, bei Egg' und Pflug,
Hast nicht den Erntetag durchschwitzt.
Mein, mein ist Fleiß und Brot!«
Eine Bürde, die Zentner wiegt. Eine Rolle, die ihn trägt. Ein Aufklärer, schlimmer, ein
betroffener engagierter Ankläger sozialer Mißstände, unbeeindruckt von der Warnung Boies: »... daß du Verse machst, ist das allerschlimmste«!
[S. 191] Daß sich hinter den »rohen Schreien eines ungebildeten
Magisters« nur die entwaffnende Naivität und die erotisch-sinnliche Natur Bürgers verbargen, wurde, wenn überhaupt, nur zögernd zur Kenntnis genommen.
So wird Bürgers Dichtung geschrieben an die
»Menschengesichter« (wie eines seiner schönsten Gedichte heißt) ein glaubwürdiges Zeugnis dafür, daß im unvermeidlichen Wechselspiel zwischen erdrosselten Träumen und verlorenen Illusionen das Entsetzliche neben dem
Schönen und das Komische neben dem Schauerlichen in Liedern, Gedichten und Balladen der genauen Schilderung seiner und seiner Zeit Wirklichkeit entspricht. Dichtung, die, wie könnte es anders sein, vom
aussichtslosen, verzehrenden Lebenskampf erzählt, vom unerhörten Willen, mündig zu werden oder zur Mündigkeit zu erziehen und vom gefährlichsten Abenteuer seines Lebens, der Liebe: dieses höchste Glück, diesen
grausamsten Schmerz.
[S. 194] Durch seinen Briefwechsel mit einigen Mitgliedern des Hainbundes gleichfalls auf »ewige« Freundschaft eingeschworen, teilt Bürger mit ihnen weder den überschwenglichen
Klopstock-Kult noch die rigorose Ablehnung des weltoffneren, freisinnigen Wieland. Tugend, Patriotismus (nicht selten nationalistisch getönt) und religiöse Schwärmerei, auf die Fahne des Hainbundes geschrieben,
fördern seine skeptische Zurückhaltung.
Den aus romantischem und antifeudalem Geist entsprungenen Tyrannenhaß der Stolberg-Bruder empfindet der realistischer und geschichtsbewußter denkende Bürger ganz
einfach als gekünstelt. [...] Über diese Grenzen stößt Bürger hinaus. Er erkennt: Wo »nacktärsige Poetenknaben« in harmonischen Idyllen schwelgen, ist keine Kunst für das Volk möglich, ja, sie ist überhaupt ohne den
bewußten Rückgriff auf Volksmythologie und Volkslied undenkbar. Sie muß »voll des lebendigen Geistes« und »im vollem Kreis des Volkes entsprungen« und »unter ihm lebend und würkend« (Herder) in erster Linie dort zu
Hause sein, woher sie kommt: in den Hütten. Mit dieser Erkenntnis ist die Annäherung an Goethe und Herder erreicht.
[S. 197] Die Erwartungen nicht erfüllen, die Freundschaften nicht ausfüllen, sich der
Ordnung nicht fügen; das sind die Bedingungen, unter denen er lebt! Trotzdem: daß ein »Genie sich erst dort erweist, wo etwas Ungeahntes erscheint, etwas wirklich gemacht wird, wovon man vorher keine Ahnung hatte«,
wie es Thomas Mann in seiner »Rede über Lessing« formuliert, dafür kommen die Balladen und besonders auch jene Briefe, die Bürger während der Zeit des Entstehens der »Lenore« schrieb, jederzeit auf!
Als
ein zentrales Ereignis im Leben Bürgers sind sie der Ausdruck eines freien, unabhängigen und stolzen Geistes, der sein ästhetisches und poetisches Programm wie beiläufig darlegt. Durch sie hindurch zieht ein
starker, in dieser Form nicht wieder zu beobachtender unverwechselbarer Bürgerscher Lebenswille.
Als unbestechliche Dokumente (humorvoll, ironisch) gewähren sie Einblick in sein poetisches Schaffen, wobei
sie die Grenzen seiner Möglichkeiten so unverfälscht aufzeichnen wie die Risse, die durch ihn und durch seine Zeit hindurchgehen!
[S. 199] In der bedrückenden und engherzigen Atmosphäre Göttingens zerbricht
sein Wille, schreiben, um leben zu können, und umgekehrt! Nicht anders kann sein zeitweise völlig gebrochenes Selbstverständnis als Dichter gedeutet werden, da er die »Macbeth«-Übersetzung oder den »Münchhausen« an
seinen Verleger Dieterich abtritt, ohne einen roten Heller dafür zu erhalten.
So weit gehen Freundschaften nicht! Und so freundschaftlich - trotz des manchmal rauhen oder gar herzlichen Tonfalls in ihren
Briefen - war das Verhältnis nicht.
[S. 201] Im Sommer 1793 schreibt Bürger an Goeckingk: »Wahrlich kein Liebes Abenteuer hat je mein ganzes Wesen so sehr in sich hinein verstrickt, als das gegenwärtige
grosse Weltabenteuer, von welchem ich keinen Ausgang sehen, ja nicht einmal zu ahnden im Stande bin.«
Das große Weltabenteuer: die Französische Revolution!
Ungewöhnlich, hätte er geschwiegen! Er
hatte nichts mehr zu verschweigen; also bekennt er offen, wohin er in Zukunft gehört - mit unerhört spitzen, zeit-und personengebundenen Epigrammen, aufwieglerischen Gedichten und jener erst nach seinem Tod
veröffentlichten Freimaurerrede »Ermunterung zur Freiheit«."
Widdels Versuch einer Annäherung in der ONLINE-BIBLIOTHEK
|
|
1983
|
Müller-Seidel, Walter. Schillers Kontroverse mit Bürger und ihr geschichtlicher Sinn.
In: Die Geschichtlichkeit der deutschen Klassik. Literatur und Denkformen um 1800. (Erstmals erschien dieser Aufsatz 1964 in: Formenwandel. Festschrift zum 65. Geburtstag von Paul Böckmann)
"[S. 87] Heute stehen wir indessen der Lyrik Schillers verständnisvoller gegenüber, weil die sogenannte
Erlebnislyrik nicht mehr unbestritten gilt. Auch ihrer Theorie, soweit es sie gibt, folgen wir nicht mehr unbedingt. Während aber solche und andere Revisionen der Lyrik Schillers zugute kamen, hat man seine Theorie
der Lyrik nur zögernd revidiert. Die Rezension der Gedichte Bürgers, die 1791 in der Allgemeinen LiteraturZeitung erschien, ist der bedeutendste Teil dieser Theorie.
[S. 88] Zur Not kann sich die These von
der Selbstkritik Schillers auf einen beiläufigen Satz in der Abhandlung selbst berufen, wenn dort gesagt wird: »aber wir entdecken bei dieser Gelegenheit an uns selbst, wie wenig dergleichen Matadorstücke der Jugend
die Prüfung eines männlichen Geschmacks aushalten«. Das ist eigentlich auch der einzige Beleg für die Behauptung vom Selbstgericht des Rezensenten, die man in der Schillerliteratur mit erstaunlicher Beharrlichkeit
wiederholt. Benno von Wiese hat sie neuerdings mit vollem Recht in Frage gestellt und bemerkt, daß sie der näheren Überprüfung bedürfe, »da sie sich aus den vorhandenen Zeugnissen kaum belegen läßt«. Eine
Überprüfung der These von der Kritik Schillers als einer Selbstkritik seiner Jugendlyrik kann aber kaum besser als dadurch erfolgen, daß man die Grundgedanken der Rezension herausarbeitet. Es wird sich dabei von
selbst erweisen, daß diesen Grundgedanken eine Bedeutung zukommt, die vieles als nebensächlich erscheinen läßt, was man bisher als die Hauptsache angesehen hat.
[S.89] Der Anlaß der Rezension liegt im
Zeitbewußtsein Schillers, in seinem historischen Sinn. Vorzüglich aus diesem Grund kommt der Abhandlung über Bürgers Gedichte eine so hervorragende Bedeutung zu. Sie darf durch Nebensächlichkeiten nicht verdeckt
werden, wie es zumeist geschieht und geschehen ist. [...] Das Zeitalter des jungen Goethe, Herders und Bürgers war ein philosophierendes Zeitalter nicht im gleichen Maße gewesen, als welches es sich jetzt, um 1790
darstellt. Schiller ist sich solcher Veränderungen in der Zeitlage deutlich bewußt. Er bezieht das nunmehr vorhandene Übergewicht der Philosophie in sein Denken ein. Aber er ist darum nicht bereit, die Poesie
einfach dem philosophierenden Zeitalter zu überantworten. Er ist ebensowenig geneigt, den Verfall der lyrischen Dichtkunst hinzunehmen, wie er sich in den jährlichen Almanachen und Gesellschaftsgesängen bezeugt.
Vielmehr gewahrt er eine verhängnisvolle Isolierung hier wie dort. Verhängnisvoll ist die Isolierung der Geisteskräfte , die sich ausschließlich in den Dienst des strengen Denkens stellen. Aber verhängnisvoll nicht
minder ist die lyrische Poesie, die den Anspruch des philosophierenden Zeitalters nicht zur Kenntnis nimmt. Eine derartige Isolierung der Dichtung vom Geist der Zeit ist um so bedauerlicher, als die Poesie allein es
ist, die eine Einheit des Getrennten herbeiführen könnte; und in der Einheit des Getrennten erkennt Schiller die »Forderung des Tages«, die nur gelingen kann, wenn die Lyrik nicht bleibt, wie sie ist: »Dazu aber
würde erfordert, daß sie selbst mit dem Zeitalter fortschritte, dem sie diesen wichtigen Dienst leisten soll«. Man hat allen Anlaß, über den zitierten Satz nachzudenken. Er hört sich eigentlich wie eine Provokation
in unserem Lande an, in dem die Lyrik so gern als etwas schlechterdings Zeitloses angesehen wird: als eine der Zeit entrückte Kunst, die es nicht nötig hat, sich mit der Wirklichkeit des Lebens einzulassen.
[S. 91] Die um 1790 für Schiller unerläßliche Erneuerung der Literatur und zumal der Lyrik ist der eigentliche Ausgangspunkt seiner Überlegungen. Und diesem Gedanken kommt von der Sache her eine so fraglose Bedeutung zu, daß alle bloß auf die persönlichen Verhältnisse Bürgers bezogenen Darstellungen wie ein veralteter Biographismus anmuten, der nicht zur Sache gehört.
[S. 92] Schiller aber dachte in seiner Abhandlung über Bürger an einen Dichter, der dem philosophierenden Zeitalter gewachsen ist. Dieser Dichter ist Bürger nie gewesen, und natürlich ist ihm nicht zum
Vorwurf zu machen, daß er es nicht war. Auch Bürger hat ein Anrecht auf seine Individualität, die es zu verstehen gilt. Er hat wie andere ein Anrecht darauf, daß man seinem eigenen Stil gerecht wird. Wenn sich
indessen der eigene Stil überlebt hat, wird die Individualität zur privaten Individualität, die zur Kritik herausfordert - wie es hier geschieht. Dabei sollte man den Dichter nicht ganz so unbesehen überschätzen,
wie es üblich ist, wenn man ihn gegen Schiller verteidigt. Es gibt in Bürgers Lyrik sehr viel Unvollkommenes und Unfertiges, und es fällt nicht einmal leicht, die vollkommenen Gedichte zu bezeichnen, die man ohne
Vorbehalt in unsere beliebten Blütenlesen aufnehmen darf - in jene, die bemüht sind, jeweils das Beste vom Besten zu bringen. Das trifft in erster Linie für die reine Lyrik zu, aber mit der Ballade verhält es sich
nicht wesentlich anders. In einer Auswahl aus neuerer Zeit ist einzig die Lenore vertreten, und wer eine derart bescheidene Auswahl ungerecht findet, muß begründen, warum er anderes vermißt. Die guten Gedichte
Bürgers sind nicht so zahlreich, wie diejenigen vorgeben, die den großen Dichter manchmal mit allzu bewegten Worten vor dem abstrakten Theoretiker in Schutz nehmen - als sei Theorie eine Sünde wider den Geist der
Poesie.
[S. 93] Das veränderte philosophische Klima ist, mit anderen Worten, der Horizont, von dem aus die Grundgedanken Schillers erst angemessen zu erläutern sind. Sicher der wichtigste dieser Grundgedanken
ist das Problem der Volkstümlichkeit, das die Rezension eingehend erörtert. Abermals geht es um den Sinn des Ganzen, von dem aus das Einzelne zu erfassen ist. Auch das Problem der Volkstümlichkeit sieht Schiller im
Horizont des Ganzen. Er sieht es nicht isoliert, sondern im Zusammenhang seines Zeitbewußtseins und seines historischen Denkens. [...] »Alle Poesie soll volksmäßig sein, denn das ist das Siegel ihrer
Vollkommenheit.« Neu sind diese Gedanken nicht. Auch damals, in der Epoche des Sturm und Drang, waren sie es nicht mehr. Sie sind bestes Gedankengut Herders. Neu ist allenfalls die Einseitigkeit, mit der Bürger
bestimmte Anschauungen Herders forciert. Herders Differenzierungen sind stets bemerkenswert, und Besonnenheit ist nicht zufällig ein zentraler Begriff seiner Abhandlung über den Ursprung der Sprache. Auch Begriffe
wie Volkslied und Volkstümlichkeit bleiben bei Herder vielschichtig genug. Demgegenüber hat Bürger das Volkstümliche als das für Herder Unverbrauchte zur bloßen Popularität verengt. Er hat die Idee der
Volkstümlichkeit mit seiner Vorstellung von Popularität vulgarisiert. Man kann die derart vulgarisierte Idee nicht so unbesehen gegenüber Schiller verteidigen. Oder ist man wirklich allen Ernstes gewillt, eine
solche im Ansatz sinnvolle, aber in der Übertreibung bedenkliche Popularitätstheorie ernst zu nehmen?
[S.94] Der Volksbegriff war um 1770 von Voraussetzungen her zu interpretieren, die Schiller nicht mehr für
gegeben erachtet. Der Begriff hat sich kompliziert. Auch die Idee der Volkstümlichkeit ist dem Wandel der Verhältnisse unterworfen. Sie kann nicht ohne weiteres aus der Ästhetik des Sturm und Drang übernommen
werden, sondern ist neu zu durchdenken wie andere Ideen auch. Um eine solche Erneuerung ist Schiller bemüht. Bürger möchte das Volkstümliche isoliert und von aller Philosophie getrennt verwirklicht sehen. Er will,
daß die Dichtung auch von den Einfachsten verstanden wird. Eben damit isoliert er sie von den Gebildeten und vom Geist der Zeit. Schiller ist demgegenüber weit entfernt, die Dichtung nur als eine Sache der
Gebildeten zu betrachten. Er redet keiner Esoterik das Wort, wenn er vom gebildeten Dichter spricht. Aber er will die Bildung als etwas, das auch denen offensteht, die sich darum bemühen. Und Bildung ist in
Deutschland um 1790 der zentrale Gedanke in Dichtung und Philosophie. Sie erweist sich in der Epoche der deutschen Klassik mehr und mehr als die eigentliche Antwort auf das Ereignis in Frankreich. Die
Zeitbezogenheit in Schillers Begriff der Volkstümlichkeit ist jedenfalls offenkundig.
[S. 95] Es kann für Schiller nur darum gehen, die Kluft zu schließen, die den Gebildeten vom Ungebildeten trennt. Auch das
liegt in der Idee der Totalität beschlossen, die sein Denken bestimmt. Aber zu erreichen ist die erstrebte Totalität nicht dadurch, daß man dem Gebildeten eine neue Schäferwelt des »einfachen Lebens« empfiehlt. Die
Aufgabe der Dichtung beruht für Schiller nicht darin, daß sie sich zum Volk hinabbegibt, sondern daß sie es zu sich heraufzieht, und dieser Aufgabe wird Bürger nicht gerecht: »Hr. B(ürger) vermischt sich nicht
selten mit dem Volk, zu dem er sich nur herablassen sollte, und anstatt es scherzend und spielend zu sich hinaufzuziehen, gefällt es ihm oft, sich ihm gleich zu machen.«
[S. 96] Schiller denkt an den
gebildeten Mann seiner Zeit, der seinerseits einen gebildeten Dichter erwartet. Der gebildete Mann und der gebildete Dichter müssen im Intellektuellen und Sittlichen auf einer Stufe stehen. Es ist diese
Bewußtseinsstufe, an die Schiller denkt, wenn er Bildung sagt.
[S.98] Schiller bezieht das Individuelle noch bestimmter auf ein Allgemeines, wenn er sagt, daß es dem Dichter zukomme, »das Individuelle und
Lokale zum Allgemeinen zu erheben.« Der gebildete Dichter als ein Dichter der geläuterten Individualität ist also nicht einfach der Dichter einer nur individuellen Bildung. Schiller zielt auf eine bestimmte
Individualität. In ihr stimmt das Individuelle mit dem Allgemeinen überein; und im Allgemeinen sind die Erfahrungen und »Vernunftschätze« enthalten, die die Menschheit aufgehäuft hat. Die ganze Weisheit der Zeit ist
im Begriff der Individualität enthalten.
[S. 99] Schiller sieht um 1790 die lyrische Poesie in mehrfacher Hinsicht bedroht, und er sucht die gebotene Bewältigung nicht mehr in der Unmittelbarkeit, sondern in
den Formen der Distanz. Auch das ist, möchte man sagen, schon ganz in der Richtung auf die moderne Lyrik hin gedacht. [...] Gegenüber einer Gesellschaftskunst, die allen unmittelbaren Lebens ermangelte, wirkte die
neue Lyrik um 1770 wie eine einzigartige Befreiung von Zwang und Schablone. Nunmehr treten gewisse Gefährdungen deutlicher hervor, die von Anfang an in ihr angelegt sind. Die Annäherung an das Leben wird wie im
Falle Bürgers sichtbar als künstlerischer Verlust. Sie wird sichtbar als ein nicht mehr Geformtes; denn man kann gerade aus diesem Grund unmöglich alles das als Lyrik gelten lassen, was Bürger mit dieser Sammlung
seinen Zeitgenossen übergab. Man kann nicht so unbesehen hinnehmen, was Schiller an einem Gedicht wie der Elegie, als Molly sich losreißen wollte getadelt hat.
[S. 100] Bürger tilgt nicht selten den letzten
Erdenrest von Abstand in seinen Gedichten. Er läßt damit die Abstandlosigkeit und Unmittelbarkeit ins Ungestaltete entgleiten. Dabei ist die Unmittelbarkeit des lyrischen Ich ein durchaus legitimes Stilprinzip. Sie
ist es seit dem Sturm und Drang, und Bürger fährt fort, sich dieses Prinzips zu bedienen. Aber legitim ist es eigentlich nur, wenn man es nicht bis zum äußersten befolgt, wenn man das Unmittelbare nur als das fast
Unmittelbare versteht. Das in jedem Punkt unmittelbare Leben ist noch keine Kunst. Ein gewisser Abstand ist unerläßlich. Er ist es dann erst recht, wenn die Wiedergabe unmittelbaren Ausdrucks von Schmerz und
Verzweiflung gefordert ist.
[S. 101] Die Gedichte des berühmten Balladenjahrs, die klassischen Balladen Goethes und Schillers, sind dagegen nicht gleichermaßen unmittelbar wie vordem. Auch der Abstand zur
Ballade, im spielerischen Umgang mit ihr und in der Erprobung der Gattung zu artistischen Zwecken, deuten darauf hin. Überdies hat Schiller mit seinen eigenen Balladen auf eine eigentlich bewundernswerte Art
geleistet, was er in der Rezension an Volkstümlichkeit gefordert hat: eine solche nämlich, die das einfache Gemüt beschäftigt und den anspruchsvollen Geist obendrein. Mit seinen schon fast fragwürdig populären
Balladen bewährt er sich als das große Talent, dem es gegeben ist, »mit den Resultaten des Tiefsinns zu spielen, den Gedanken von der Form los zu machen«, wie es in der Abhandlung über Bürger gefordert wird. Das
alles nimmt die große Abhandlung von 1791 vorweg. Sie nimmt die Lyrik vorweg, die sich bei allen Unterschieden im einzelnen als eine in der Situation der Zeit angelegte Lyrik bezeugt.
[S. 103] So völlig
eindeutig hebt sich Bürger im ganzen gegenüber Matthisson nicht heraus. Ganz unbestritten vermag sich Bürger als»Vollblutlyriker« nicht zu behaupten, wie er im Eifer des Gefechts bezeichnet worden ist. Und
Matthisson ist zum andern nicht so indiskutabel, wie es die Konvention überliefert, Noch fehlt eine befriedigende Monographie seines Wirkens. Doch dürfen wir aufgrund sehr verschiedener Zeugnisse wohl annehmen, daß
man am Ende des Jahrhunderts viele Hoffnungen auf ihn setzte.
Müller-Seidels Beitrag zur Kontroverse Schiller-Bürger in der ONLINE-BIBLIOTHEK
|
|
1983
|
Tarnói, László. Verbotene Lieder und ihre Varianten auf fliegenden Blättern um 1800. Budapest.
“[S. 24] Von den deutsche Dichtern waren um 1800 auf fliegenden Blättern Christian Felix Weiße und Gottfried August Bürger gewiß am stärksten vertreten. [...] Überhaupt bediente man
sich mit besonderer Vorliebe der Ariendichtung der Singspiele und Opern, sie kamen nämlich den Leserinteressen besonders entgegen: einerseits waren ihre inhaltlichen Motive und formalen Eigenheiten der tradierten
und bereits allgemein rezipierten aufgeklärten Dichtung verpflichtet, andererseits wurde ihre Beliebtheit auch dadurch gefördert, daß man mit Stoff und Melodie dieser Arien durch die wiederholten Bühnenaufführungen
weit und breit vertraut war. Deshalb begegnet man auf fliegenden Blättern um die Jahrhundertwende immer wieder auch den Zauberflötenarien von E. Schikaneder, unter ihnen vor allem den lustigen Papagenoliedern. Von
G.A. Bürger veröffentlichte man in Flugblattheftchen vor allem Gedichte wie ´Hurre; hurre, hurre...´, ´Lenore fuhr ums Morgenrot´, ´Im Garten des Pfarrers von Taubenhain', ´Ich war wohl recht ein Springinsfeld´,
´Ein Ritter ritt wohl in den Krieg´ u.a. “
|
|
1984
|
Nikogda, Anele. Ein Plebejer “con amore”. G. A. Bürgers Ballade “Leonardo und Blandine”.
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Wilhelm-Pieck-Universität Rostock, Gesellschaftswissenschaftliche Reihe, Heft 7, S. 2-6
"[S. 2] Gemessen am klassizistischen Formbegriff, erscheint G. A. Bürger (wie übrigens auch Jean Paul, Hölderlin, Kleist) als formlos. In einem Brief an Goethe bezeichnet Schiller
auch ´diese Schmids, diese Richters, diese Hölderlins´ als subjektivistisch, überspannt und einseitig und fragt, ob es vielleicht an der ´Opposition der empirischen Welt, in der sie leben´ liegen möge. Aus der
´Opposition der empiriscben Welt´, in der Bürger lebt, läßt sich schwerlich die von Schiller geforderte ´spannungsvolle Polarität des Schönen in Gestalt der schmelzenden und der energischen Schönheit´ herleiten.
[...]
In derselben Zeit empfindet Jean Paul Schiller als zur Person gewordene klassizistische Kunstauffassung, in seiner Überbewertung des Ästhetischen sei Schiller nicht nur gegenwarts- und
wirklichkeits-, sondern auch menschenfeindlich. [...]
Trotz Schillers Versuch, Bürger den Rang des Volksdichters abzusprechen, gilt er jedoch als Volksdichter. So sah er sich selbst auch, Er ist
auch als durchaus formbewußter Schriftsteller bekannt. Der in den theoretischen Schriften Bürgers wie auch in der poetischen Struktur seines Werkes realisierte Begriff der Universalität der Volkpoesie entspricht dem
Geist des Zeitalters der bürgerlichen Revolution, Die Tendenz der Volkstümlichkeit prägte bekanntlich den literarischen Prozeß der siebziger Jahre des
18. Jahrhunderts. [...] Seine Ballade ´Lenardo und Blandine´
hat eine für ihre Zeit eigentümliche Sprachkonvenienz - sie setzt als ´literarisches Publikum´ Bürger und Bauer voraus. ´Popularität der Poesie´ erscheint Bürger als eine Möglichkeit der bewußten Verwirklichung
eines plebejischen Demokratismus, der mit der Idee des Nationalen schon verknüpft ist. [...]
Die sozialkritischen Dimensionen des Sturm und Drang zeigen ihren Realismus bekanntlich in der Art, wie das
Schicksal der nichtprivilegierten Stände als literarischer Gegenstand eingebracht wird, auch in der Art, wie es auf Wirkung beim Leser zielend verarbeitet wird. Gewonnen wird eine neue ästhetische und ethische
Dimension. Bürgers stilistische Volksverbundenheit äußert sich als Interesse für das Volkslied, die Ballade, den Bänkelsang, das Volksbuch. das Marionettentheater, die Legende, Sage usw. In Homer, Shakespeare,
Ossian sieht Bürger die größten Volksdichter aller Zeiten,
[S. 3] Bürger, der sich in einem Brief einen ´Plebejer con amore´ nannte, setzt sich für ´die Popularität der Poesie´ ein, er versucht sie sowohl
praktisch als auch theoretisch zu begründen, Das setzt Interesse für die von der gelehrten Aufklärung lange mit Distanz betrachteten volkstümlichen literarischen Formen voraus. So sind das ästhetische Gesetz und
Urteil bei Bürger völlig antiklassizistisch.
In Bürgers Ballade ´Lenardo und Blandine´ finden sich Berührungspunkte zwischen den Stücken Shakespeares und dem komischen Volkstheater, von denen Herder in
seinem Shakespeare-Aufsatz spricht. Bürger bietet hier also dem Leser eine Art von ´mikrokosmischem Drama´ (Goethe).
Die Formelemente dieser Ballade lassen sich durch ihre Affinität zum Volksdrama oder zum
Marionettentheater, aber auch durch die Affinität zum Sturm-und-Drang-Drama erklären ´Die Personen sprechen (hier) nicht, sondern werden gesprochen´. Die Ballade ist auf die Darstellung pathetischer Charaktere und
pathetischer Situationen konzentriert. Die Charaktere werden hier, wie im Marionettentheater grotesk, manchmal auch parodistisch wiedergegeben, Wie in einem Volksmärchen oder in einer Volksballade ist hier Blandine
nur eine idealisierte Prinzessin. Sie ist eine recht abstrakt konzipierte Verkörperung der Leidenschaft. Der König ist in dieser Ballade nur ein zärtlicher Valer, ein idealisierter König der Folklore. [...]
Die stilistische Eigenart der Bürgerschen Ballade macht unserer Meinung nach die Dominanz von ästhetischen Formen, die für die Tradition der plebejischen Kultur charakteristisch sind, aus. Bürgers
stilistische Volksverbundenheit findet ihren Ausdruck im Interesse für das Volkslied, das Volksbuch, den Bänkelsang, das Volkstheater, das Puppentheater, den Schwank usw Die Poetik der Ballade, des Volksliedes
enthält nach Bürger ´das ganze unermeßliche Gebiet der Phantasie und Empfindung´. Sein Verständnis des Volksliedes ist jedoch spezifisch, die Grenze zwischen dem Volkslied, dem Bänkelsang, der Romanze ist bei ihm
recht unbestimmt. Er hat Gedichte geschrieben, die den naiven Witz und die Poesie des deutschen Volksliedes imitieren, aber der Einfluß des Bänkelsangs ist bei ihm im allgemeinen viel größer. [...] Die Ästhetik des
Bänkelsangs ist aus den Gedichten Bürgers nicht wegzudenken. Helden und Leidenschaften erscheinen bei ihm in einer recht großen Übertreibung. Die Forderung nach Anschaulichkeit, Lebendigkeit ist in seinen Balladen
in allen darstellenden Aspekten realisiert - visuel, motorisch, akustisch. In manchen Gedichten Bürgers empfindet man als Stiltendenz eine barocke Massivität.
Zur Poetik des Bänkelsangs gehören auch
Erschütterung und Dynamik der Leidenschaften (´Lenore´, ´Leonardo und Blandine´, ´Der wilde Jüger´), ein geschärftes Gefühl für künstlerische Fiktion.
Der Genuß von einigermaßen ritualisierten Handlungen
gehört ebenfalls zur Ästhetik des Bänkelsangs, auch der der Volksbilderbögen, des Jahrmarkttheaters, der Volksbücher. Dieser Einfluß wird gewöhnlich als nur ein negatives Charakteristikum der Bürgerschen Balladen
bewertet. [...] Die Rezeption des Bänkelsangs bei Bürger gehört unserer Meinung nach in den Zusammenhang des ´anderen Theaters´ (R. Münz), daher seine Anschaulichkeit, seine dem Volkstheater nahe Szenerie und
Diktion, alles handfest Theatralische.
[S. 4] Die Art und Weise, wie der Bänkelsang in der ästhetischen Struktur eines Bürgerschen Werkes reflektiert wird, ermöglicht es, ihn mit dem Volkstheater
gleichzusetzen. Die Grenzen zwischen dem Volkstheater und Bänkelsang sind recht relativ, wovon Puschkins Definition des Volkstheathers zeugt: [...] Wir wissen, daß der Phantasie und Kraft in Bürgers Vorstellungen
vom Dichter eine programmatische Bedeutung zukommt. Das Bürgersche Stilprinzip der Unmittelbarkeit findet seine Entsprechung im Stegreifcharakter des Volkstheaters, Bürgers ästhetisches Programm setzt ´Energie des
Gefühls´, maximale Lebendigkeit, Ausdruckskraft und Volkstümlichkeit der Poesie voraus, Bänkelsang ist ihm in diesem Sinne ebenfalls Volkspoesie,
Die Rezeption des Bänkelsangs hing weitgehend schon im 18.
Jahrhundert von der Weltanschauung des Autors ab. Gleim sieht bekanntlich im Bänkelsang nur eine Möglichkeit des Amüsements für das gebildete Publikum, Der stilistische Einfluß des Bänkelsangs findet seine
Widerspiegelung in der ästhetischen Struktur von ´Lenardo und Blandine´ als Dynamik der Handlung, deren innere Dramatik, das Grelle, Bunte in der Farbgebung und den Charakteren nach den ästhetischen Normen der
Volkskunst.
Die Ballade lebt von lauter theatralischen Effekten und Affekten, Ihre Struktur ist der eines Volksdramas ähnlich - es gibt hier eine Liebesszene, eine verräterische Mordtat, eine Szene des
Wahnsinns und den Tod als Sühne.
[S. 5] Bürgers Stilideal des starken, großen, des ´hohen Affekts´ findet eine höchst adäquate Entsprechung im Marionettentheater. Es ist bekannt, daß Bürgers Ballade ´Des
Pastors Tochter von Taubenhain ´ auch im 19. Jahrhundert noch als ein Puppentheaterstück gespielt wurde. (Auch Kleist geht der Frage nach, wie der Schriftsteller aus dem Mechanismus des Marionettentheaters
theoretische Erkenntnisse ableiten und praktischen Nutzen ziehen könnte.) [...]
Der Autor gestaltet seine Personen wie im Volksdrama auf Grundlage einer Charaktereigenschaft, verallgemeinerte
psychologische Züge werden mit der ethischen Wertschätzung der Helden, die entweder positiv oder negativ sind, verknüpft. [...]
Anakreontik und Sentimentalismus bieten Bürger solche
Stilmöglichkeiten, die eine im Vergleich zur Folklore nuanciertere Darstellung von Charakteren ermöglichen. Die Konzeption des Poetischen, wie sie in der ästhetischen Struktur der Bürgerschen Balladen enthalten ist,
war von einem besonderen Interesse für die slawischen Literaturen, Bürgers Dramatismus, ´die lebendige Gegenwart der Bilder, der Zusammenhang und gleichsam Notdrang des Inhalts, der Empfindungen´, seine ´energische
Einfachheit´ (Puschkin) lieferten für andere nationale Literaturen eine für die Entwicklung der eigenen originellen Konzeption des Poetischen produktive ästhetische Erfahrung,
[S. 6] G. A. Bürgers Interesse
für die künstlerischen Leistungen der plebejischen Kultur ermöglichte es ihm, zu neuen historischen und sozialen Erfahrungen zu gelangen. Seine Gedanken über die ´Popularität der Volkspoesie´ fanden ihre
stilistische Entsprechung in der ästhetischen Struktur seiner Balladen. Der Kult der Volkspoesie, wie wir ihn bei Bürger finden, kennzeichnet sich durch einen breiten Demokratismus. Bürger begründete in seinem
Schaffen eine demokratische Konzeption der Volkstümlichkeit. Es geht ihm um eine breit ausfächernde Kunst, es geht ihm um Mischformen. In ihnen sind ausgewiesen ein neues Bild der Zeit, die geistigen Beweggründe der
Zeit, die neu aufkommende Sehweise sowie die zunehmende Dominanz realistischer Positionen.”
Nikogdas Beitrag in der ONLINE-BIBLIOTHEK
|
|
1984
|
Eichstädt, Heinrich Karl Abraham. Rede über Friedrich Schiller am 7. September 1839, aus dem Lateinischen übersetzt von Manfred Simon. In: Schillers Erbe in Jena, Hg. Volker Wahl
“[S. 70] Vornehmlich pflegte er den Teil der Philosophie, den die Alten den mittleren nannten, der sich auf die Erkenntnis bezieht ; mit ihm verband er die davon abhängige Lehre vom
Schönen, um nach sogenannten ästhetischen Gesetzen seine eigenen Werke komponieren und fremde beurteilen zu können. Zeugen dieses Studiums sind zahlreiche Betrachtungen, die dem Journal eingefügt sind, dem er
zusammen mit Goethe den Titel ´Horen´ gab. Ein sehr bekanntes Zeugnis ist auch jene Gedichtrezension von Bürger, die viele damals als zu scharf tadelten. Schillers Anliegen aber war es, die Poesie, die durch Bürgers
spielerische Manier gewissermaßen aus ihrem Reich vertrieben war, in ihre alte Würde wieder einzusetzen.”
Eichstädts Rede in der ONLINE-BIBLIOTHEK
|
|
1986
|
Hinderer, Walter. Die projizierte Kontroverse: Text und Kontext von Schillers Bürger-Kritik. In: Formen und Formgeschichte des Streitens. Der Literaturstreit.
“[S. 181] Die Kontroverse zwischen Schiller und Bürger galt nicht nur zwei verschiedenen Kunstprogrammen und Kulturen, der Auseinandersetzung zwischen der Ästhetik des Sturm und Drang
und der Klassik, der populären und der elitären Kultur, sondern auch der bis heute nicht zur Ruhe gekommenen Fehde zwischen Kunst und Philosophie, Literatur und Kritik. Obwohl der Argumentationsrahmen der berühmten
Kontroverse inzwischen nach Für und Wider abgemessen und die Fehde in der Forschung öfters negativ gegen als positiv für Schiller entschieden worden ist, scheint man in der bisherigen Diskussion einen Aspekt
vernachlässigt zu haben, der beweisen könnte, daß SchilIers Bürger-Kritik vornehmlich das Ergebnis einer eigenen ästhetischen Umorientierung und Disziplinierung darstellt, die er zu einem großen Teil den ebenso
freundschaftlichen wie kritischen Bemühungen Christoph Martin Wie lands verdankt. [...] Die philosophischen Grundsätze, die Schiller nach diesem kritischen Selbstverständnis entwickelt, haben allerdings mehr mit der
Entwicklung seiner ästhetischen Anthropologie als mit dem Bestimmungsversuch einer Gattung zu tun.
[S. 182] Nicht von ungefähr hält Schiller in seiner ´Verteidigung´ Bürger vor, nicht ´die Anwendung der vom
Rez. aufgestellten Grundsätze´ in Zweifel gezogen zu haben. Wenn er auch eingangs selbstbewußt als Strategie seiner Kritik nennt: ´Die Rede ist von Grundsätzen des Geschmacks und deren Anwendung auf Hn. Bürgers
Produkte´, so scheint ihm doch später bewußt geworden zu sein, daß bei seinem kritischen Diskurs gerade die Applikation der Grundsätze eine Achillesferse darstellte, auf die Bürger in seiner ´Antikritik´ mit einigem
Erfolg hätte zielen können. Im Jahr 1802 gesteht er außerdem, daß damals ´sein Gefühl ... richtiger´ war ´als sein Raissonnement´ und daß er heute seine Meinung ´mit bündigen Beweisen unterstützen´ würde . Es kann
keine Frage sein, daß Schiller bei beiden Rezensionen in den theoretischen Entwürfen mehr überzeugt als in der kritischen Einzelanalyse, die mehr oder weniger Pauschalurteile aneinanderreiht, was damals allerdings
in der kritischen Praxis kein Ausnahmefall war. Schiller vermißt bei einem Produkt zum Beispiel die ´Übereinstimmung des Bildes mit dem Gedanken´, rügt ´die beleidigte Würde des Inhalts´, ´eine zu geistlose
Einkleidung´, einen ´ins Platte fallenden Ausdruck´, einen ´unnützen Wortprunk´, einen ´unechten Reim und harten Vers´, moniert ´Cruditäten´, den ´gemeinsinnlichen Charakter´ von Bürgers Muse, kritisiert die
´Tändelei´ und fragt sich besorgt, ´wie es möglich war, daß sich die Begeisterung des Dichters nicht selten in die Grenzen des Wahnsinns verliert´. Man kann es Bürger, der mit Herder der Meinung war, daß nur ´ein
Genie das andere beurteilen´ kann, nicht verargen, wenn er sich über die unpräzisen Begründungen lustig machte. Er konnte außerdem mit Schillers Grundsätzen wenig anfangen, da er in einer ganz anderen Tradition
stand und eindeutig andere kritische Erwartungen besaß.
[S.184] Wieland hatte schon vor 1783 dem jungen Dramatiker schonend beigebracht, daß seine ´Räuber´ nicht ´vor dem Richterstuhl der Vernunft und des
Geschmacks bestehen´ konnten, und dem Verleger Schwan das Rezept einer richtigen ästhetischen Erziehung des wilden Talents verraten. Er wird es später, auch gegenüber Schiller, noch öfters wiederholen; es
lautet in Stichworten: Beherrschung der Einbildungskraft, Läuterung des rohen Geschmacks und Studium der ´Exemplaria Graeca´. [...] Schiller wendet solche Einsichten in seiner Kritik auf Bürger an: die
´Würde der Kunst´ verlangt ´glückliche Wahl des Stoffs und höchste Simplizität in Behandlung desselben´ und gleichermaßen die Veredelung der ´Begeisterung´ wie der ´Individualität´. Die eigene ´Individualität so
sehr als möglich zu veredeln, zur reinsten herrlichsten Menschheit hinaufzuläutern´, so ermahnt der gelehrige Schiller hier, ´ist sein erstes und wichtiges Geschäft´. Wieland hatte schon 1773 in einem Essay
prononciert als ´wahre Bestimmung´ der Dichtkunst die Verschönerung und Veredlung der menschlichen Natur´ genannt und für ´ideale Formen´ plädiert, worin er das ´allgemeine Grundgesetz der Kunst´ sah. Dieses
verschärft Schiller in seiner Bürger-Kritik an zentraler Stelle zu dem bekannten Diktum: ´Eine der ersten Erfordernisse des Dichters ist Idealisierung, Veredlung, ohne welche er aufhört, seinen Namen zu verdienen´
[S. 187] Am Ende von Schillers ästhetischen Überlegungen steht die Einsicht, daß eigentlich erst eine Synthese von naiver und sentimentalischer Dichtung in der Lage wäre, die schon in der Dissertation
geforderte ´Gottgleichheit´ , die Totalität aller menschlichen Vermögen vor Augen zu stellen und der ´menschlichen Natur ihren völligen Ausdruck zu geben´. Schiller formuliert nun als Ziel folgendes Ideal: daß in
der vollendeten Kunst der Mensch auf eine höhere Weise zur Natur zurückkehrt. Der Volksdichter Bürger und der sentimentalische Dichter Schiller hätten also im idealen Fall aus der Dissonanz zur Harmonie finden und
die diskutierte Trennung zwischen dem gebildeten und ungebildeten Publikum aufheben können. Idealisierkunst und Naturalisierkunst wären sich, wenigstens der Idee nach und im klassischen Sinne, auf dem letzten
ästhetischen Schritt doch noch nähergekommen .”
Hinderers Projizierte Kontroverse in der ONLINE-BIBLIOTHEK.
|
|
1986
|
Ueding, Gert. Von der unheilbaren Liebe als Stimulans der Poesie. Der Dichter Gottfried August Bürger. In: Die anderen Klassiker. Literarische Porträts aus zwei Jahrhunderten.
“"[S. 13] Ja: Bürger war ein Volksmann mit aufrührerischem Geist, einen Demagogen gar nannten ihn seine Feinde, weil er die menschliche Emanzipation, weil er Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit auf seine poetische Fahne geschrieben hatte. Grund
genug, daß ihn Heine mit dem Ehrentitel der Französischen Revolution, citoyen, ehrte, aber auch Grund genug, daß er verdächtig
blieb, daß
seine Kritiker über seine Popularität gesiegt haben und daß schließlich nur noch der Gemeinplatz des in sich selbst zerrissenen, unvollendeten Poeten in den Literaturgeschichten überlebte.
[S. 17] Immerhin war es keine von den ganz subalternen Stellen, mit denen sich manche seiner Freunde zufrieden geben
mußten. Der Sohn eines früh verstorbenen Pfarrers, mittellos und ohne hochgestellte Gönner,
voller Schulden aus einem liederlich-leichtsinnigen Studentenleben, konnte nicht mehr erwarten, und ein freies Schriftstellerdasein - Lessings Beispiel lehrte es - war unter den zurückgebliebenen deutschen
Verhältnissen noch nicht möglich. [...] `Lenore´ eroberte nicht nur das gebildete Lesepublikum, sondem auch die unteren Schichten des Volkes und geisterte bald in halbmündlicher Überlieferung und manch kurioser
Variation durch die Gesindestuben des Landes - durchaus zum Stolze Bürgers.
[S. 22] Mit den großen Leidenschaften bringen diese Jahre zugleich den Höhepunkt seines Schaffens, in denen seine schönsten
Liebesgedichte, seine bedeutendsten Balladen entstehen. Er gehörte unbezweifelt zu den wichtigsten und berühmtesten Dichtern unter der literarischen Jugend in Deutschland. Was nicht heißt, daß er etwa der Komödiant
seiner eigenen Lebenstragödie gewesen wäre. Die Verzweiflung, die aus seinen Briefen und Gedichten spricht, ist kein Rollenspiel, die Gewissensbisse, die er über sein Verhalten empfindet, verwirren sein ganzes
Selbstverständnis.
[S. 25] Die Liebe ist für Bürger eine Naturmacht, der sich zu widersetzen ebenso töricht wäre, wie den Lauf der Gestirne oder die Umdrehung der Erde hemmen zu wollen. Moralische oder
religiöse Einwände läßt er nicht gelten, sie sind ihm kalte Vernünftelei, die nur Unglück produziert und das Herz schwer macht.
[S. 26] Vergegenwärtigt man sich seine Lebenssituation, das Richterdasein in der
Provinz, die ´beständigen Händel und Zänkereien mit seinen Vorgesetzten, die drückenden Existenznöte, die dauernde Abhaltung von seinem eigentlichen Berufe: seinem dichterischen Werk, die Isolierung in der Provinz,
weitab von den Zentren der Kultur und Geselligkeit, schließlich die Aussichtslosigkeit seiner Hoffnung, daß dieses Dasein sich jemals grundlegend ändern könnte, so haben wir wie in einem Modell die wichtigsten
Bedingungen versammelt, die für die verbreitete Gefühlslage der jungen bürgerlichen Intelligenz in diesem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts verantwortlich sind. Bürgers Enthusiasmus, sein Schwanken zwischen den
Extremen tiefer Hoffnungslosigkeit und schwärmerischer Gefühlsinnigkeit, der vor dem Bilde der Geliebten die ganze Welt verschwendet, die Konzentration auf seine verwirrenden Liebeserfahrungen, seine erotische
Anfälligkeit, die ihn auch zu der unglücklichsten Liaison seines Lebens mit Elise Hahn inspirieren sollte - alle diese Merkmale seines Lebens dokumentieren den Versuch der Selbstverwirklichung jenseits der sozialen
und politischen Schranken.
[S. 29] Freilich, was einern Pastor Zuch oder General von Uslar als eine freimütige, allein dem Sinnengenuß dienende und daher um so ververflichere Lebensgemeinschaft vorkam, das
war viel mehr eine Quälerei zu dritt, eine gegenseitige Abhängigkeit ohne Aussicht, eine rechte Hölle zuzeiten, aus Gewissensqualen, Schwäche und Schmerz.
[S. 30] Denn die unerhörte Offenheit, mit der Bürger
in seinen lyrischen Selbstbekenntnissen seine skandalösen Liebesproblerne ausbreitete, verstieß gegen ein weiteres Tabu: daß nämlich private Unregelmäßigkeiten, sollten sie denn einmal vorkommen, unter dem Ausschluß
der Öffentlichkeit zu geschehen hätten.
[S. 32] Allein die Liebe, und zwar nicht die des gewöhnlichen, normalen Lebens, die eingeht in die nüchterne Prosa des Alltags, sondern die bizarre, verwickelte,
exorbitante Liebe, der noch zusätzlich das Flair von Konventionsbruch und moralischer Schuld anhaftet, vermochten ihn zu fesseln, nur die starke Empfindung, die heftige Unruhe des Gemüts vermittelten ihm das
Bewußtsein seiner selbst. Die Liebe zu Molly nutzte sich nicht ab, weil sie nie seßhaft werden konnte, weil der dauernde Wechsel von Glück und Unglück, Erfüllung und Verveigerung seine Gefühlswelt in dauernder
Erregung hielt. Molly starb zu früh, als daß er eine andere Erfahrung mit ihr hätte machen können.
[S. 33] Bürger hat dieses Kleinod der Lügengeschichtenliteratur, deren Tradition bis in die Antike
zurückreicht, wieder vollkommen in der deutschen Literatur eingebürgert, es ist das Buch geworden, in dem er am vollkommensten sein Ideal eines populären und doch belangvollen, eines wirksamen und doch kunstreichen
Schriftstellers verwirklichte.[...] Was ihn an diesen Geschichten faszinierte, macht ihre Wirksamkeit bis heute aus: Walter Rehm hat Münchhausen einen ´Übermenschen im kleinen´ genannt, und er ist wirklich ein
Meister der Tapferkeit und Geistesgegenwart, der jeden Zufall zu seinen Gunsten wendet, sich durch nichts düpieren läßt und mit den Mitteln der Übertreibung und Aufschneiderei die menschlichen Narrheiten und die
Torheiten seiner Zeit auf ergötzliche, oft satirisch-scharfe Weise bloßstellt. Ein Überlebenskünstler und Schelm dazu, der all das besaß, was dem unglücklichen Poeten Bürger mangelte.”
|
|
1986
|
Woodmansee, Martha. Die poetologische Debatte um Bürgers >Lenore<. In: Verlorene Klassik? Ein Symposium.
„[S. 237] In seiner >Ars Poetica< setzt Horaz den Wert eines literarischen Werkes mit dessen Wirkung gleich: das literarische Werk soll »nützen und ergetzen«. Ob das
gelingt, entscheiden die Rezipienten des Werkes, wobei sie auch seinen Wert bestimmen. In Gottfried August Bürger hat dieses Modell des literarischen Wertes vielleicht nicht seinen scharfsinnigsten oder
überzeugendsten Advokaten gefunden, sicher aber einen seiner erfolgreichsten. Geprägt von der Überzeugung des Autors, daß die Popularität eines poetischen Werkes „das Siegel seiner Vollkommenheit« sei, haben Bürgers
Gedichte eine ganze Generation deutscher Dichter inspiriert und dann, als sich Stimmen der Ablehnung erhoben, die Nordsee überquert und in der englischen Dichtung eine Revolution ausgelöst. Dem Literaturhistoriker
liefert die Analyse dieser Rezeptionsprozesse also reiches Anschauungsmaterial für den Stand des Horazischen Literaturmodells gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Im Folgenden möchte ich zwei
exemplarische Texte der Bürger-Rezeption hervorheben, die in ihrer jeweiligen Literaturtradition von epochaler Bedeutung gewesen sind und die gleichzeitig Einblick in das Kräftefeld vermitteln, dem das Horazische
Modell ausgesetzt war: Schillers Rezension von Bürgers Gedichten aus dem Jahre 1791 und William Wordsworths Entgegnung darauf, die 1800 in seinem >Preface< zu den >Lyrical Ballads< veröffentlicht wurde.
[S.249] Schiller hätte Wordsworths Art, die Horazische Dichtungstradition auch unter den radikal geänderten Bedingungen des frühen neunzehnten Jahrhunderts aufrechtzuerhalten,
wahrscheinlich für bombastisch und überholt gehalten. Umgekehrt hätte aber Wordsworth die völlige Eliminierung des Publikums als Faktor des literarischen Wertes ganz gewiß nicht für gut oder zeitgemäß befunden.“
Woodmansees poetologische Debatte in der ONLINE-BIBLIOTHEK.
|
|
1987
|
LEXIKON deutschsprachiger Schriftsteller, Von den Anfängen bis zum Ausgang des 19. Jahjrhunderts. VEB Bibliographisches Institut Leipzig
“[S. 71] B., dessen konsequent demokratisch-plebejische Haltung wie seine Begeisterung für die Frz. Revolution bekannt waren (1790 Freimaurerrede Ermunterung zur Freiheit),
fristete - ständig in materiellen Schwierigkeiten - seinen Lebensunterhalt durch Übersetzungen und als Redalteur des “Dt. Musenalmanachs” (1779/94); nach einem Hungerdasein starb er an der Schwindsucht. - B., einer
der stärksten und ursprünglichsten Lyriker des 18. Jh., löste sich schon früh von religiöser Einengung und herrschendem Tugendrigorismus (z. B. des Göttinger der Hains). Aus seiner sinnlich-realistischen
Grundhaltung resultiert die bedingungslose Hinwendung zur Wirklichkeit, vor allem in der Liebeslyrik. Frei von asketisch-moralisierenden und religiösen Tendenzen, sind B.s Molly-Lieder bekenntnishafter Ausdruck innerer Bewegtheit und wie sein Danklied (1772), das die volkstümliche Sprache protestanischer Kirchenlieder umfunktioniert, bezeichnend für Diesseitigkeit und Sinnenfreude. Aus seinen düsteren Erfahrungen der Amtmannszeit erwuchs das revolutionäre Rollengedicht Der Bauer. An seinen durchlauchtigen Tyrannen (e. 1773/75). Nach 1789 nahm B. Ideen der Frz. Revolution in seine politische Lyrik auf (Die Tode,
1792) und weitete die Entlarvung des fürstlichen Despotismus zur nationalen Aufgabe (Für wen, du gutes deutsches Volk ... , 1793). Seine überragende poetische Leistung sind volkstümliche Balladen, die - Motive des Volksliedes und der Volkssage aufgreifend und ihren sozialen Bezug meist aktualisierend - unter dem Einfluß Herders und des englischen Dichters Percy entstanden. Mit Lenore (e. 1773), Der Raubgraf (1776), [...], Der wilde Jäger (1786) u.a. schrieb B. Dichtungen, die sich durch ihren antifeudal-volksverbundenen Charakter, realistische Darstellungskraft, leidenschaftliche Anteilnahme und vollendete Technik (Spannung, Stimmungs- und Lautmalerei, erregender Rhythmus) auszeichnen. Eine überzeugende theoretische Darlegung seiner neuen dichterischen Position gelang B., der die Popularität der Kunst zur höchsten Forderung erhob (Über Volkspoesie, Aus Daniel Wunderlichs Buch,
1776), jedoch nicht. Schiller hat, ohne B.s Leistung historisch voll gerecht zu werden, in seiner kritischen Auseinandersetzung mit ihm (1791) aus der Sicht der klassischen Ästhetik eine Synthese von Popularität und
höchster Kunstvollkommenheit formuliert. B.s Wunderbare Reisen zu Wasser und zu [dieses zu gehört hier nicht hin - ist scheinbar aber nicht auszurotten; Anm. d. Red.] Lande, Feldzüge und Iustige Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen (1786, Ndr. 1981, erw. 1789), eine Satire auf den Adel, die er anhand von zwei Vorlagen in freundschaftlicher Zusammenarbeit mit Lichtenberg aus dem Engl. des Rudolf Erich Raspe (1737-1794) rückübersetzte und insgesamt um etwa ein Drittel erweiterte, wurden zu einem Volksbuch und gehören zu seinen fortlebenden poetischen Werken.”
|
|
1987
|
Häntzschel, Günter und Hiltrud. Nachwort. In: Gottfried August Bürger Sämtliche Werke, Hg. Günter und Hiltrud Häntzschel
“[S.1410] Deutlich ist also zu sehen, daß für Bürger ´Popularität´ in erster Linie ein Stil- und Ausdrucksmittel ist, mit dem er die erstarrte, regelverhaftete rationalistische Dichtung
überwinden will. Er möchte Poesie neu mit Leben, Gefühl und Leidenschaft, auch subjektiver Leidenschaft füllen. Daß er dabei inhaltlich häufig die Rechte der Unterdrückten gegenüber den Regenten und der Obrigkeit
vertritt, sich zum Anwalt des ´Volkes´ macht, ist zu betonen, sollte aber von einer naiven Bezeichnung Bürgers als ´Volksdichter´ unterschieden werden.
Daß Bürger die unteren sozialen Schichten weder
direkt als Leser ansprach noch erreichte, versteht sich schon aus den sozialgeschichtlichen Verhältnissen des 18. Jahrhunderts: Die geringe Lesefähigkeit der Bevölkerung, die Höhe der Buchpreise, die Bucherwerb und
-besitz erschwerte, die mangelnde Gelegenheit der Angehörigen der unteren sozialen Schichten, überhaupt mit Büchern in Berührung zu kommen, machten einen solchen direkten Kontakt zwischen Autor und Rezipienten
unmöglich. Im Fall Bürgers kann man aufgrund der Subskriptionsverzeichnisse, die in dieser Ausgabe erstmalig abgedruckt sind, und aufgrund des Briefwechsels konkret erkennen, daß die Verbreitung seiner Gedichte in
erster Linie durch Schriftsteller, Studenten, Akademiker und Buchhändler erfolgte, die ein Publikum gewannen, das sich weitgehend aus der Bildungsschicht rekrutierte. An der Spitze des Subskriptionsverzeichnisses,
das 1778 durch den Namen der Königin von Großbritannien eröffnet wird, stehen Regenten und hohe Standespersonen. Wie sehr die Vorstellung von einem unmittelbaren Volksdichter Fiktion ist, geht überdies daraus
hervor, daß Bürger — und das kennzeichnet seine Taktik wie seine Abhängigkeit von den Gesetzen des Buchmarktes — zunächst erwog, die Ausgabe seiner Gedichte von 1778 der Königin von Großbritannien, diejenige von
1789 Friedrich II. zu widmen. Permanente Sorgen um seine Existenz, die ja in Göttingen nach wie vor ungesichert ist -- ´ob und wie ich noch einmal aus dem verfluchten Hundenest fortkommen werde, das mag der Himmel
wissen´ — führten ihn zu dieser Überlegung. Die Dedikation kommt ihm zwar ´wie ein Wechselbalg, aus Lächerlichkeit und Niederträchtigkeit zusammengesetzt´, vor, aber er konstatiert auch nüchtern, es sei ´eine pure
Unmöglichkeit, ohne Geld edel zu sein, oder gar durch Geistes- und Herzensadel den allgemein beliebten und belobten Beuteladen zu erwerben.´ “
|
|
1987
|
Döhl, Reinhard. Bänkelsang und Dichtung / Dichtung und Bänkelsang.
Vortrag, 15.10.87 Kansai-Universität, Osaka; 24.10.87 Wochenendseminar in Sengokuso [Fukuoka], 27.10.87 Universität Kagoshima.
“Ähnlich mit der Bekanntheit einer Melodie rechnet auch der Verfasser der "Beschreibung des dreifachen Mordes, welcher am 11. März 1847 im Dorfe Östergasse im Amte Hadersleben
verübt worden ist. Nach der Melodie 'Im Garten des Pfarrers zu Taubenhain"' (18). Das führt mich zugleich zu Beispiel 2, zu Gottfried August Bürger, der wie kein zweiter Autor von Bänkelsängern und den Druckern
"Neuer Lieder", in der Regel ohne Namensnennung, geplündert wurde. In meist unzulänglicher Wiedergabe lassen sich als populärer Lieddruck nachweisen die Balladen "Die Weiber von Weinsberg",
"Bruder Graurock und die Pilgerin" und "Die Pfarrerstochter von Taubenhain". "Das Lied vom braven Mann" bildet den Beschluß eines Bänkelsängerheftchens über "Die Wassernot von
1883" und die "Lenore" schließlich wird in einem anderen Heftchen zunächst in Prosa mit zahlreichen konkreten Zeit-, Namens- und Ortszutaten 'erzählt' bis zu dem Zeitpunkt des heimkehrenden Heeres.
Als Lenore ihren Wilhelm "nicht unter den Heimgekehrten" sieht, stürzt sie "mit aufgelöstem Haar und mit Wahnsinn im Blick [...] zurück ins Schloß. Was hier nun vorging", schließt die Erzählung,
"verkündet dem Leser das nachfolgende, von unserm vortrefflichen Dichter Bürger verfaßte Lied, das in und außerhalb Deutschlands so große Berühmtheit erlangt, von allen Ständen so gern gelesen, gesprochen und
gesungen wird, und alle Gemüther tief ergriffen hat." (19)
Die Frage, was Bürger für die Bänkelsänger so handhabbar machte, ist schnell beantwortet, wenn man in Anschlag bringt, daß Bürger seinerseits
beim Bänkelsang mancherlei Anleihen gemacht hat (2O). Was gleichermaßen für Friedrich Schiller gilt (21). Dessen "Räuber" wurden nämlich ebenso von Bänkelsängern verarbeitet, wie seine Ballade von der
"Kindermörderin" auf dem Jahrmarkt gesungen wurde. Damit bin ich zugleich bei Beispiel 3. Sowohl die feindlichen Brüder (= "Die Räuber") wie die Kindsmörderin sind für die Geschichte des
Bänkelsangs durchgängig belegbare, in der Literaturgeschichte dagegen zentrale Themen des Sturm und Drang, in deren Entfaltung sich sowohl ein Archtetypus (Kain und Abel) und Generationenkonflikt (="Die
Räuber") als auch eine sich ändernde Rechts- und Moralauffassung (= Kindsmord) artikulieren. Wenn der Bänkelsang sich in der Folgezeit der literarischen Vorlagen Schillers, aber auch Bürgers (= "Die
Pfarrerstochter von Taubenhain") bedient, vernachlässigt er auffällig die "revolutionären Tendenzen" seiner Vorlagen. Damit steht aber dieses dritte (thematische) Beispiel zugleich für die kulturelle
Ungleichzeitigkeit ("cultural lag"), die sich aus den unterschiedlichen kulturellen Voraussetzungen der Adressaten ergibt. Oder anders gesehen: das dritte Beispiel belegt konkret, wie weit sich
Wirkungsgeschichte unter verschiedenen Bedingungen vom Original entfernen, den ursprünglichen Anspruch bis fast in sein Gegenteil verkehren kann.”
Anmerkungen:
18) Zit. nach Elsbeth Janda u. Fritz Nötzold (Hrsg.): Die Moritat vom Bänkelsang oder Das Lied der Straße.
München: Ehrenwirth 1959, S. 117.
19) Zit. nach Hans Adolf Neunzig: Das illustrirte [sic] Moritaten-Lesebuch. München: Nymphenburger Verlagshandlung 1973,
S. 163. Der Titel des o.J. (1861) in Hamburg bei J. Kahlbrock Wwe verlegten Heftes lautet vollständig: Lenore, das
Opfer blinder Liebe. Eine Geschichte aus Preußens großen Königs Friedrich II Helden- und Waffenthaten. Nebst dem
Liede: Lenore fuhr um's Morgenroth.
20) Vgl. Lore Kain-Kloock: Gottfried August Bürger. Zum Problem der Volkstümlichkeit. Berlin: Rütten & Loening 1963, S. 166 u.
passim.
|
|
1987
|
Glantschnig, Helga. Das leidenschaftliche Wesen. In: Liebe als Dressur. Frankfurt / New York
“[S. 170] Zum
Prinzip weiblicher Lebensführung erhoben, soll innere wie äußere Reinheit der Frau zur zweiten Natur werden. Andre ist ebenfalls davon überzeugt, daß ´die Liebe zur Reinlichkeit´ die ´Standfestigkeit´ der Frau
festigt, legt sie doch deren ungestümes Triebleben am ehesten brach, ´Inn und außen blank und rein, soll der Mädchen Busen sein.´”
|
|
1988
|
Autorenkollektiv. Gottfried August Bürger. In: Sturm und Drang. Erläuterungen zur deutschen Literatur.
“[S. 268] Mit der Frage der echten Volkstümlichkeit ohne Einbuße an künstlerischer Qualität setzt sich Schiller 1792 in
einer Rezension der Bürgerschen Gedichte eingehend auseinander. Die Rezension ist ein Glied in der Kette von Goethes und Schillers Bemühungen, die Gesetzmäßigkeit des künstlerischen Schaffens zu erfassen und die
Aufgaben eines deutschen Nationaldichters nach der Französischen Revolution auszusprechen. Schiller entwickelt seine Forderungen aus dem Widerspruch zu der vergangenen, vorrevolutionären Periode des Sturm und Drang,
so wie der Sturm und Drang seine Forderungen im Widerspruch zur Aufklärungsliteratur der Lessing-Zeit gestellt hatte. Der Verzicht auf die Umwälzungen, die in Frankreich die Geburt einer Nation zur Folge hatten,
ließ auch die Aufgaben der deutschen Nationaldichtung in einem veränderten Licht erscheinen. Schillers Idee einer "ästhetischen Erziehung des Menschen", die ihren Niederschlag auch in der Bürger-Rezension
findet, stellt fiir den Dichter als Erzieher und Vorbild der Nation neue Maßstäbe auf. Am Ideal eines "klassischen" Nationalautors gemessen, von dem Schiller sowohl breite Wirkung als auch tiefen Gehalt
fordert, sowohl Verbindlichkeit als auch höchste künstlerische Qualität, mußten die meisten Dichter seiner Zeit als den Anforderungen nicht geniigend erscheinen. Schiller schreibt seine Rezension, um Ideale
aufzustellen. Forderungen zu erheben: ihm geht es keineswegs darum, das bisher Erreichte auch zu würdigen und dabei die historischen Bedingungen zu berücksichtigen. Aus diesem Bestreben ist Schillers Härte und Kälte
gegenüber dem Menschen Bürger zu verstehen. sein mangelndes Verständnis sowohl für dessen Leistung als plebejischer Dichter als auch für die Wirkung der Rezension auf den vom Schicksal schon genugsam Heimgesuchten.
Bürger war ein Sturm-und-Drang-Dichter und nur als solchen konnte man ihn gerecht einschätzen.
Bei den Zeitgenossen erregte die Rezension ein heftiges Für und Wider. Schiller selbst hat stets seine
trotz aller Kritik vorhandene Wertschätzung für Bürger betont, und auch Goethe und Wilhelm von Humboldt haben sich bemüht, ihre Zustimmung zur Schillersehen Kritik mit dem Lobe des Kritisierten zu verbinden.
Trotzdem war es in der Literaturgeschichte meist üblich, den Dichter Bürger mit Schillers Rezension die Laufbahn beschließen zu lassen. Dabei übersah man, daß trotz Unglück, Krankheit und tiefer persönlicher
Resignation das Jahr 1792 für den politischen Dichter Bürger einen neuen und überraschenden, wenn auch kurzen Aufschwung darstellt.
[S. 270] In seine Weltanschauung sind die wichtigsten Anschauungen der
Aufklärung eingegangen: vor allem die Lehren Rousseaus von der Naturreligion und vom Gesellschaftsstaat. Wie seine dichtenden Zeitgenossen beruft sich auch Bürger immer wieder auf die “Natur", wenn es gilt,
gegen die Fesseln der Religion, Gesellschaft und Moral zu protestieren, und die Natur -also Leben, Wirklichkeit ist ihm sein vorzüglichster Lehrmeister. Inbegriff der Natur ist ihm die Liebe, sie ist ihm Schöpferin,
Gesetzgeberin. Urkraft. In der Liebesbeziehung spiegelt sich ihm die Beziehung des Ichs zur Welt, sie ist ihm der früheste Zugang zum Weltverständnis, höchster Ausdruck der Lebenserfahrung und des Lebensanspruchs.
Immer wieder findet sich bei ihm das Liebesmotiv als zentrales Motiv, in dem sich sein Protest gegen die bürgerlich-feudale Umwelt äußert: noch spontan in den frühen studentischen Liedern, in hoher poetischer
Verallgemeinerung in der "Lenore", bewußt und von bitterster Erfahrung gespeist in den Molly-Gedichten.[...]
In anderer Hinsicht ist Bürger wesentlich konsequenter: ihm waren früh alles
kleinbürgerliche Moralisieren, alle Enge und Spießigkeit, alle christlich-bürgerlichen Tugendbegriffe verdächtig geworden. Hier zeigt sich ein wesentlicher Unterschied zu den Freunden des Hains, der sich dann auch
in ihren Dichtungen widerspiegelt. Sie hatten Religion und Tugend zu ihren Losungen erhoben, bei Bürger finden sich nirgends diese Begriffe. Bürger verlangte Genuß, sie verlangten Genügsamkeit.
Bürger erweist sich dem Sturm und Drang dadurch zugehörig, daß er in seinen theoretischen Ansichten, noch umfassender jedoch in seiner poetischen Praxis, in wesentlichen Punkten mit ihm
übereinstimmt.
[S. 272] Bürgers Suche nach dem nationalen Publikum ist nicht ohne den "Göttinger Musenalmanach" zu denken. Der Almanach erreichte die verschiedensten Bevölkerungskreise und trug
außerordentlich zur Verbreitung der Gedichte bei. Die Publikumserfolge, die Bürger zu verzeichnen hatte, wurden begünstigt durch die poetischen Formen, in denen er dichtete: durch das Lied und die Ballade. Zur
Verbreitung eines Liedes gehörte weder Geld noch ein gebildetes Publikum, so daß auch die armen Bauern und das Gesinde daran teilhaben konnten.
Bürgers Bevorzugung des Liedes und der Ballade hat
ihren Grund nicht nur in der Richtung seines Talents, sondern auch in seiner Stellung zum Publikum. Sie sind die poetischen Formen, die durch die Möglichkeit des Vortrages und des gemeinsamen Gesanges am stärksten
gemeinschaftsbildend wirken und zum kollektiven Mitschöpfen auffordern. Bei ihnen stellt sich sofort eine enge Verbindung zwischen Autor und Hörer her. Nur beim Theater ist noch ein ähnlich direkter Kontakt und ein
ähnlich kollektives Erlebnis der Poesie vorhanden.
Handlung, Bewegung und dramatische Darstellung, Prägnanz und sinnlich verfaßbare Ausdrucksweise, dazu die Natur als oberste Richterin waren Bürger
die Voraussetzungen echter poetischer Darstellung.
Sein ganzes Leben hindurch bemüht sich Bürger um Lakonismus und Prägnanz der Aussage. Dort, wo er sein Ideal erreicht, liegen gleichzeitig seine
größten poetischen Leistungen. Für Bürger gehörte auch der Dialog mit der ihm innewohnenden Notwendigkeit, das Wesentlichste ohne Umschweife in wenigen Worten zusammenzudrängen, in das Gebiet des Lakonismus. Deshalb
bevorzugt er ihn auffallend.[...]
Bürgers Eigenschaft, in seinen Gedichten stets vom Leben und nicht von der Idee auszugehen, veranlaßte Schiller in seiner Rezension zu scharfer Kritik. Sein Vorwurf
der mangelnden "Idealisierkunst" trifft dort auf Bürger voll zu, wo er sich gegen die fehlende Verallgemeinerung in den lyrischen Gedichten Bürgers richtet, ihren zu privaten, "individuellen
Charakter". Vom Standpunkt einer realistischen Theorie und aus historischer Sicht betrachtet, ist jedoch dort sein Tadel unberechtigt, wo er sich gegen den sinnlichen Charakter der Lyrik und die zu starke
Identifizierung des Dichters mit den geschilderten Empfindungen wendet, ohne gleichzeitig den realistischen Vorstoß, der darin lag, zu würdigen.
[S. 276] In den achtziger Jahren kreisen seine bedeutenden
Gedichte um seine Liebe zu Molly. Ähnlich wie im Werther die Liebestragödie ihren Höhepunkt erst erreichte, als Werther aus der adligen Gesellschaft ausgestoßen und ganz auf sich selbst zurückgeworfen wurde, konnten
auch bei Bürger die Liebesverwirrungen nur darum so zerstörerisch auf sein Leben wirken und ihn dazu verleiten, sie im Übermaß öffentlich zu behandeln, weil ihm ein Platz in der Gesellschaft verwehrt war, der ihm
Befriedigung und Anerkennung gebracht hätte.
[S. 277] Es war nicht der Mangel an Ereignissen in Deutschland, der Bürger im privaten Bereich verharren ließ, es war die gesellschaftliche Isolierung, die ihn
unfähig machte, die temporären Stoffe zu gestalten. Das Ereignis, das Bürger einen neuen großen Impuls gab, war die französische Revolution. Noch im Jahre 1793 schreibt er an Goeckingk: "Wahrlich, kein
Liebesabenteuer hat je mein ganzes Wesen so sehr in sich hinein verstrickt, als das gegenwärtige große Weltabenteuer, von welchem ich keinen Ausgang sehe, ja nicht einmal zu ahnden im Stande bin."
Als Bürger 1793 im "Musenalmanach" mit den literarischen Früchten seiner politischen Anteilnahme öffentlich hervortrat, war er unter den Professoren ein völliger Außenseiter. Die Zensur sorgte
dafür, daß der nächste Almanach wieder zahm und unbedeutend wurde, und Bürger entschuldigt sich beim Publikum mit dem Gedicht "Entsagung der Politik":
[S. 279] Die besondere Bedeutung dieses
Gedichtes [Die Tode] liegt darin. daß es an die Tradition des volkstümlichen Liedes anknüpft und diese Form mit dem neuen politischen Inhalt füllt. Es führt die Linie weiter, die Bürger rund zwanzig Jahre früher mit
seinem Gedicht "Der Bauer an seinen durchlauchtigen Tyrannen" begonnen hatte. Es ist ihm ähnlich in der Form der Ansprache, in der Darlegung der Argumente, in der Verknüpfung sozialer und politischer
Fragen. Bürger hatte dort, das Mißverhältnis zwischen Volk und Fürst darstellend, das Problem der feudalen Ausbeutung in den Vordergrund gestellt und damit nationale Probleme berührt. Erstmals - in der Lyrik dieser
Periode - verficht der Bauer selber seine Sache gegen den Adel. Seine Argumente gegen den Despotismus stammen aus den Erfahrungen der eigenen Arbeit, sind genährt von den bürgerlichen Ideen des Eigentums, der
Freiheit und des Rechts. Nur hierdurch wird der aus dem Zusammentreffen der entgegengesetzten Klasseninteressen entstehende echt dramatische Ton des bäuerlichen Monologes verständlich, der in entschiedene
Forderungen mündet. [...]
Dieses Selbstbewußtsein war in der deutschen Literatur als Kennzeichnung eines zeitgenössischen bäuerlichen Charakters bis dahin nicht möglich. Obwohl der Gestalt durch die
fehlende Handlung individuelle Züge abgehen, steht selbst die skizzenhafte Zeichnung des "bäuerlichen Prometheus" in seiner die zentralen Zeitfragen berührenden Anklage als eine der Gegenwart angehörende
Gestalt in der damaligen Dichtung völlig vereinzelt da
Trotz dieser Einschätzung und der Wirkung, die das Gedicht hatte, bedeutet das Fragment "Für wen, du gutes deutsches Volk" eine neue
und höhere Stufe der nationalen Aussage. Der Dichter wendet sich - und hierin liegt der große Wurf - an das gesamte deutsche Volk. Der Begriff "Volk" umfaßt hier mehr als nur die werktätigen Schichten, er
trägt in sich bereits den Anspruch auf nationale Qualität.
Indem Bürger die Herrschenden vom Standpunkt der Unterdrückten aus sieht, kann er die Fronten überschauen. Erst diese Sicht ermöglicht es
ihm, nicht nur Fragen aus der realen Situation des Volkes heraus zu stellen, sondern diese auch für das Volk verständlich zu beantworten.
[S. 283] In Bürgers ernsten Balladen sind die Schattenseiten des Moritateneinflusses noch spürbar, und sie sind es, die heute mancher dieser Balladen eine unfreiwillige Komik verleihen. Andererseits
sind es ebendiese Bänkelsangklänge, die zu Bürgers Zeit und noch im ganzen 19. Jahrhundert die Verbreitung der Balladen in den unteren Publikumsschichten gefördert haben. Die zahllosen Drucke Bürgerscher Balladen in
Form von "Fliegenden Blättern", die Ergänzungen, Nachahmungen, die Verarbeitung in "Volksromanen" und "Volksbüchern" des 19. Jahrhunderts, in Schauspielen, Melodramen und Puppenspielen
geben ein beredtes Zeugnis für die unerhörte Wirkung der Bürgerschen Balladendichtung.
Die weitere Wirkung der Bürgerschen Balladen war von anderer Art als etwa die mancher Lieder von Schubart. Diese
Lieder wurden zu echten Volksliedern, lebten im Volk, wurden dort weitergedichtet. Das geschah meist in Form lyrischer, epischer und dramatischer Verarbeitungen, und zwar von literarischer Seite her. Diese
literarischen Produkte, die bis auf wenige Ausnahmen ein in jeder Beziehung flacheres Niveau haben als die Bürgersche Dichtung und zuweilen direkt zur "Schundliteratur" zu rechnen sind, können in den
seltensten Fällen als"Volksdichtung" bezeichnet werden. Die Umwandlung der revolutionären Tendenzen Bürgers in ihr Gegenteil, ihre "Entgiftung", wie sie am Beispiel der
"Pfarrerstochter" auf dem Weg über Volksromane zum Puppenspiel nachzuweisen ist, zeigt deutlich den reaktionären Einfluß im Verlaufe der Nachwirkung.
Die Tatsache der ungeheuren Verbreitung
einiger Bürgerscher Balladen bestätigt, daß die ungemein breite und andauernde Wirkung mancher poetisch nicht vollkommener Balladen Bürgers Fähigkeit zuzuschreiben ist, den Geschmack der breiten Massen
nachzuempfinden und ihm entgegenzukommen, sowohl in der Stoffwahl als auch in der Gestaltung. Es darf also nicht genügen, diese Bürgerschen Balladen als "Verirrung" abzutun. Es ist stets dabei zu fragen,
wieweit diese poetischen Verirrungen auf das Konto der speziellen Auffassung Bürgers über "Popularität" zu setzten sind, das heißt, wie weit hier die Erfahrungen über die Wirkung der niedrigen Literatur in
den unteren Publikumsschichten die Gestaltung beeinflußten.
[S. 284] Die Erfahrungen des zweiten Weltkrieges haben dazu geführt, daß der Zeitgehalt der "Lenore" wieder stärker empfunden wurde und die Problematik der ketzerischen
Soldatenbraut zum erstenmal volle Beachtung fand. Die Frage, die den ganzen ersten Teil der Ballade beherrscht: "Den alten Glauben haben wir verloren, was haben wir denn nun?" darf nicht den Anschein
erwecken, als ob es sich in der "Lenore" allein um eine religiöse Auseinandersetzung handle. Der "alte Glaube": das war nicht nur der Glaube, wie ihn ein mehr oder minder orthodoxes Christentum
vorschrieb, sondern auch der Glaube an die Gültigkeit und die Richtigkeit der weltlichen Ordnung, die in Deutschland zu dieser Zeit vom feudalabsolutistischen System bestimmt wurde. Die Landeskirche war zum
Instrument der herrschenden Klasse geworden, rechtfertigte und stützte diese, und zwar in einern Maße, daß jede ernsthafte Kritik am religiösen Dogma letztlich einern Angriff auf die Gesellschaft in ihrer
bestehenden Form gleichkam. Nicht umsonst wurden Ketzerverzeichnisse angelegt, wurde die "Lenore"' konfisziert und mußte Goethes "Prometheus"-Ode illegal verbreitet werden! Nur wenn die
unbedingte Zusammengehörigkeit der religiösen und philosophischen Fragen mit allen Fragen der menschlichen Existenz innerhalb einer bestimmten Gesellschaftsordnung angenommen wird, kann die ganze Tragweite eines
Angriffs auf die kirchlichen Dogmen erkannt werden.
[S. 289] Trotz bestimmter Schwächen ist die "Lenore" unbestritten Bürgers größte Leistung. Sie ist eines der bedeutendsten literarischen
Ereignisse der Frühperiode des Sturm und Drang und als Vorbild und Anregung von großer Tragweite für die spätere Balladendichtung. Mit der "Lenore" ist es Bürger gelungen, die nationale Wirkung zu
erreichen, nach der er strebte. Bürger hat innerhalb der volkstümlichen Dichtung der Aufklärung eine neue Stufe erreicht, die dadurch gekennzeichnet ist, daß er nicht nur einen fortschrittlichen bürgerlichen
Klassenstandpunkt einnimmt, sondern auch die Trennung zwischen Intelligenz und werktätigem Volk überwindet.
Das Liebesproblem ist nicht nur das zentrale Thema der meisten lyrischen Gedichte Bürgers,
sondern auch seiner meisten Balladen. Aus der Zahl dieser Balladen hebt sich eine Hauptgruppe heraus, in der Bürger den reinen Liebeskonflikt zum gesellschaftlichen Konflikt erweitert hat. Er nutzt hier die
besondere Chance, die das Liebesthema bietet, um den sozialen Antagonismus am privaten Schicksal sinnfällig zu demonstrieren und gleichzeitig die privaten Konflikte gesellschaftlich zu verallgemeinern. Die große
Zahl der Dramen im 18. Jahrhundert, die das Liebes- und Eheproblem als Ausgangspunkt zur Darstellung der nationalen Probleme wählen, beweist die Fruchtbarkeit dieses poetischen Ansatzes für diese Periode.
[S.
291] Nach der "Lenore" gehört "Des Pfarrers Tochter von Taubenhain" zu den bedeutendsten Zeugnissen der Bürgerschen Balladendichtung. An Popularität in den unteren Volksschichten ist sie
wahrscheinlich innerhalh seiner übrigen Gedichte unerreicht. Diese Leistung Bürgers ist nicht zuletzt der Wahl des Stoffes zu verdanken. Der Stoff der "Pfarrerstochter" kam Bürgers Talent entgegen. Wie in
der "Lenore" handelte es sich hier um die Darstellung eines zeitgenössischen Vorfalls. Im Mittelpunkt des Geschehens steht das tragische Schicksal eines Mädchens, dessen bürgerlichen Status genau
gekennzeichnet ist. Die Identifizierung des Dichters mit der HeIdin, die sich hier wie in "Lenardo und Blandine" am sichtbarsten in den Anklagereden äußert, führt nicht wie dort zu einer Fehlzeichnung der
Person. Die eigenen Erfahrungen und Meinungen - konkret die dem Amtmann Bürger bekannten Probleme der Kindesmörderinnen - fügen sich organisch in die Gestalt ein.
[S. 294] In der "Prinzessin Europa"
ist für Bürger das Gewand des Jahrmarktsängers mehr als eine nur äußerliche Verkleidung. Er gibt zwar den moralisierenden Charakter des Bänkelsängers auf, verzichtet jedoch nicht auf die moralische Überlegenheit,
mit der dieser seine Zuhörer anspricht. Er stellt sich eine soziale Stufe niedriger, um damit die Möglichkeit zu gewinnen, die plebejischen Mittel der Derbheit und Vulgarität ausgiebig gegen die geehrten und
gelehrten Herren anzuwenden und seine Kritik nach allen Seiten hin nachdrücklich zu äußern. Er macht sich nicht mehr über die Primitivität lustig, wie seine Vorgänger, sondern verwandelt sie in eine
gesellschaftskritische Waffe.
Die begeisterte Aufnahme der "Europa" durch Goethe und den Hain beweist, daß auch sie ein wichtiger Schritt innerhalb der Sturm-und-Drang-Dichtung war.
[S. 296] Bürgers großes Verdienst um dieses Gedicht wird keineswegs dadurch geschmälert, daß er ein so glückliches Vorhild gefunden hat. Um daraus die Ballade "Der Kaiser und der Abt" zu schaffen, gehörte
sowohl sein sicherer Griff nach dem ihm gemäßen Stoff, sein Talent, diesen entsprechend den nationalen deutschen Gegebenheiten umzuformen und weiterzuentwickeln, als auch die Gabe, für den Stoff einen vorhildlichen
sprachlichen Ausdruck zu finden.”
Der vollständige Beitrag in der ONLINE-BIBLIOTHEK
|
|
1989
|
Linder-Beroud, Waltraud. Von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit? Untersuchungen zur Interdependenz von Individualdichtung und Kollektivlied. Freiburg (Breisgau), Univ., Diss.
“[S. 216] Die Liedflugschrift, ein Medium zur Popularisierung der Schriftkultur
Wie Sven Hakon Rossel in seiner Untersuchung des literarischen Liedes in der dänischen Volkstradition
festgestellt hat, stellt das Flugblatt ´eine -leider oft übersehene -Zwischenstufe zwischen dem Verfassertext und der mündlichen Tradition´dar:
´Aus meinen Untersuchungen geht hervor, welch wichtige und häufige Stufe es darstellt. Das Flugblatt ist nicht nur die Ursache für die
Verbreitung des entsprechenden Textes unter dem Volk, sondern es kann auch selbst traditionsschaffend sein. Auf dieser Stufe wird man oft
die Variante finden, die man sonst der mündlichen Tradition zugeschrieben hätte.´
Rossel untersucht in seinem Aufsatz vier Kunstballaden, die Motive der Volksballade und des Bänkelsangs
stilisieren: ´Den Dodes Igienkomst" (Lenore-Motiv) von Knud Lyhne Rahbek (1760-1830); ´Vilhelm´ (Standeskonflikte, untreue Braut) von Adam Oehlenschläger (1779 - 1850); ´Det var en Aften silde´ (natur-magische
Ballade, Vorbild: Goethes ´Erlkönig´) von Bernhard Severin Ingemann (1789 -1862) sowie einige dänische Versionen von Bürgers ´Des Pfarrers Tochter von Taubenhain´. [...]
Das Verbreitungsmedium der
Bürgerschen Ballade ist in Dänemark wie in Deutschland die Flugschrift, aber liegt das nicht etwa an ihrem bänkelsängerischen Ton? Trotz inhaltlicher und stilistischer Berührungspunkte ist sie dennoch nicht dem
traditionellen Bänkelsang zuzurechnen, sondern der Dichter ironisiert hier durch das Stilmittel der Imitation bewußt diese Gattung. Seine Pfarrerstochter ist wie einige vorklassische Kunstballaden seiner
Zeitgenossen Hölty, Gleim, Voß, Löwen, Schiebeler als ´Salon-Bänkelsang´ in die Literaturgeschichte eingegangen und, wie man folgender vergleichender Zusammenstellung entnehmen kann, vorwiegend durch Flugschriften
verbreitet worden:
|
Liedincipit
|
gedruckte
|
Rezeption
|
mündl.u.hs.Rez.
|
|
|
Liederbuch
|
Flugschrift
|
|
|
Ein Pilgermädel jung und schön' (Bürger)
|
3
|
22
|
10
|
|
Hoch klingt das Lied vom braven Mann' (dito)
|
7
|
1
|
0
|
|
'Die Eh' ist für uns arme Sünder' (Gleim)
|
1
|
0
|
1
|
|
'Schwermutsvoll und dumpfig hallt' (Hölty)
|
3
|
7
|
3
|
|
Ein Junker aus dem Schwabenland' (Löwen)
|
1
|
1
|
0
|
|
'Ich saß und spann vor meiner Tür' (Voß)
|
21
|
18
|
18
|
|
'In des Waldes tiefsten Gründen' (Vulpius)
|
35
|
55
|
ca. 200
|
|
zum Vergleich Bürgers Pfarrerstochter:
|
|
|
|
|
'Im Garten des Pfarrers von Taubenhain'
|
2
|
ca. 20
|
3
|
|
Die singende Allgemeinheit ist sich der subtilen Stilisierung und Ironisierung ihrer Lieblingsthemen nicht bewußt, sie hält die geschilderten Ereignisse
als tatsächlich geschehen, und als solche werden sie von den Druckern auch verkauft.
´[...] damit haben wir in den Volkslieddrucken dieser Art nichts anderes vor uns als das Fortleben alter, überlebter Formen, selbst
bei neuen Inhalten, denen jene Formen aufgepreßt werden. Diese Stilwidrigkeit wird bei der Pfarrerstochter-Popularisierung noch
vergröbert durch eine angehängte Fortsetzung. [ ...] Die Erzählung von des Verführers Sühne und Ende ist als Fortsetzung der
Pfarrerstochterballade nichts anderes als die Einführung einer Art 'poetischer Gerechtigkeit', womit das Ganze in eine andere
Perspektive gerückt wird. A. W. Schlegel [ ...] traf mit seiner ironischen Bemerkung, es sei 'empörend´, daß der Junker straflos
ausgehe, voll die Empfindung aller rein stofflich eingestellten Leser.´ [Enst Schröder, Diss.Kiel 1933]
Primäres Verbreitungsmedium dieser als Tatsachenberichte verkauften Dichtungen ist die aus der Newen Zeitung hervorgegangene Flugschrift: ihr
Käuferpublikum kommt in der Schilderung aktueller und sensationeller Berichte voll auf seine Kosten. “
|
|
1990
|
Anonym. Der Göttinger Hain und die Lyrik im Umkreis des Bundes. In: Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. 1990.
“[S. 418] Bürger inthronisiert einen Gattungstypus, der als Geisterballade die deutsche Literatur bereichern wird. Von Lenore über Leander und Blandine (1776), Der wilde Jäger (1778), Des Pfarrers Tochter von Taubenhain (1776/81) bis zu Graf Walter (1789) entfaltet sich eine Kette von Grauenbildern, die "alles, was die Natur in Schrecken setzen kann", so arrangieren, daß es den Lesern - wie er im Bezug auf Lenore bemerkt - "eiskalt über den Rücken laufen" werde. Im Vergleich zu Herders Konzept der Naturpoesie übersteigert Bürger bewußt die im Stoff vorgegebenen Effekte: "Das Nachbild der Natur" - so erläutert er in Zusammenhang mit Der wilde Jäger -
"muß...die nämlichen Eindrücke machen wie das Vorbild der Natur. [...]" Der "Tumult" wird zu einem sprachlichen Anordnungsprinzip, das - den Stoff dramatisierend - den hektisch-übersteigerten,
grausig-deformierenden Bewegungsverlauf nur noch bedingt und zuweilen gewaltsam in die Bahnen einer religiös gesicherten Ordnung zurücklenken kann. Und diesem äußeren entspricht ein innerer "Tumult":
Bürgers Schauerballaden sind Variationen dessen, was er in Lenore konstatiert: "So wütete Verzweiflung / Ihr in Gehirn und Adern." Das pathetische Ausdrucksverlangen scheint in diesem Desparationsgestus, der seine Balladenwelt durchzieht, seinen Grund zu haben. Aber die Anziehungskraft der Verzweiflungskonstellationen führt zu einer stofflichen Verselbständigung des Grausigen, die in der Kumulation doch wiederum nur den konstruierenden Autor enthüllt und nicht das für sich stehende Volkstümliche, wie es Herders Vorstellungen entsprach. Bürgers Eigenart, aber wohl auch seine Begrenzung wird in dieser sprachlich minuziös organisierten Inszenierung des Desorganisierten in der Welt des "Herzens" und der gesellschaftlichen Zusammenhänge zu sehen sein. Aber auch diese Auflösungsbilder, die in ihrer Deformationsapologetik an den geistigen Grundlagen des Zeitalters rütteln, haben eine theologische Brisanz, die nur mühsam durch moralisierende Einebnungen am Ende der Balladen zugeschüttet wird. In ihnen tritt die unaufgelöste Spannung, die Bürgers Leben und Werk durchzieht, zutage.
Solch eine Spannung kennzeichnet die lyrischen Gedichte in besonderem Maße. Es ist Bekenntnisdichtung, die in vielfachen formalen Variationen die privaten Erfahrungsweisen eines Ichs thematisiert,
aber nur selten dies Ich in persönlicher Aussage zu Wort kommen läßt. Verzweiflung, Verlust und unerfüllte Hoffnungen sind auch hier die Themen, aber sie kreisen als Reflexions- und Gefühlsgegenstände monomanisch in
sich und verbleiben im Gestus des Vorstellens, nicht des Ausdrucks. Wenn er etwa "vom süßesten der Triebe" spricht (Seufzer eines Ungeliebten 1774) und Klage über die mangelnde "Gegenliebe" führt, so begrenzen sich Frage und Ausruf auf Rhetorik ("Hast du nicht Liebe zugemessen / Dem Leben jeder Kreatur? / Warum bin ich allein vergessen, / Auch meine Mutter du! Natur?"). Oder wenn er sich an den "lieben Mond" wendet und über das "Weh" seines "kranken Herzens" klagt (Auch ein Lied an den lieben Mond,
1778), so bleiben Gefühl, Gegenstand und Natur unverbunden nebeneinander, ohne über die Anrede hinauszukommen: "Wen hätt´ ich sonst, wann überlange Nächte / Entschlummern mich, du weißt wohl was, nicht läßt, /
Dem alles ich so klagen könnt´ und möchte, / Was für ein Weh mein krankes Herz zerpreßt?" Einzig in seinen späteren Liebesgedichten an Molly (der englischen Vorbildern verpflichtete Dichtername seiner zweiten
Frau), so etwa in Für sie mein Eins und Alles (1788) und in den elegischen Gesängen über den Tod Mollys gelingt ihm ein persönlicher Ton, der sich volksliedhafter Leichtigkeit annähert:
Mir tut´s so weh im Herzen!
Ich bin so matt und krank!
Ich schlafe nicht vor Schmerzen;
Mag Speise nicht und Trank;
Seh alles sich entfärben,
Was schön war rund umher,
Nichts, Molly, als zu sterben,
Nichts, Liebchen, wünsch ich mehr.
Wirklich
volkstümlich wurde Bürger indes nicht durch seine Lyrik, sondern durch eine anonym erschienene nacherzählende Übersetzung von Lügengeschichten, mit der Rudolf Erich Raspe (1737-1794) 1785 in England reüssiert hatte
und die Bürger 1786 - um einige Stücke vermehrt - unter dem Titel Wunderbare Reisen zu Wasser und zu Lande, Feldzüge und lustige Abentheuer des Freyherrn von Münchhausen... rückübertrug. Sozusagen im Medium
des Volksbuchs lebendig fabulierend erreicht er die Popularität, auf die es ihm zeit seines Lebens ankam. “
|
|
1990
|
M. u. R. Der wilde Jäger, 1826. In:Carl Blechen, Zwischen Romantik und Realismus. München und Berlin.
“[S. 141] Blechens Erklärung auf der Rückseite des Blattes: ´Der wilde Jäger, nach einer Aufgabe des Berlinischen Künstler-Vereins (im Dezember 1826)´ charakterisiert diese
merkwürdige Zeichnung und rückt sie in die Nähe des Blattes Der Sturm (Kat. 115, Taf. 32), das aus gegebenem Anlaß gleichzeitig entstand. Auch zu dieser Aufgabe hat Blechen die flüchtige Bleistiftskizze einer ersten
Idee hergestellt (Nationalgalerie, Blechen Nr. 705, Rave 517), um die eigentliche Arbeit, wie es gefordert wurde, dann zu Hause auszuführen. Während der Landsknecht mit dem Totenkopf in der Tracht des 16.
Jahrhunderts auf dem Pferdegerippe im Hauptblatt nur einmal erscheint, ist er auf der Skizze ein zweites Mal in veränderter Haltung zu sehen. Wie nach der deutschen Volkssage erzählt wird, braust auch auf Blechens
Zeichnung hinter dem ´wilden Jäger´ ein Heer von Totengerippen und Getier - unter dem Speer des Jägers gar eine kleine Fliege und auf dem knochigen Hals des Pferdes ein reitender Frosch - mehr komisch als schaurig
daher. Vielleicht wurde auch im Verein Gottfried August Bürgers Ballade vom ´Wilden Jäger´ vorgelesen, dann wäre der zweite Ritter auf der Skizze vielleicht jener ständig warnende Reiter, dem es dennoch nicht
gelang, den Wild- und Rheingrafen von seiner frevelhaften Jagd abzuhalten, bis ihm der Hals umgedreht und er zur ewigen nächtlichen Jagd verdammt wurde.“
|
|
1990
|
Scholz, Friedrich. Die Literaturen des Baltikums.
“[S. 197] In einem Brief an J. Krohn vom 21.3./2.4.1869 schreibt er [Friedrich Reinhold Kreutzwald]: 'Bei keinem neuen deutsche Dichter sind im Estnischen die Schwierigkeiten so
groß wie gerade bei Schiller. Alle Versuche, welche von anderen wie von meiner Wenigkeit darin gemacht worden sind, erinnern nur zu sehr an den bekannten Ausspruch vom alten Bürger: 'Beachtet doch das Dictum /
Cacatum non est pictum!''
|
|
1991
|
Mühsam, Erich. Gedicht. In: Döhn, Helga. “Oh Säss E. E. in unsrer Mitten!”, veröffentlicht in Marginalien, 122. Heft, Wiesbaden. (Sammlung Helmut Scherer)
“[S. 13] Unter den noch ungeordneten Nachlaßmaterialien und Materialsammlungen wurde ein weiterer kleiner Zettel mit einem Gedicht von Mühsams Hand gefunden:
August Bürger, ein Mann von Gewicht,
Machte zeitlebens recht gute Gedichte. —
Später vergaß man wohl gar seinen Namen
Den rettet nun Erich Ebstein. Amen
Mühsam spielt damit auf Ebsteins Forschungen über Gottfried August Bürger an, z. B. gab er 1919-1920 dessen Balladen mit einem Nachwort heraus.”
|
|
1992
|
Höyng, Peter. Wieviel Volk braucht ein Schriftsteller? Nicht nur Gedanken zur Schiller-Bürger Debatte. In: New German review 8 , S. 117-131. Los Angeles, Calif.
[S. 128] Schillers Weg führt zu einem ästhetischen Lösungsversuch. Die Kontroverse unter den Germanisten rührt daher, daß sie entweder den Schiller, der die Volksdichtung preist,
hervorheben oder aber den Schiller zu Wort kommen lassen, dem es um die autonome Kunst geht. Schiller selbst aber versucht, den hier betonten Widerspruch in der Rezension durch ein dialektisches Verhältnis
aufzuheben: der Dichter solle sich bildend zum Volk herniederlassen, um es auf eine höhere Bewußtseinsstufe ´hinaufzuziehen´. Der Vorwurf, den Bürger sich dabei gefallen lassen muß, ist der, daß er sich dem Volk oft
gleichmache und somit nicht dem geforderten Vorbildcharakter, der veredelten Individualität des Dichters, nachkomme. Dem Autor gebührt also die Superiorität in der Erkenntnis, was die wahren Interessen des
Volkes zu sein haben. Ein Gedanke, dem das idealistische Ansinnen Stefan Heyms in den Tagen der "deutschen Revolution" nicht unähnlich ist. Ganz im Sinne Schillers wurde dann auch ´der große Haufen´
verworfen, als er sich nicht mehr den sozialistischen Idealen widmen wollte. Mit Schillerscher Rhetorik heißt es da bei Stefan Heym: "Aus dem Volk [...] wurde eine Horde von Wütigen, die, Rücken an Bauch
gedrängt, Hertie und Bilka zustrebten auf der Jagd nach dem glitzernden Tinnef".
[S. 129] Der Literaturmarkt verkraftet noch mehr als im 18. Jahrhundert beides: aufklärerische und elitäre Kunst; gar nicht zu reden von den vielen Nuancen zwischen diesen beiden Polen.
Deshalb auch ist ein Wiederaufleben einer Kombination aus Schillers und Bürgers Anliegen wie sie im Herbst 1989 und Anfang 1990 in Ost-Berlin bei Teilen der Schriftsteller und intellektuellen zu Tage trat, verfehlt.
So wünschenswert eine nicht affirmative Haltung auch ist, so wenig kann sie mit Rezepten herbeidirigiert werden, die bereits vor zweihundert Jahren fragwürdig waren.”
Höyngs Wieviel Volk braucht ein Schriftsteller in der ONLINE-BIBLIOTHEK
|
|
1993
|
Wagner, Fritz. Gottfried A. Bürgers ´Säuferlied´. In: Wirkendes Wort 1993
“[S. 167] Als Gottfried August Bürger im September 1777 nach einer lateinischen Vorlage sein Gedicht
"Zechlied" verfaßte, konnte er nicht ahnen, daß ihm bei seiner Nachdichtung das im Mittelalter am weitesten verbreitete und bis heute berühmteste Gedicht der weltlichen "Carmina Burana" Pate
gestanden hat. Es handelt sich bei dem lateinischen Original des Gedichts um die "Vagantenbeichte" des sogenannten Archipoeta aus dem 12. Jahrhundert, des typischsten und bekanntesten Vertreters der
mittellateinischen Vagantendichtung mit ihrer Leichtlebigkeit, optimistischen Diesseitsstimmung und individuellen Prägung, mit ihrem genialen Humor, ihrer geistvoll abgeklärten Ironie, ihrer graziösen Leichtigkeit
der Form, Musikalität und Lebensnähe.
[S. 168] Sicherlich war das Trinklied schon vor dem Erscheinen von Bürgers Nachdichtung in Anthologien und Kommersbüchern verbreitet. Doch zweifelsohne hat die
Nachdichtung des Lyrikers und Balladendichters des ,Sturm und Drang' die Nachwirkung der "Vagantenbeichte" des Archipoeta maßgeblich beeinflußt, zumal er seinem Gedicht die lateinische Vorlage
voranstellte.
Welcher außerordentlichen Beliebtheit sich das Trinklied erfreute, bezeugen u. a. die Kompositionen von Johann Philipp Schönfeld, Christian Gottlob Neefe, Georg Wilhelm Gruber, Johann Philipp
Kirnberger, Johann Abraham Peter Schulz, Samuel Friedrich Brede und Ludwig Abeille.
Besondere Verbreitung widerfuhr dem Trinklied durch seine Aufnahme in das ,.Erlanger Liederbuch für
Hochschulen" (1827) und in "Schauenburgs Allgemeines Deutsches Kommersbuch". Eine sorgfaltige Durchsicht der Trinklieder des 18. und 19. Jahrhunderts würde noch so manches Zeugnis zutage fördern, das
auf die Beichte des Archipoeta zurückgeht. *
Unbestreitbar ist der Einfluß des "Meum est propositum" auf das lateinische Trinklied "Wein, Kuß und Lied" des schwäbischen Dichters Friedrich
Haug, eines Freundes Schillers von der Karlsschule her, der Passagen der Beichte in neuem sprachlichen
Gewande bringt.
Eine Allusion auf Strophe 13 der "Vagantenbeichte", allerdings als Erinnerung an
Bürgers Text, bietet Goethe in seinem aus Vagantenstrophen bestehenden "Tischlied" von 1802, in dem der Trinker ausruft: "Mich ergreift, ich weiß nicht wie, / Himmlisches
Behagen. / Will michs etwa gar hinauf / Zu den Sternen tragen?"
Keiner jedoch schuf eine derart eindrucks- und wirkungsvolle Nachdichtung wie Bürger, der seinem "Zechlied" eine Fassung des
"Meum est propositum" zugrunde legte,die sich aus den Strophen 12, 13, 16, 18, 19 der "Vagantenbeichte" zusammensetzt.
[S. 170] Doch widerfuhr Bürgers "Zechlied" auch ablehnende
Kritik. So bemerkte Johann Heinrich Voß in einem Brief vom 22. Mai 1783: Bürgers Übersetzung stellt mehr einen akademischen Tumultuanten als lustigen Klosterbruder dar.
Auch Friedrich Schiller distanzierte sich in der "Allgemeine Literatur Zeitung" von 1791 von Bürgers Trinklied:
Gerne hätten wir alle bloß witzigen Stücke, die Sinngedichte vor allen, in dieser Sammlung entbehrt, so wie wir überhaupt
Hn. B. die leichte scherzende Gattung möchten verlassen sehn, die seiner nervigten Manier nicht zusagt. Man vgl. z. B., um
sich davon zu überzeugen, das Zechlied 1 T. S. mit einem Anakreontischen oder Horazischen von ähnlichem Inhalt.
Anders dagegen urteilte Jacob Grimm über Bürgers "Zechlied", der die erste
Edition des Archipoeta besorgte in seiner Studie über "Gedichte des Mittelalters auf König Friedrich I. den Staufer und aus seiner so wie der nächstfolgenden Zeit" in den Abhandlungen der Königlichen
Preußischen Akademie der Wissenschaften (Berlin 1843). Jacob Grimm, der dem Dichterfürsten seinen Rang in der Weltliteratur sicherte und das Trinklied nicht wie Bürger Walter Map zusprach, sondern dem rechtmäßigen
Verfasser, dem Archipoeta, bekennt sich bedingungslos zu Bürgers Nachdichtung:
Alle Umstände reden für die Priorität des Archipoeta, und wenn auch sein Zeitgenosse, scheint Walter Map doch zehn,
zwanzig Jahre später, als der Heerzug des Staufers nach Italien fällt, aufzutreten. Bedarf es eines Zeugnisses für den
deutschen Grundton dieser lateinischen Poesie, so mag angeführt werden, daß das freilich unübersetzbare ,mihi est
propositum in taberna mori', wo sich der Reim innig mit der Empfindung des menschlichen Herzens vermählt, am glücklichsten
nachgeahmt worden ist von Bürger, in welchem auch eine Ader dieser wilden, das Leben bis zur Neige auskostenden
Vagantenpoesie war.
Diese Eloge auf Bürger als kongenialen Nachahmer
des Archipoeta von einem derart berufenen Kenner des Vagantendichters hat wesentlich zur Verbreitung von Bürgers Trinklied beigetragen. So fand es Aufnahme u. a. in das "Akademische Liederbuch" von 1782,
1784 in die "Allgemeine Blumenlese des deutschen Volkes" und 1791 in die "Trink-und Commersch-Lieder".
[S. 171] In Gottfried August Bürger hat der Archipoeta, was die Vagantenbeichte
betrifft, die im 20. Jahrhundert durch die Komposition in den "Carmina Burana" von Carl Orff noch bekannter wurde, einen würdigen Nachahmer gefunden, der nach mehr als 500 Jahren in seinem Trinklied das
Bild des lateinischen Vagantendichters an seine Zeit vererbte.“
* Folgend eine Liste von Liederbüchern bis Mitte des 19. Jahrhunderts, in denen das Zechlied enthalten ist. Alle Bücher bei Google-books im Volltext
einsehbar [K.D.]:
Liederbuch für Freunde des Gesangs. Ulm 1790
Auswahl guter Trinklieder. Halle 1791
Auswahl guter Trinklieder. Zweyte stark vermehrte Auflage. Halle 1795
Der lustige Cantor. Zweyte stark vermehrte Auflage. Erfurt 1801
Bacchus, Mars und Amorn. Zweyte, vermehrte Auflage. Zürich 1809 (anonym)
Tisch- und Trinklieder der Deutschen. Erster Theil. Wien 1811
Mildheimisches Lieder-Buch. Gotha 1815
Leipziger Commersbuch 1815 (anonym)
Auswahl von Commers- und Gesellschaftsliedern. Halle 1816
Berlinisches Commersbuch. Berlin 1817
Neues Commersbuch. Germania. Göttingen 1818
Neueste hundertblätterigte Lust-Rose. Nürnberg 1819 (anonym)
Breslauer Burschenlieder. Breslau 1821
Teutsches Liederbuch zunächst zum Gebrauche für Hochschulen. Stuttgart 1823
Schweizer-Liederbuch, Aarau 1828
Auswahl deutscher Lieder, Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage, Leipzig 1830
Orpheus und Romos: oder Allgemeines gesellschafts-liederbuch Meissen 1830
Allgemeines Schweizer-Liederbuch. Dritte vielvermehrte Auflage Aarau 1833.
Die Volkslieder der Deutschen, Vierter Band. Mannheim 1835
Rheinischer Liederkranz, Zweibrücken 1836
Tandelmarkt der fidelsten Lieder, oder der Nachtwächter von Troja. Augsburg 1839
Das Büchlein Hilaritas. Augsburg 1840 (als Die Macht des Trinkens)
Liederbuch des deutschen Volkes. Leipzig 1843
Allgemeines deutsches Lieder-Lexikon. Zweiter Band. Leipzig 1847
Bacchus Buch des Weins. Leipzig 1854
|
|
1994
|
Ruttmann, Irene. Nachwort.
In: Gottfried August Bürger. Wunderbare Reisen zu Wasser und Lande, Feldzüge und lustige Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen. Philipp Reclam jun. Stuttgart
"[S.163] Die wunderbaren Reisen waren, als sie in den achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts erschienen, zudem ein sehr modernes Buch. Bürger griff auf, was in seinen Tagen die Welt
bewegte. Die Kämpfe der Engländer und Franzosen um Gibraltar und Blanchards Luftschiffexperimente, die für manchen Zeitgenossen an Phantasterei grenzen mochten, waren aktuelle Themen und gaben dem Schwank- und
Lügenbuch das Kolorit des Jahrhunderts. Dort allerdings, wo die Anekdote sich zur Satire zuspitzt, verzichtet Bürger auf allzu genaues Zeitkolorit; er nutzt statt dessen die Möglichkeiten der Lügendichtung und
>verfremdet< immer noch durchsichtig genug den Landesfürsten zum »Kaziken« einer Insel mit Gurkenbäumen, der seine Untertanen für Muscheln an den meistbietenden Nachbarfürsten verkauft. Er fügt jedoch hinzu,
daß der Häuptling diese »unerhörten Grundsätze« von einer Reise nach dem Norden mitgebracht habe. Mit dieser Anspielung auf den Landgrafen von Hessen, der bekanntlich Landeskinder an die Engländer zum Einsatz im
nordamerikanischen Unabhängigkeitskrieg verkaufte, fällt der Baron fast ein wenig aus der Rolle, denn er akzeptiert im allgemeInen die Mächtigen und ist stolz darauf, mit ihnen nahezu auf familiärem Fuß zu stehen.
Es ist die Meinung Gottfried August Bürgers, die an dieser Stelle, die im englischen Text fehlt, unmittelbar Eingang in das Buch der Späße und Lügenspielereien findet. Schließlich und endlich ist der Münchhausen ein
Werk Bürgers. Mag die Mehrzahl der Motive alter Überlieferung entstammen, mag Raspe den Anstoß zu Ihrer Versammlung um eine Person gegeben und mögen in Göttingen Georg Christoph Lichtenberg und Abraham Gotthelf
Kästner manchen Einfall beigesteuert haben, geschrieben wurden die Wunderbaren Reisen, so wie sie uns vorliegen, allein von dem Dichter Gottfried August Bürger. Er gab einem Konglomerat von Geschichtchen eine
Sprache, durch die es zum Kunstwerk wurde. Wie stark der Reiz des Buches von seiner sprachlichen Form abhängt, erweist sich nicht zuletzt bei einem Vergleich des echten Bürgerschen Münchhausen mit seinen zahlreichen
Erweiterungen, Nachahmungen und Fortsetzungen, von denen keine die Lebendigkeit und Kraft des Originals erreicht. Bürgers Sprache ist anschauhch und lakonisch zugleich. Sie vereinigt eine durchsichtige,
>vernünftige< Diktion mit der Volkstümlichkeit und Burschikosität des Sturm und Drang. Auf jede Altertümelei wurde verzichtet, sosehr der Stoff mit seinem altdeutschen Stammbaum und eine gewisse Vorliebe des
Sturm und Drang fürs Archaisieren dies nahegelegt hätten. Die lockere Reihung der Episoden hingegen - Erbe der Schwankliteratur - kam dem Geschmack des Sturm und Drang entgegen."
|
|
1995
|
Bernauer, Joachim. “Eine der ersten Erfodernisse des Dichters ist Idealisierung, Veredlung” Die Idealisierkunst-Poetik der Bürger-Rezension von 1790/1791.
In: >>Schöne Welt, wo bist du?<< Über das Verhältnis von Lyrik und Poetik bei Schiller.
"[S. 8] Seine Kritik sieht noch zu sehr an Dir herauf, und ich glaube daß es eine Kritik mit Begeisterung giebt, wobey man
auf den größten Künstler herabsieht. Der Kritiker wird alsdann Repräsentant der Kunst, und erhält seine Würde von
ihr, nicht durch sich selbst. Je größer das Talent des Künstlers, desto höher die Foderungen seines Richters.
[aus Brief Körners vom 11.11.1790 an Schiller; für
die vielen hier nicht aufgenommenen Verweise bitten wir, den Originaltext zu Rate zu ziehen - f.d.R. K.D.]
Fast wörtlich kehrt diese kunstrichterliche Definition am Ende der Bürger-Rezension
wieder.Interessanterweise fügt Körner seiner Bestimmung der idealen Kritik noch einen Satz hinzu, der auf Schiller als Rezensenten mehr zutrifft, als es ihm als Dichter lieb sein konnte: "Solche Kritiken sind
freylich nicht jedermanns Ding, und wer dazu taugt, mag lieber selbst etwas schaffen." Während Körner also davon ausgeht, daß nur ein Dichter, der den eigenen strengen Maßstab auch selbst produktiv umzusetzen
weiß, die postulierte kunstrichterliche Souveränität an den Tag legen könne, wird Bürger angesichts der Schiller'schen Rezension davon überzeugt sein, daß "kein ausübender Meister" deren Verfasser sein
könne: "Er ist kein Künstler, er ist ein Metaphysikus." Bürger trifft damit einen wunden Punkt der Rezension, denn tatsächlich ist Schiller über Jahre hinweg eher ein spekulativer Metaphysiker als ein
produktiver Künstler zu nennen. Mit dem gespannten Verhältnis zwischen Kritik und Kreativität ist ein Konflikt benannt, den Schiller an sich selbst beobachtet - in seiner berühmten Formulierung vom 31. August 1794 an Goethe spricht er von sich als einer "ZwitterArt, zwischen dem Begriff und der Anschauung, zwischen der Regel und der EmpfIndung, zwischen dem technischen Kopf und dem Genie" und den er zugleich als einen grundlegenden Konflikt der Moderne erkennt: Sein philosophierendes Zeitalter gefährde die Posie, ganz besonders die lyrische - mit dieser Diagnose eröffnet Schiller die Bürger-Rezension.
[S. 13] Schiller stellt selbst die Frage: "Aber darf wohl diesem Maßstab auch ein Dichter unterworfen werden, der sich ausdrücklich als 'Volkssänger' ankündigt und Popularität [ ... ] zu seinem höchsten Gesetz macht?" Es handelt sich natürlich um eine rhetorische Frage. Schiller benutzt Bürgers Begriffe nur, um sie mit kunstrichterlicher Souveränität nach seinen Vorstellungen umzudefinieren und Bürger nach dessen vermeintlich eigenem "höchsten Gesetz" anklagen und verurteilen zu können.
[S. 16] In dieser Vision zur ästhetischen Erziehung des Publikums schwingt der alte Topos des poeta doctus mit. Dabei muß die Frage wohl offenbleiben, ob ein Dichter, der seine Dichtung am Geschmack des gebildeten und nicht an dem des breiten Publikums orientieren soll, tatsächlich zu einern "Wortführer der Volksgefühle"
werden kann, oder ob er nicht doch nur akademische, d. h. vermeintliche Volksgefühle zu formulieren vermag.
Seine rhetorische Wirkung jedenfalls dürfte dieser Abschnitt beim zeitgenössischen
Leser kaum verfehlt haben: Angesichts jener phantastischen Wirkungsmöglichkeiten kann auch Bürger gewiß nur ein Volksdichter zweiten Typs sein wollen! Der Begriff wurde geschickt so umgedeutet, daß Bürger in der
Folge dem eigenen Anspruch nicht gerecht zu werden scheint.
[S. 17] Die Frage nötigt zur Feststellung, Bürgers Popularität sei selten "eine Schwierigkeit mehr", sondern meist die einzige,
die er bewältigt habe. Schiller nennt beispielhaft einige Gedichte: einerseits solche, die wohl dem Kenner, andererseits solche, die nur der Masse gefallen könnten - obwohl doch "richtig" das Verdienst des
Volksdichters nicht darin bestehe, "jede Volksklasse mit irgend einem, ihr besonders genießbaren, Liede zu versorgen, sondern in jedem einzelnen Liede jeder Volksklasse genug zu tun" Der Rezensent Schiller
ist allerdings mit der Dichotomisierung der Gedichte Bürgers nicht ganz aufrichtig: Einige Gedichte der ersten Gruppe, etwa "Lenore", fanden ebenso den Beifall der "Masse"; solchen Gedichten
müßte auch Schiller das "Siegel der Vollkommenheit" zuerkennen.
Schillers Maßstab entsprechend müssen die Gedichte zunächst auf ihren absoluten, inneren Wert hin untersucht werden, der
unabdingbaren Voraussetzung für den Beifall des Kenners. Der Kunstrichter muß aber "gestehen, daß er unter allen Bürgerischen Gedichten [ ... ] beinahe keines zu nennen weiß, das ihm einen durchaus reinen,
durch gar kein Mißfallen erkauften Genuß gewährt hätte". Die hierauf folgende 'Mängelliste' Schillers kann im wesentlichen in folgende vier Kategorien unterteilt werden: assoziative Stimmigkeit ("die vemißte Übereinstimmung des Bildes mit dem Gedanken"), sittlicher Gehalt ("die beleidigte Würde des Inhalts"), intellektueller Gehalt ("eine zu geistlose Einkleidung") und Kunstmäßi[g]keit (ein "unechter Reim oder harter Vers"). Diese Mängel an Bürgers Produkten verweisen nach Schiller aber nur auf Mängel der Geistesart des Produzenten. Noch ehe er zur Untersuchung eines einzigen Gedichtes kommt, verkündet der Kunstrichter bereits an dieser Stelle sein Urteil.
Die benannten Mängel störten die geforderte "harmonische Wirkung des Ganzen", konstatiert Schiller - jedoch "war uns diese Störung bei so vollem Genuß um so widriger, weil sie uns das Urteil
abnötigte, daß der Geist, der sich in diesen Gedichten darstellte, kein gereifter, kein vollendeter Geist sei". Mit kunstrichterlichem Impetus fügt Schiller hinzu, was jedem, der ein 'gerechtes Verfahren' für
Bürger wünscht, nicht begreiflich ist: "Man begreift, daß hier nicht der Ort sein kann, den Beweis für eine so allgemeine Behauptung im einzelnen zu führen". Darauf folgen etliche Auszüge aus Bürgers Gedicht "Elegie, als Molly sich losreißen wollte” - ohne jeden Kommentar des Rezensenten. Es bleibt dem Leser überlassen, die vorher beschriebenen allgemeinen Mängel am Gedicht selbst aufzuspüren. Dieses Verfahren ist allerdings zugleich ein gravierender Mangel der Rezension, den Schiller später auch einsieht: 1802 tilgt er die ganze Passage, einschließlich des folgenden Absatzes, einer weiteren "Cruditäten"-Liste des Bürgerischen Geschmacks.
[S. 22] Nach der gründlichen Kritik an der poetischen Form der Gedichte Bürgers fährt Schiller überraschenderweise fort: "So unnachahmlich schön in den meisten Diktion und Versbau ist, so poetisch sie gesungen sind, so unpoetisch scheinen sie uns empfunden."
Die Kritik dringt hier tiefer als zuvor. Stand bisher nur Bürgers veröffentlichtes dichterisches Talent und seine darin erkennbare intellektuelle Reife zur Debatte, so wird jetzt nach psychologischen Ursachen
gefragt, die in der privaten Persönlichkeit des Dichters liegen. Diese wird nur noch tiefer verletzt, indem das dichterische Talent hier als "unnachahmlich schön" gepriesen wird, nachdem es zuvor am
Maßstab der Idealisierkunst gemessen als durchaus unvollkommen disqualifiziert wurde. "Am meisten vermißt man die Idealisierkunst bei Hn. B., wenn er Empfindung schildert; dieser Vonvurf trifft besonders die
neuen Gedichte." Mit einem doppelten Vorwurf sucht Schiller nun Bürgers Empfindungen als nicht poetisch zu entlarven.
Erstens seien Bürgers Gedichte der Spiegel einer zu individuellen
Seelenlage, sie stellten also "das Unideale" dar. Als Kronzeuge dieser Anklage wird Lessing herbeizitiert, der "irgendwo dem Tragödiendichter [!] zum Gesetz macht, keine Seltenheiten, keine streng
individuellen Charaktere und Situationen darzustellen", was der Kunstrichter mit gattungspoetischer Souveränität "noch weit mehr von dem lyrischen" Dichter verlangt. Es handelt sich allerdings um eine
recht sophistische Konstruktion, indem Bürgers Seelenlage als zu individuell bezeichnet wird, um der "allgemeinen Mitteilung" fähig zu sein, aber zugleich als nicht individuell genug, um durch ihre Einzigartigkeit interessant zu sein.
[S. 24] Uneingeschränkt positiv stuft Schiller Bürgers Balladen ein, "in welcher Dichtungsart es nicht leicht ein deutscher Dichter Hn. B. zuvortun wird" sowie seine Sonette als "Mustern ihrer
Art". Den ernsthaft erzählenden Gedichten gibt der Rezensent den Vorzug gegenüber allen lyrisch-satirischen und "bloß witzigen" Stükken. Da es besonders Bürgers frühe Gedichte sind, die positiv
beurteilt werden. kommt Schiller zu dem Schluß, daß sich Bürgers Manier "weder veredelt, noch sein Geschmack gereinigt" habe. Offenbar kommt es Schiller also bei allem Lob für die früheren Gedichte auf die Beobachtung an, daß seither keine positive Entwicklung seitens Bürgers stattgefunden habe. Gerade eine solche Selbst-Ausbildung ist jedoch als eine der Grundvoraussetzungen des Dichter-Berufs benannt worden. Schiller spürt bei alle dem sehr wohl, daß seine Rezension Bürger womöglich nicht ganz gerecht wird:
Wenn wir bei Gedichten, von denen sich unendlich viel Schönes sagen läßt, nur auf die fehlerhafte Seite hingewiesen
haben, so ist dies, wenn man will, eine Ungerechtigkeit, der wir uns nur gegen einen Dichter von Hn. B. Talent und Ruhm
schuldig machen konnten.
Aber wie
schwach und geradezu höhnisch klingt dieser Hinweis, nachdem Schiller in seiner ganzen Rezension nicht ein Wort über das, was er jetzt "unendlich viel Schönes" nennt, gesagt hat, nachdem er "Hn. B.
Talent" so gründlich in Zweifel gezogen hat. Schiller steigert sich von Satz zu Satz in seiner kunstrichterlichen Emphase, um schließlich in geradezu poetischem Ton auszurufen. daß der Dichter "sich von
der Gegenwart loswickeln und frei und kühn in die Welt der Ideale emporschweben soll. Wenn es auch noch so sehr in seinem Busen stürmt, so müsse Sonnenklarheit seine Stirne umfließen." Abschließend wird Bürger
immerhin für wert befunden, sich selbst doch noch zu vollenden und so "die höchste Krone der Klassizität zu erringen" - die hierfür ein letztes Mal namhaft gemachten Bedingungen korrespondieren mit Schillers zuvor aufgestellter 'Mängelliste'; gefordert werden immer gleiche ästhetische und sittliche Grazie, männliche Würde und Gedankengehalt.
[S. 26] Bürgers Antikritik stellt ein 'Mosaik' aus sachlichen Argumenten und Einsicht einerseits sowie überheblicher Polemik und Mißverständnis andererseits dar. Mit philologischer Akribie weist er dem Rezensenten durchaus berechtigt Stilmängel nach, zu recht kritisiert er die kommentarlose Form der Schillersehen Kritik an der "Elegie, als Molly sich losreißen wollte", und auch seine ironisch-resignativ klingende Schlußfolgerung, daß er offenbar "ganz und gar kein Dichter" sei, ist durch die radikalen Formulierungen des Kunstrichters Schiller gedeckt. Und wenn Bürger über den Rezensenten ausruft: "Er ist kein Künstler, er ist ein Metaphysikus. Kein ausübender Meister erträumt sich so nichtige Fantome, als idealisirte Empfmdungen sind.” -so verrät das nur Bürgers Gespür für die Realität; der Rezensent Schiller war seit fast zwei Jahren kein ausübender Künstler mehr und sollte es vorläufig auch nicht wieder werden.
Der vollständige Beitrag in der ONLINE-BIBLIOTHEK.
|
|
1995
|
Freytag, Gustav. Erinnerungen aus meinem Leben. Hg. Horst Fuhrmann.
“[S. 72] Dort, in der dürftigen Herberge, welche die größten und die kläglichsten Geisteswerke gesellte, fiel mir zum ersten Male Walter Scott in die Hände. Die Fülle und heitere
Sicherheit dieses großen Dichters nahmen mich ganz gefangen, durch ihn lernte ich ahnen, was der Dichtkunst die Charaktere bedeuten; ich las alle seine Romane mit immer neuem Entzücken durch. Bald freilich wurde
Cooper mit den ersten Indianer- und Seeromanen in der Seele des Knaben sein Rival, beide sind mir noch heut Hausfreunde geblieben, mit denen ich oft verkehre. Und ich habe ihrer freudigen epischen Kraft Vieles zu
danken.
In der Klasse sagten wir Gedichte nach eigner Wahl her. Zum Vortrage trat der Aufgerufene in den freien Raum vor den den Bänken und es wurden ihm dabei einige Handbewegungen zugemuthet.
Das war für jeden eine schwere Aufgabe, und der Neuling mußte sich einigemal gefallen lassen, daß die Andern ihn auslachten. lch hatte zum ersten Debut Bürgers Entführung gewählt und ich glaubte ein gutes Werk zu
thun, als ich das lange Gedicht auswendig lernte. Aber der Vortrag kam nicht bis zum Ende, denn als ich bedrückt und kläglich mit vorgestecktem Arme begann: "Knapp, sattle mir mein Dänenroß", lachte der
strenge Conrector Kiesewetter, daß er schütterte, und die Klasse folgte ihm darin willig nach. Das wurde mir eine Lehre, ich wählte später Kürzeres mit weniger aufregendem Anfang, bis ich endlich durchsetzte, meine
Sache so wohl und übel zu machen wie die Übrigen. Aber die Poesie unserer großen Dichter? AIImählich, erst spät und ohne daß mir die Größe ihres Einflusses auf meine Bildung im Bewußtsein geblieben ist, kamen sie
mir zu.”
|
|
1995
|
Scherer, Helmut. Trauriges Beispiel. In: Lange schon in manchem Sturm und Drange / Gottfried August Bürger / Der Dichter des Münchhausen. Eine Biographie.
“[S. 303] Die Würdigungen zum 8.Juni 1994 signalisierten mit Schlagworten wie "Skandal, Frauenfreund, Liebeshändel, armer Teufel", wie weit
man sich von dem feinsinnigen Resümee Goethes über das Leben des Dichters entfernt hatte. »Trauriges Beispiel: Bürger«, stellvertretend für so viele Lebensläufe, in denen »ein außerordentlicher Mensch sich gar oft
mit sich selbst, seinen Umständen, seiner Zeit herumwürgt, ohne auf einen grünen Zweig zu kommen«. Daß der Dichter auch außergewöhnlich begabt war, unterstrich Jahre später an anderer Stelle der alte Herr aus
Weimar: »Bürgers Talent anzuerkennen kostete mich nichts, es war immer zu seiner Zeit bedeutend; auch gilt das Echte, Wahre daran noch immer und wird in der Geschichte der deutschen Literatur mit Ehren genannt
werden«. Aber nicht nur die Heroen der deutschen Literatur ehrten Bürger, auch das zeitgenössische Publikum bewunderte ihn. Im letzten Drittel des 18.Jahrhunderts gehörte Bürger zu den meistgelesenen deutschen
Dichtern. Seine Lenore war ein bravouröser Auftakt zu einer neuen literarischen Gattung: der Kunstballade. Mit dem Verweis der späteren Literaturgeschichtsschreibung in die zweite, vielleicht auch dritte Reihe in einer Nation, die nur erste zuläßt, ist noch lange kein Urteil über seine dichterischen Qualitäten gefällt. Doch welche Lebensstrecke vom »außerordentlichen Menschen« zum »traurigen Beispiel«.
[S. 304] Es fällt auf, daß gerade jene, die ihn bewundern, die vorgeben ihn zu verstehen, sein Leben nicht rückhaltlos akzeptieren. Wo die einen seine »sittlichen Verfehlungen« mißbilligen, verschweigen die
anderen seinen aufwendigen Lebensstil, seine tatsächliche Finanzsituation und andere ungeliebte Wahrheiten. Welch eine Verehrung, die nur einen geglätteten Bürger zuläßt! Bürgers Leben war zuallererst ein Kampf mit
sich selbst.
[S. 306] Die sehr hohen Ausbildungskosten an den Franckeschen Anstalten sind bekannt, um so mehr verwundert es, wie manche Lebensbeschreibung des Dichters den Sprung aus den Ȋrmlichsten
Verhältnissen« zum Ausbildungsplatz »einiger Adlichen und Herrenstandes Kinder« problemlos bewältigt.Warum in all den Veröffentlichungen kein Wort zu den immensen Kosten, warum kein Vergleich mit den Einkünften der
Bevölkerungsmehrheit? Schnell hätte man feststellen können, wie privilegiert der junge Bürger heranwuchs. Bereitwillig hatte der Großvater, dem ein männlicher Nachkomme selbst nicht vergönnt war, all seine Wünsche
und Träume auf den einzigen Sohn seiner Tochter übertragen.
[S. 307] Vom Beginn seines künstlerischen Schaffens an rückt Bürger die Philologie, die dichterische Übersetzung in den Mittelpunkt. Seine Stärke
liegt darin, fremdsprachige Werke seinem poetischen Duktus zu unterwerfen. Die Übersetzungen Homers, Shakespeares und anderer bindet er häufig in sein sprachlich-regionales Umfeld ein. In diesem Schaffensprozeß
entfernt er sich von der Vorlage und geht weit über sie hinaus. So manifestiert sich Originalität eben auch dort, wo es im wissenschaftlichen Quellenverweis heißt: »nach Bernard, nach Pope, nach Horaz«. Sein
berühmtestes Werk, die Wunderbaren Reisen ... des Freiherrn von Münchausen, eben auch »nach Raspe«. Schöpferisches im eigentlichen Sinne findet sich vor allem da, wo persönliche Lebenserfahrungen, so in den
Molly-Liedern, die Grundlage bilden. Gerade Schillers Kritik an diesen Gedichten, an dem großen Anteil, »den das eigene Selbst des Dichters« hat, verrät einmal mehr, daß nicht mit Bürgers Werk, sondern mit der
Epoche des Sturm und Drang abgerechnet werden sollte. In Leben und Werk verkörperte keiner so wie Bürger ihre Merkmale: pietistischer Einfluß, Shakespeare- und Homerbegeisterung, Hinwendung zur Volksdichtung,
Ursprünglichkeit und Tiefe der Empfindung, kraftvolle, alltagsnahe Sprache. Es ist nicht verwunderlich, daß Bürger, lange bevor der Begriff mit Friedrich Maximilian Klingers Theaterstück Sturm und Drang als
Epochenbezeichnung festgeschrieben wurde, diesen literarischen Topos mehrfach in seinen Werken und auch in seinem Leben verwendete.
[S. 309] Entgegen allen späteren Verlautbarungen verfügte Bürger zeitlebens
über außerordentliche Geldmittel, mit denen er sich gegenüber dem größten Teil der Bevölkerung einen privilegierten Lebensstil erlaubte. Dennoch gab er stets noch mehr aus, als er besaß, wollte dem Leben immer mehr
abtrotzen, als seine finanziellen Möglichkeiten hergaben. Kein Wunder, daß drängende Gläubiger zu seinem Alltag gehörten. [...] Unter welch unsäglichen Bedingungen verlief dagegen das kärgliche Dasein der Bauern und
Handwerker. Man lese nur die Geschichte über das Dorf und Kloster Weende oder die Lebensbeschreibung der Kindesmörderin Catharina Erdmann Vermutungen über ein argloses Leben, mit deren Fall der Amtmann
Bürger beschäftigt war.
[S. 310] Sicher, Bürgers Arrangement mit den beiden Schwestern war nicht alltäglich und würde auch heute noch Aufsehen erregen. Doch ohne diese Pikanterie bleibt davon nur übrig, was
allerorten auch im so kleinstädtisch-biederen Göttingen des 18. Jahrhunderts vorkam: Ein Ehepartner betrügt den anderen. [...] Es war wohl weniger das Dreiecksverhältnis mit Dorette und Molly selbst als vielmehr
Bürgers Umgang mit diesem, was die Aufgeregtheit seiner Zeitgenossen hervorrief. Was andere tunlichst zu verbergen suchten, brachte der Poet an Öffentlichkeit, so in seinem Gedicht Untreue über alles.Darüber
entrüstete man sich, nahm ihm übel, daß er sich nicht an Konventionen hielt, und strafte ihn mit gesellschaftlicher Ächtung.
[S. 311] Unbedingtheit im Ausleben seiner Bedürfnisse über gesellschaftliche
Schranken hinweg, Ehrlichkeit ohne Versteckspiel, ohne taktische Manöver, alle Nachteile inbegriffen, bestimmten seine Persönlichkeit. Daß diese Kompromißlosigkeit das Leid anderer einschloß, darf bei allem Respekt
nicht vergessen werden.
[S. 312] Dem politischen Dichter gilt die uneingeschränkte Sympathie, wenn auch im täglichen Leben Bürgers abfällige Urteile über den unteren Stand sowie seine Versuche, es in
Sinnenfreuden dem Adel gleichzutun, unübersehbar sind. So prägten nicht Auflehnung und Protest, wie so oft behauptet, sein Verhältnis zu den meisten Mitgliedern der Familie von Uslar, vielmehr bewunderte ihr größter
Teil den Dichter und war mit ihm befreundet. [...] Wenn von Bürgers politischem Bekenntnis die Rede ist, darf nicht nur an sein berühmtes Gedicht Der Bauer. An seinen Durchlauchtigen Tyrannen gedacht werden. Zu vordergründig, zu modisch, zudem in Anlehnung an Klopstocks Ode Wir und Sie entstanden, läßt dieses zwar rhetorisch meisterhafte Pamphlet nicht in seine Seele schauen. Wie anders dagegen die poetischen Äußerungen des gereiften Dichters 15 lahre später: stille Manifestationen. die die Zensur, die Aufgeregtheit der Herrschenden nie passiert hätten. Schon weniger Provokatives, vom Dichter versteckt geäußerte Stellungungnahme zur Französischen Revolution im Musenalmanach für das Jahr 1793, gaben Anlaß zu Verärgerung, Kritik und Verbot. So sind seine eindringlichen Gedichte und Reden vor der Freimaurerloge in Göttingen nur aus seinem Nachlaß bekannt. Sie offenbaren, daß sich Bürger durch die blutigen Ereignisse in Paris nicht wie viele von seiner politischen Einstellung abbringen ließ. Für ihn ging es nicht um einzelne Begebenheiten, die von seinen Dichterkollegen nach Bedarf bejubelt oder verdammt wurden. Für ihn war die über allem stehende Freiheit des einzelnen keine Farce, keine politische Idee, die man für die eigenen Ziele mißbrauchen konnte, sondern unverrückbares politisches Ideal, für das es sich einzusetzen lohnte.”
Das vollständige Kapitel XIV Trauriges Beispiel in der ONLINE-BIBLIOTHEK.
|
|
1995
|
Fontane, Theodor. An Wilhelm Wolfsohn (22. Februar 1851). In: Werke, Schriften und Briefe. München.
“[S. 443] Geduld, Geduld! wenn´s Herz auch bricht,
Mit Wilhelm Wolfsohn hadre nicht:
Des Anfangs ist er ledig,
Gott sei dem Ende gnädig.
“
|
|
1996
|
Ritter, Heidi. Gottfried August Bürger: Die Erfahrung der Leidenschaft. In: Liebesgedichte von Gottfried August Bürger. Hg. Heidi Ritter.
"[S. 108] Für einen leidenschaftlichen Menschen wie Bürger mußten die Konventionen von Liebe und Ehe, in die er sich in seiner Zeit gestellt sah, fast notwendigerweise in eine
Lebenskonstellation führen, die von der Gesellschaft verurteilt wurde. Er erlebte die Liebe zwischen Mann und Frau als etwas Elementares und bejahte dies zutiefst. Aber er litt auch daran, daß seine Leidenschaft mit
den Regeln der Gesellschaft nicht zu vereinbaren war. Für seine Dichtungen wird die erfahrene Liebe zum entscheidenden Beweggrund, zu einer Energie, die neuartige poetische Figuren hervorbringt und ihn zu einem der
großen Liebeslvriker der deutschen Literatur werden läßt.
[S. 113] Für Bürger wird immer mehr sein eigenes Erleben, vor allem seine sehnsüchtige Liebe, zum Anlaß seiner Poesie. Er steht damit in jenen Jahren nicht allein. Die Dichter der
jungen Generation, die um 1750 geboren waren, suchten die umfassende Erfahrung der eigenen individuellen Kräfte, seien es die geistigen, körperlichen oder seelischen und nahmen diese Erfahrung ihrer selbst in einem
Maße, wie es das vorher nicht gegeben hatte, zum Ausgangspunkt von Literatur.
[S. 114] Bürger ist neben Goethe dafür das herausragende Beispiel, beide haben in ihren Liebesgedichten eine hohe Intensität von sinnlichen Begehren als einen Beweggrund von Liebe zu
vermitteln vermocht, aber nur bei Bürger erscheinen Sinnlichkeit und Lust so unverschlüsselt als eine starke Quelle von Glück.”
|
|
1996
|
Höhle, Thomas. Vorwort. In: Liebesgedichte von Gottfried August Bürger. Hg. Heidi Ritter.
"[S. 5] In der deutschen Literatur fand eine solche Wiederentdeckung der Liebe als Welt- und Lebensmacht für die Dichtung im 18. Jahrhundert, in der Zeit des Sturms und Drangs
statt. Es waren vor allem zwei Dichter, die diese Wiederentdeckung machten: Goethe und Bürger. In dieser ihrer Liebeslyrik waren sie sich eine Zeitlang ebenbürtig. [...] Das unwiderstehliche Hingerissensein, das
Bürger seiner geliebten Molly gegenüber empfand, floß in manche seiner Gedichte ein. Die besten dieser Liebesgedichte Bürgers wirken gar nicht altertümlich, gar nicht verstaubt, sie sind ganz echt und wahr, voll
gegenwärtig, sie sind gleichsam von gestern und heut. Ja, in ihrer natürlichen Erotik, in ihrer mitunter fast unverblümten, damals ungeheuer kühnen Sexualität wirken manche von ihnen sogar ganz modern. Jeder und
jede Liebende, jeder und jede sich nach Liebe Sehnende kann sich an ihnen freuen, sich in ihnen entdecken, in ihnen steigern.
[S. 6] Und mit seiner Liebeslyrik hat Bürger etwas von dieser Unsterblichkeit errungen. Eine Unsterblichkeit, die er bei manchen Menschen wenigstens der Möglichkeit nach gefunden hat.
Er wollte von vielen, vom Volk, auch von den einfachen Leuten, gelesen und verstanden werden. Und er kann verstanden werden. Mit seiner Liebeslyrik ist Bürger wahrscheinlich lebendiger geblieben als mit seinen
seinerzeit so berühmten und hoch geschätzten Balladen, die aber zum Teil auch zur Liebesdichtung gehören, und seinen bedeutenden politischen Dichtungen.”
|
|
1996
|
Anderle, Martin. Wiener Lyrik im 18. Jahrhundert. Die Gedichte des Wiener Musenalmanachs 1777-1796.
“[S. 74] Ähnlich behauptet Winkler von Mohrenfels in "Damengeschmack", daß die Damen seiner Zeit sich ohne weiters mit dem in einen Stier verwandelten Jupiter einlassen
würden. Womöglich noch gröber sind "Noch ein Gleichniß", ein Gedicht, das die Gemeinsamkeit von Lieben und übermäßigem Trinken in der endlichen Entladung sieht, und "Liebeserklärung eines Poeten an
ein Mädchen", worin der Verfasser J. eine elegante, seinen inneren Werdegang beschwörende Anrede an die Dame seines Herzens in einer Weise abschließt, die ihn zugleich als Dichter sowie als potentiellen
Liebhaber auszeichnen soll:
Ja. Kind, ich wähle dich, ob Hals und Mund und Waden,
Ob Busen, Arm, und Augen und Gesäß
Zum auserlesenen Gefäß.
Mich meiner Liebe zu entladen.
Gottfried August Bürger mit "Frau Schnips" und anderen freizügigen Versen bewies nicht nur bessere Dichtkunst, sondern
auch immer Menschlichkeit statt der hier zu Tage tretenden Laszivität.”
|
|
1996
|
Kravitt, Edward F. The Ballad and the Kinderlied. In: The Lied: Mirror or Late Romanticism, Yale
“[S. 129] Although he wrote in a late-romantic style that was then on the wane, Mattiesen was the most forward-looking of the three. His first Opus, the ballad ´Lenore´ (1913), is
typical of his work and one of his best ballads. This long song by Gottfried August Bürger (1747-94) - thirty-two stanzas of eight lines each, a prototype of romantic ballad poetry - is filled wilh the ghastly
imagery that many composers (Zumsteeg, Loewe, Liszt) detailed in tone. In his vast setting of forty-five pages, Mattiesen sketches a different musical illustration for practically every line of text: the
´trapp, trapp, trapp´ of the horses' hooves (ex. 40a), the croaking of toads (piano-vocal score, p. 33), gravel and sparks flying about (p. 40), and several references to moonlight (exx. 40b and 40c), each of which
is painted with a similar recurring motive (see also pp. 25, 29, 36, 44), which contributes to the ballad's musical unity. Mattiesen's target here as in his other ballads is the creation of a frenzied mood, which
betrays the influence of Plüddemann and Wolf. The piano parts in all his ballads are of bravura proportions that approach bombast. Even his advocate Hans Joachim Moser is forced to admit: ´Stylistically Mattiesen
mixes older and newer idioms somewhat indiscriminately, yes naively.´ To his credit, Mattiesen conjures up moods that are acrid and harrowing, like those of his ballad poetry.“
|
|
1997
|
Grimm, Gunter E. Gottfried August Bürger: Gedichte. Hg. Gunter E. Grimm. Stuttgart: Reclam
“[S.186] Wie in den Balladen bricht auch in ihnen etwas ungebändigt Rohes durch; zu sensibler Anschauung der Liebe ist Bürger weder willens noch fähig. Allen seinen Liebesgedichten
haftet bis in den Wortschatz etwas Peinlich-Peinigendes, Pubertär-Unausgegorenes, Grob-Sinnliches an.”
|
|
1997
|
Gunter-Kornagel. Luise. Das Liebesopfer, Oper in vier Aufzügen. In: Weltbild in Siegfried Wagners Opern.
“[S. 231] Hellmuth entscheidet sich schließlich für "Frau Schnips" von Gottfried August Bürger. Da taut Wernhart auf: "Die an der Himmelstüre?" fragt er, und
Hellmuth bejaht. Wieder reagiert Frau Hedwig pikiert. Da beginnt auch schon der Sänger mit einigen Strophen der volkstümlich-vulgären Ballade, über die einst der Schriftsteller Lichtenberg ermunternd schrieb, "Bürger
solle lieber das gesamte Weltgefüge ändern als eine Zeile dieses Gedichts ".
Der Poet überschreibt sein Werk "Ein Märlein, halb lustig, halb ernsthaft, samt anhängender Apologie ".
Die leckere, lockere Frau Schnips pocht nach plötzlicher Beendigung ihres Erdenlebens an die Himmelspforte und begehrt Einlaß, der ihr wegen des sündhaften Lebenswandels verwehrt wird. Sie steht Adam
gegenüber, der "Frau Sünderin, Frau Liederlich, Frau Lecker" den Zutritt verneint und von ihr als "alter Sündenhecker " beschimpft wird. Daraufhin schickt Jakob sie zum Teufel. Madame Schnips kontert mit seiner Prellerei und nennt ihn "Fickfacker". Lot eilt herbei "mit Brausen und mit Schnarchen".
Kaum sieht sie den Alten, sagt sie ihm den Beischlaf mit den Töchtern auf den Kopf zu. Judith bezeichnet sie als "Gurgelschneiderin ". König David erhält eine Abfuhr, und Salomo ergeht es nicht besser: "Sieb'nhundert
Weiber auf der Streu" und dreihundert andere noch nebenbei,da hat ihr seine Moralpredigt gerade noch gefehlt. Angesichts ihres Schwadronierens kann Jonas nur feststellen: "Das Weih speit wie ein Drache!"
Dem Thomas hält die streitbare Dame Unglauben gegen den Heiland vor, und über Maria Magdalenas Anwesenheit weiß sie sich kaum zu fassen. Apostel Paul erinnert sie an die Zeiten, wo er mit Lust mordend durch die
Lande zog. Peter schleudert sie Verleugnung ins Gesicht. Da kommt endlich "der liebe Herr", umringt von tausend Engeln, und nimmt, nachdem er Frau Schnips eine Standpauke gehalten, die arme Seele in
sein Himmelreich auf.
Die Apologie rechtfertigt die dreiste Satire auf die biblischen Moralisten. die aus verlogener Obliegenheit begnadigen und verdammen. Aber ist die Liebe als vielbesungene Himmelsmacht
nicht in gewisser Weise jenseits von Gut und Böse?!”
|
|
1997
|
Raabe, Paul. Im steten Kampf mit sich selbst. In: Mitteldeutsche Zeitung, 29. Dezember S. 7
"Als Goethe und Schiller vor 200 Jahren in ihren "Xenien" in einem Rundumschlag über die zeitgenössische deutsche Literatur und über alles, was Aufklärung hieß, den Stab
brachen, lebte Gottfried August Bürger nicht mehr. Er war 1794 an der Lungenschwindsucht im Alter von 46 Jahren gestorben: Ein seelisch und körperlich gebrochener Mann.
Er hatte noch erleben müssen,
wie ihn einer der beiden Klassiker, Friedrich Schiller, in einer Rezension auf eine infame, unverzeihliche Weise wegen des volkstümlichen Stils seiner Gedichte und Balladen nicht nur abkanzelte, sondern zugleich
moralisch vernichtete. [...] Aber in einem anderen Sinne ist Bürger ein "trauriges Beispiel". Das Verdikt der Klassiker hat dazu beigetragen, daß dieser Dichter der Sturm- und Drangperiode, in der die
Aufklärung zugleich in literarischer Hinsicht einen Höhepunkt hatte, nie den Platz in der deutschen Literaturgeschichte erhalten hat, der diesem genialen und zugleich unglücklichen Autor zukommt."
|
|
1998
|
Matt, Peter von. Ein armer Teufel großen Stils: Gottfried August Bürger. In: Die verdächtige Pracht. Über Dichter und Gedichte.
“[S. 162] Beide, Lenz und Bürger, waren geniale Köpfe und arme Teufel großen Stils, deutsche Dichter, denen die Liebeskraft und eine herrliche Kreativität immer nur zum Unheil
ausschlug. In beiden tobte die Idee der Epoche, die Freiheit eines neuen, kühnen, naturhaft sinnlichen Subjekts und beide wurden sie, wie Heine es auf Bürger hin formulieren sollte, "zu Tode gequält" von
den "Junkern und Schulpedanten" eines Deutschland, das hundert verzopfte Kleinstädte und keine Metropole besaß. Gewiß, sie trugen wacker bei zu ihrer Lebenskatastrophe, aber diese Unfähigkeit, im richtigen
Moment "Contenance zu halten" und alle Erregung, das ganze neue Wissen von einem neuen Ganzen, nur literarisch abzuleiten, war eben das genuine Brandmal ihrer historischen Stunde. Sie wollten leben, wie
sie schrieben, und schreiben, wie sie lebten, und das brach ihnen das Genick. [...] Bürger hat das deutsche Gedicht zu einem Ereignis aller fünf Sinne gemacht. Wie das deutsche Theater vorn sozialen Scharfblick
Lenz',lebt der deutsche Vers bis heute von Bürgers melodischem Sensualismus - ob das die Dichterinnen und Dichter nun selber wissen oder nicht. Seine Balladen bliesen das literarische Rokoko mit einem einzigen Stoß
ins Museum. Die "Lenore", ein Gedicht, das nichts ist als ein trommelnder Ritt durch die Nacht, wirkte noch auf Goethe so obsessiv, daß er es sich mit einem zweiten Ritt durch die Nacht, dem
"Erlkönig", vom Leib schreiben mußte. Und Schiller debütierte in seiner "Anthologie auf das Jahr 1782" als unverstellter Bürger-Epigone. Das wurde ihm dann später so peinlich, daß er den
Vorgänger öffentlich exekutierte.
[S. 163] Auch hier steht Bürger wieder seltsam neben Lenz. Wie Goethe diesen aus Weimar wegschafIen ließ, vertrieb ihn Schiller mit seiner Attacke aus dem Kreis der Anerkannten und
Gültigen. Dennoch dürfen diese Vorgänge nicht voreilig beurteilt werden, sosehr man sich zur Solidarität mit den Opfern gedrängt fühlt. Auch hier schlagen historische Prozesse auf die Lebensgänge durch. In Lenz wie
in Bürger hauste eine Wertherische, eine Karl-Moorische, eine zerstörende Radikalität. Das war den zwei Großen in Weimar ihrerseits nicht unbekannt. Mit der Abfertigung der Genies, die ihnen einst nahe gestanden
hatten, vollzogen sie auch einen Exorzismus am eigenen Leib. Und so schrecklich Schillers Pamphlet für Bürger war, es stellt doch gleichzeitig ein imponierendes Manifest der neuen ästhetischen Theorie dar. Auf
diesen Text geht übrigens auch die These zurück, daß nur ein sittlich integrer Mensch ein guter Dichter sein könne - eine schiefe Behauptung, die aber immer wieder durch das literarische Deutschland geistert.
Genie und Pech des "unglückseligen, leichtsinnigen, vortreffiichen Bürger" zeigt nichts so deutlich wie seine bekannteste Schöpfung. Sie besteht in einem einzigen Satz. Jeder kennt den Inhalt,
wenige nur den Urheber. Für das ganze Buch, worin der Satz steht, erhielt Bürger keinen Pfennig. Gutmütig, wie er war, schenkte er es seinem Verleger, der gleich ein tolles Geschäft damit machte. Das Buch sind die
"Wunderbaren Reisen zu Wasser und zu Lande des Freiherrn von Münchhausen", die legendären Lügengeschichten, die Bürger teils übersetzt, teils selbst erfunden hatte. Zu den eigenen Schöpfungen gehört die
Szene, wo der reitende Münchhausen "bis an den Hals in den Morast" gerät. Worauf es heißt: "Hier hätte ich unfehlbar umkommen müssen, wenn nicht die Stärke meines eigenen Armes mich an meinem
eigenen Haarzopfe, samt dem Pferde, welches ich fest zwischen meine Knie schloß, wieder herausgezogen hätte."
Auch wer sich um die rollenden Strophen und läutenden Verse Bürgers wenig
kümmert, wem der historische Durchbruch zu einer neuen lyrischen Körperfröhlichkeit gleichgültig ist, wer als solider Mensch mit Gedichten überhaupt nichts am Hut hat - angesichts dieser mythischen Szene, die heute
unzerstörbar im kollektiven Bewußtsein wohnt, wird er zugeben müssen, daß sie allein schon Grund genug wäre, ihres Erfinders rnit Sympathie zu gedenken.“
|
|
1998
|
Plumpe, Gerhard. Ästhetische Lesarten oder Die Überforderung der Literatur durch die Philosophie. In: Ästhetik im Prozeß, Hg. G. Rupp.
“[S. 40] Was hält der philosophische Kritiker [Schiller] dem Dichter der Lenore nun aber vor? Seine Resonanz im Lesepublikum; sie ist es, die Schiller verdächtigt und auf ein ebenso erfolgreiches wie skandalöses Schreibprogramm zurückführt. Bürger habe bei den Leuten Erfolg, weil er ihre Erwartungen bediene, sie unterhalte und ihre Phantasie mit Pikantem stimuliere. [...] Das ist dem Philosophen - auch wenn es die Leute interessiert - natürlich zu wenig; die Literatur hat ´höhere´ Aufgaben: Ihr vornehmstes Ziel müsse es sein, das ´Ideal´ der Menschheit zu fassen, keineswegs aber in effekthascherischer Absicht etwa nur dessen Bestandteile - und dann noch die bloß ´sinnlichen´. Das der Poesie aufgegebene ´Ideal´ des Menschen aber ist das philosophische Phantasma einer Totalität, die aus der Gegenwart entschwunden ist.
[S. 42] Wenn diese mentale, diskursive und soziale Reintegration der Gesellschaft durch die Kraft ´populärer´ Poesie die eigentliche Aufgabe der Dichtung ist, dann ist Bürgers Unterhaltungsliteratur nicht
nur ein müßiges Geschäft, sondern ein geradezu amoralisches Unterfangen, das die Misere der Gegenwart nur noch vertieft, statt sie in ihren Ursachen zu kurieren. Ist die Dichtung zudem - wie Schiller suggeriert -
Ausdruck der ´Individualität´ ihres Urhebers, dann fällt über Bürger und sein Leben - von dessen Eskapaden jeder wußte - sogleich der dunkle Schatten des erhobenen Zeigefingers.
´Kein noch so großes Talent
kann dem einzelnen Kunstwerk verleihen, was dem Schöpfer desselben gebricht, und Mängel, die aus dieser Quelle entspringen, kann selbst die Feile nicht wegnehmen.´ Von der Wirklichkeit der Literatur und den
Interessen ihrer Leser ist diese in ihren philosophischen Präsuppositionen ebenso zeittypische wie verstiegene Kritik Schillers abgründig entfernt gewesen. Das hat nicht nur das Schicksal späterer
literaturpolitischer Projekte wie Die Horen gezeigt. Während Bürger - wohl zu Recht - bezweifelte, ob das Postulat einer ´idealisierten Empfindung´ literarisch jemals ´interessant´ gemacht werden könnte, haben Schillers ´populäre´ Dichtungen nicht verhindern können, verspottet zu werden, statt die intellektuellen Spötter ´ins Volk´ zu integrieren.
[S. 51] Problematischer aber ist vielleicht etwas anderes. Könnte es nicht sein, daß sich die literarische Kommunikation von ihrer philosophischen Beobachtung so hat beeindrucken lassen, daß sie in
Versuchung stand, deren Gesichtspunkte zur Selbstprogrammierung zu importieren? Begleitet nicht die Literatur - zumal im intellektuellen Milieu der vom philosophischen Idealismus so geprägten Kultur Deutschlands -
gewissermaßen die stete Befürchtung, nicht ´tief´ genug, d.h. für die philosophische Beobachtung nicht ergiebig genug zu sein; anders als im rhetorisch geprägten Milieu der französischen Kultur und anders auch als
im anglo-amerikanischen Milieu, das pragmatische Mentalität mit intellektueller Freude an raffinierter Unterhaltung verbindet? Das sind natürlich Klischees, aber es bedarf gewiß einer Erklärung für den Dauerverdacht
gegen ´erfolgreiche´ Literatur hierzulande, nicht nur als Attitüde eines akademisch geprägten Publikums, sondern vor allem auch als Selbststilisierung literarischer Kommunikation, die - schroff ausgedrückt -
Mißerfolge am Markt fast als Beweis ästhetischer Qualität hinzustellen gewohnt ist. So gilt etwa das literaturästhetische Dogma, angesichts einer ´komplizierten´ Welt ließe sich nicht mehr legitim erzählen; wer es
dennoch versuche - gar noch erfolgreich - sei zweifellos trivial.“
Der vollständige Beitrag in der ONLINE-BIBLIOTHEK
|
|
1998
|
Foot, Mary Hannay (1846-1918). Watch-Night. In: Where The Pelican Builds and Other Poems. University of Sydney Library. Sydney.
“[o.S.] Watch-Night
[...]
Ere the tightening of the tether
Bind THIS YEAR and us together,
Let us pause awhile and ponder,—“Whither tend we side by side,—
He who gallops,—we who guide?—
Once we start,—like lost LENORE,
Sung in Bürger's ballad-story,
Fast as ODIN'S Hunt,—we ride! “
|
|
1998
|
Schimmel, Annemarie. Die Träume des Kalifen, München. Vorschau bei Google
“[S. 41] Tatsächlich hatten und
haben die Muslime feste Regeln, wie sich ein Traum zu Tag und Stunde verhält, in der man ihn sieht. Der Prophet sagte, der wahre Traum sei der in der Morgenfrühe. Wer würde hier nicht an Bürgers Ballade denken:
Lenore fuhr ums Morgenrot
empor aus schweren Träumen (...)?”
|
|
1999
|
Hartmann, Geoffrey H. False Themes and Gentle Minds. In: A Critic's Journey: Literary Reflections, 1958-1998 Yale
“[S. 127] Gottfried August Bürger was a witting cause of the ballad revival in Germany and an unwitting influence on Wordsworth and Coleridge. His ballads, first collected in 1778,
sent pleasurable shudders through the sophiscicated literary circles of Europe. Their influence reached England in the 1790s: Scott became a ballad writer because of him, and Anna Seward describes how people
petitioned her to read them Bürger's most famous work, the Lenore: ´There: was scarce a morning in which a knot of eight or ten did not flock to my apartments, to be poetically frightened: Mr. Erskine, Mr.
Wilberforce - everything that was everything. and everything that was nothing, flocked to Leonora ... . Its terrible geaces grapple minds and tastes of every complexion.´ Bürger is like the country boy in the fairy
tale who finally taught the princess to have goosepimples by putting a frog in her bed. Yet, like almost every poet of the period, his first treatment of supernatural themes was jocose. Staiger shows that what began
as a literary flirtation led suddenly to genuine ´terrific´ ballads. The sorcerer's apprentice is overpowered by spirits he had evoked playfully.“
|
|
2000
|
Kosny, Witold. Adam Mickiewicz und Gottfried August Bürger. In: Adam Mickiewicz und die Deutschen: eine Tagung im Deutschen Literaturarchiv Marbach am Neckar.
“[S. 68] Auch Mickiewicz gehörte zu den Bewunderern Schillers, doch in der Auseinandersetzung um Bürgers Gedichte scheint er gegen ihn die Position Schlegels eingenommen zu haben. In
dem 1822 anonym als Vorspann zu der Übersetzung von Bürgers "Der wilde Jäger" ("Mysliwiec") von Antoni Edward Odyniec erschienenen Beitrag zu Gottfried August Bürger schreibt Mickiewicz über
Schillers Kritik: "Die berühmte, wenn auch oft ungerechte Rezension seiner Schriften durch Schiller hat durch ihre Galligkeit die Tage des ohnehin schon unglücklichen Poeten vergiftet. Gerechter beurteilt ihn
Schlegel."
Deutlicher als dieser Passus, der eher moralische Bedenken anführt, zeigen das anschließend von Mickiewicz angeführte längere Zitat aus Schlegels Bürgerverteidigung und vor allem die
Schiller wiedersprechende Deutung Bürgers als eines die sozialen Klassen übergreifenden Volksdichters, daß er die Rolle des "Lenore"-Autors für die deutsche Literatur hoch einschätzt: "Niemand kann
sich einer vergleichbaren Popularität wie er rühmen. Die Balladen und Lieder Bürgers, im Volke gesungen und vorgetragen, sind zu nationalen Liedern geworden und haben das Talent vieler Jünglinge geweckt."
Michiewicz folgt hier offensichtlich der Auffassung Bürgers, daß Popularität Ausweis eines poetischen Wertes sei.
[S. 69] Am Ursprung von Mickiewiczs Bürgerbewunderung steht nicht unmittelbar die deutsche Originalballade, sondern Wassilij Schukowskijs russische Übersetzung, die bereits 1808
erschienen ist, aber erst zehn Jahre später im Wilnaer Philomatenkreis für schöpferische Aufregung sorgte und eine Balladomanie auslöste.
[S. 73] Nicht Mickiewicz, sondern sein jüngerer Philomathenbruder, späterer Briefpartner und Reisebegleiter, Antoni Edward Odyniec, ist der polnische Bürgerübersetzer seiner Zeit. Neben der Übertragung
von "Das Lied von Treue", "Der wilde Jäger", "Des armen Suschens Traum" und "Lenardo und Blandine" verfaßte er 1822 und 1825 zwei "Lenore"-Versionen, die in
Konkurrenz zu vier weiteren zeitgenössischen Adaptionen verschiedener Autoren standen: neben dem bereits genannten Krystyn Lach Szyrma, Julian Ursyn Niemcewicz, Tomasz Zan und Julian Bogucki.”
|
|
2000
|
Siegmund, Wolfgang. John Brickman 1814-1870, ein Lebensbild. Rostock.
“[S. 21] Neben dieser wilden Seite des Knaben zeigt sich schon sehr früh sein Interesse für die Dichtung, was auf eine empfindsame Seele des Heranwachsenden schließen lässt. Nicht
zuletzt hatte der Vater einen großen Anteil daran. Doch lassen wir Brinckman selbst zu Wort kommen: ´Während jener langen Winterabende, an denen mein Vater zu Hause war - er hatte eher gern häusliche Gewohnheiten
und sehr selten verbrachte er seine Freizeit außerhalb - erzählte er seinen Kindern Geschichten von der See, oder er las ihnen Gedichte von Körner und Bürger vor, denn er hatte eine große Vorliebe für Poesie, und
Körners ,Leyer und Schwert' war sein beliebtestes Buch. Ich erwähne das nur, weil es für meine eigene Vorliebe für klassische Poesie Bedeutung hat, die früh aus meinem siebenten Lebensjahr datiert und seitdem für
mich ein übervoller Vorrat von Erholung und Trost war. Als ich neun Jahre alt war, kannte ich schon alle größeren Gedichte der obengenannten Autoren auswendig, und die berühmte Ballade ,Lenore' blieb für eine lange
Zeit mein Kletterpfosten, nicht nur für meine Phantasie, sondern ebenso für meinen Verstand; dafür - wie auch immer es seltsam erscheinen mag - legte ich sogar Wert auf das Studieren und Vergleichen der Varianten
des Gedichtes, um in den vollständigen Werken von Bürger, die im Besitz der Familie waren, zu entdecken, welche Variationen von meinem älteren Bruder zufällig herausgefunden und mir gezeigt wurden.´ “
|
|
2001
|
Huyssen, Andreas. Sturm und Drang. In: Geschichte der Deutschen Lyrik vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Hg. Walter Hinderer, Königshausen & Neumann
“[S.187] Den Göttingern freundschaftlich verbunden war Gottfried August Bürger, Amtmann im nahegelegenen Gelliehausen. Die Begabung dieses seit
Schillers historisch ungerechter und menschlich rücksichtsloser Attacke von 1791 so oft geschmähten und verkannten Dichters und seine künstlerischen Wirkungsabsichten lassen ihn aber eher dem Straßburger Kreis um
Herder und Goethe wahlverwandt erscheinen. Wie sonst im Sturm und Drang nur noch Lenz wurde Bürger das Opfer einer Literaturbetrachtung, die ihre Vorurteile gegenüber dem radikalen Demokraten hinter moralischer
Mißbilligung seines Lebenswandels und Kritik an seiner angeblich schlampigen Amtsführung versteckte. Die Vorwürfe des Disziplinmangels, des groben Naturalismus, der ausufernden Sinnlichkeit, die sich ebenso gegen
die Dichtungen wie gegen den Menschen Bürger richteten, führten dazu, daß schließlich nur noch die Lenore als bedeutende poetische Leistung Bürgers anerkannt wurde. Paradoxerweise ließ gerade die in der Tat
einmalige Perfektion der Lenore Bürgers übrige Balladen und Romanzen, seine Lieder und Sonette in Vergessenheit geraten. Erst seit Lore Kaim-Kloocks verdienstvoller Monographie hat sich eine adäquate Erkenntnis von
Bürgers Bedeutung als Sturm-und-Drang-Lyriker durchgesetzt.”
|
|
2001
|
Vietor, Sophia Aspekte des Genius-Mythologems bei Novalis und im 18. Jahrhundert In: Astralis von Novalis: Handschrift, Text, Werk
“[S.
241] Das Gedicht ´Anfang´ kann auch als kraftvolles Bekenntnis zu den Zielen gedeutet werden, die F. Schiller in der Bürger-Rezension von 1791 dem modernen Dichter steckt. Das Zentralwort ´sittliche Grazie´wird zwar
erst am Schluß der Abhandlung von Schiller genannt, scheint sich Novalis aber tief eingeprägt zu haben, da er es sowohl im Brief an K. L. Reinhold vom 5.10.1791 als auch in einem Brief an Schiller vom 7.10.1791
verwendet. Er schreibt, daß ihm die Bürger-Rezension beim Wiederlesen fast zu ´gelind´ vorgekommen sei und fährt fort: ´Könnte ich doch diese Liebe zur sittlichen Grazie zur moralischen Schönheit zur reinsten,
edelsten Leidenschaft entflammen, die je einen sterblichen Busen durchglühte.´ Die Bürger-Rezension markiert einen Wendepunkt in der deutschen Literaturgeschichte, da Schiller hier zum erstenmal das Ideal der
´Klassizität´ und die sittliche Aufgabe der Kunst formuliert. Jede Art von Volkspoesie oder Nachahmung der Natur wird scharf kritisiert zugunsten einer ´Idealisierungskunst´, deren Voraussetzung es sei, das
subjektiv Erlebte, das die Dichtung der Sturm und Drang Periode bestimmte, ins Allgemeingültige zu erheben und von allen Zufälligkeiten zu reinigen. Eine zentrale Stelle über die Aufgabe des Dichtens lautet:
Eine der ersten Erfordernisse des Dichters ist Idealisierung, Veredlung, ohne welche er aufhört, seinen Namen zu verdienen. Ihm kommt es zu, das Vortreffliche seines Gegenstandes (mag dieser nun Gestalt, Empfindung
oder Handlung sein, in ihm oder außer ihm wohnen ) von gröbern, wenigstens fremdartigen Beimischungen zu befreien, die in mehrern Gegenständen zerstreuten Strahlen von Vollkommenheit in einem einzigen zu sammeln,
einzelne, das Ebenmaß störende Züge der Harmonie des Ganzen zu unterwerfen, das Individuelle und Lokale zum Allgemeinen zu erheben. Alle Ideale, die er auf diese Art im Einzelnen bildet, sind gleichsam nur Ausflüsse
eines innern Ideals von Vollkommenheit, das in der Seele des Dichters wohnt.
In diesen Sätzen wird bereits die Methode der Wechseldarstellung des Geistigen und Sinnlichen
entworfen, die Novalis in seinen poetologischen Fragmenten unter dem Begriff des ´Romantisierens´ zusammenfaßt. Den modernen, sentimenalischen Dichter bestimmt die Spannung zwischen der unvollkommenen Wirklichkeit
und dem angestrebten Ziel einer vollkommenen Harmonie von Natur und Geist, Sinnlichkeit und Sittlichkeit. Da die Rückkehr zur verlorenen Natureinheit und instinktiven Genialität nicht mehr möglich ist, muß der
moderne Dichter aus Freiheit sich selbst bestimmen und seine Ideale in der Poesie veranschaulichen. Dieser Zug zur Stilisierung und Vergeistigung der Natur einerseits und zur symbolischen Darstellung des Geistigen
in der Kunst andererseits bestimmte nicht nur Schillers ästhetische Schriften von 1795, sondern auch F. Schlegels und Novalis' Entwürfe einer romantischen Universalpoesie. Allerdings sollte die Methode der
Wechseldarstellung in der Frühromantik nicht wie bei Schiller auf die ästhetische Sphäre beschränkt bleiben, sondern in allen Gebieten des Lebens Anwendung finden. Für die Auffassung vom poetischen Genius bedeutete
diese Hinwendung zum Idealen einen Bruch mit der naiven Naturbegabung zugunsten einer Veredlung, Selbstdurchdringung und Bewußtwerdung des Instinkts. Aus dem naiven Genie sollte ein sentimentalisches werden; - der
Weg führte von Arkadien nach Elysium. Nur unter diesen Vorzeichen lassen sich viele Fragmente von Novalis verstehen, die sich auf die Potenzierung und Pluralisierung des Genies oder Genius beziehen.”
|
|
2002
|
Kemper, Hans Georg. Leichter Volksgesang (Bürger) . In: Deutsche Lyrik der frühen Neuzeit. Band 6/III.
“ [S. 225] Bürger hat sich zunächst wie viele seiner dichterischen Zeitgenossen die Formensprache der Anakreontik und »musa iocosa« angeeignet. Dabei charakterisiert schon die frühen Versuche eine augenzwinkernde, naiv anmutende Direktheit und Geradlinigkeit, die ohne >witzige< Verschleierungen die >Lust am Liebchen< artikuliert (so der Titel eines zehnstrophigen Liedes von 1769), dabei dieser weltlichen Gattung provozierend das Motiv der Seligpreisung aus der Bergpredigt implantiert und von der Verheißung künftiger Seligkeit auf die Glückseligkeit im Diesseits transformiert.
[S. 228] Diese relativ frühen Gedichte sind »Mischtexte« aus verschiedenen Gattungen und Traditionen, wie wir sie analog beim Leipziger Goethe oder beim Königsberger Lenz finden. Bürgers Auswahlkriterium ist
aber doch entschieden Simplizität, Naturnähe und traditionsverbürgte Volkstümlichkeit. [...] Doch erst die Liebe zu Molly und ihre elegische und hymnische poetische Spiegelung haben Bürgers Liebeslyrik Züge
leidenschaftlicher Individualität eingezeichnet. In der Ausgabe von 1789 hat der Jurist aber auch seinem berühmten Vorbild Hoffmannswaldau folgend [...] die Liebe zu Molly als >Naturrecht< [...] in einem
Sonett einzuklagen versucht. Was sich bei Hoffmannswaldau nur im Schutz eines fingierten Liebesbriefes zu artikulieren wagte, das verweist bei Bürger ungeschützt auf autobiographische (und auch naturrechtlich kaum
zu legitimierende) Verhältnisse. Bürgers offensive poetische Proklamation seiner Molly-Liebe überforderte das Moralgefühl seiner Zeitgenossen, und erst recht die zum Teil bis ins Drastische des Ausdrucks von Schmerz
und Sinnlichkeit greifende Sprache, an der Schiller heftigen Anstoß genommen hat.
[S. 232] In auffälliger Weise zeigt Bürgers (Liebes-)Lyrik neben individualisierenden Zügen auch Elemente einer routinierten
>Serialisierung< der Motive und der Texturiernng, die sich aus seinem Bemühen um >Volkstümlichkeit< und Eindeutigkeit auch des geschlechtlichen Rollenverhaltens erklärt. Von daher fällt mitunter ein
typisierender und formelhafter Stil auf, der ihm offenbar auch das Dichten erleichterte. So bei dem Gedicht >Liebeszauber<, über dessen Entstehung er Boie im Februar 1778 stolz berichtet, es sei ihm »zur
Mitternachtsstunde im Bette eingefallen und in continenti auch zu Papier gebracht«. Dieses achtstrophige Lied konterkariert mit seinem durch die vierhebig-trochäischen Verse unterstützten imperativen Gestus allen
versprochenen >Zauber< und schreibt sich in eine durch die Repetition der Imperative miterzeugte - gewalttätige Verfügbarkeit über das weibliche Liebes-Objekt hinein.
[S. 247] Wo Bürger nun aber auch
noch versucht, seine private Liebesbeziehung zu Molly in Balladenform zu gestalten und diese damit zu >individualisieren<, da wird das Ganze unfreiwillig komisch und in der gesuchten spielerischen Tändelei
lächerlich und nachgerade peinlich. [Untreue über alles].
[S. 249] Dem steht allerdings eine große Anzahl von Gedichten gegenüber, in denen er die soziale Problematik entpolitisiert und moralisierend
verharmlost. Manchmal lesen sich themenverwandte Gedichte auch wie ein wechselseitiger Widerruf. So ist z. B. die balladeske >Erzählung< >Veit Ehrenwort< eine schwer erträgliche narrative
Ausgestaltung des Vorurteils von der sexuellen Lüsternheit der Frau - sie heißt hier ebenfalls >Rosette< - die, obwohl sie der Nachbar beim Stehlen erwischt hat und ihr zur Strafe im Wiederholungsfall
Vergewaltigung androht, am nächsten Abend prompt wieder zur Stelle ist. [...] Das ist eine traurig stimmende Kontrafaktur zu Bürgers sozialkritischer Ballade >Des Pfarrers Tochter von Taubenhain<! Hier wird
die gesamte sozialkritische Brisanz des Stoffes fahrlässig einer billigen Pointe geopfert. Dies mahnt zugleich zur Vorsicht gegenüber dem modernen Ansinnen, die im Übergang von der Vormoderne zur Moderne
angesiedelte Poesie dieses Autors bereits umstandslos als >Ausdruck< einer einheitlichen Autor-Intention zu deuten.“
|
|
2002
|
Kemp, Friedhelm. Gottfried August Bürger und August Wilhelm Schlegel. In: Das europäische Sonett. Band II
“[S. 54] In den sechziger Jahren des 18. Jahrhunderts beginnt man im Kreis um Wilhelm Gleim in Halberstadt in Petrarcas Manier zu phantasieren, und dort ist dann Klamer Schmidt 1776 der
erste, der, seinen eigenen Worten nach, ´das Sonett wieder in den Lauf bringt.´[...]
Dabei bleibt es jedoch nicht. Petrarca wird bald darauf von Gottfried August Bürger energischer und persönlicher anverwandelt.
Und hier können wir es nun mit Händen greifen, eben dieses Phänomen der Anverwandlung, als das einer Anknüpfung und zugleich Erneuerung aus eigenen Bedürfnissen, Nöten und Entzückungen.
Darin, meine
ich, besteht Tradition, daß das Gemüt eines Dichters von anderen vor ihm Gesagtes in sich zu neuem Leben erweckt und als von einem in ihm Lebendigen zu eigenen neuen Gebilden fortschreitet. Er hört, er vernimmt
einen Vorgänger, hört auf ihn und bewegt seine Worte in seinem Herzen; er lehnt sich nicht an, er übernimmt nicht; er gerät in etwas durch ihn Fort- und über ihn hinaus Weitersprechendes und ist doch, im Falle
Bürgers, als Sprechender dieses eine besondere, überschwengliche und geplagte Subjekt.
Das sei ein wenig ausführlicher vorgeführt anhand eines bereits zitierten, weltläufig
gewordenen, vielleicht des berühmtesten und gewiß eines der häufigst nachgeahmten Sonette Petrarcas:
Solo e pensoso i piü deserti campi
Vo misurando a passi tardi e lenti, [...]
Daniel Caspar von Lohenstein, ein später Schlesier, übersetzt das in die dem deutschen Poeten seit Opitz geläufigen jambischen Alexandriner:
Aus dem ltaliänischen des Petrarcha im I. Theile
Solo e pensoso i piu deserti campi &c.
Hier mißt mein langsam Fuß die stille Wüsteney,
Darinnen ich mich nur mit den Gedancken schlage, [...]
Und nun Bürger:
Überall Molly und Liebe
In die Nacht der Tannen oder Eichen,
Die das Kind der Freude schauernd flieht,
Such' ich oft, von Kummer abgemüht,
Aus der Welt Gerassel wegzuschleichen. [...]
Mit seiner rasch berühmt gewordenen Leonore gilt er zu
Recht als der Erfinder der deutschen Kunstballade. Er ist jedoch auch, nach einer langen Pause, der erste Dichter, in dessen Werk das Sonett einen größeren Raum einnimmt. Im Januar 1789 entstand eine Folge von elf
Liebessonetten, anläßlich derer Bürger an einen Freund schreibt: "Ihr werdet glauben, der selige Petrarca sei von den Toten auferstanden, wenn Ihr mein hohes Lied und - und - meine Sonette nur von fern werdet
tönen hören; denn Ihr sollt wissen, daß ich fast Tag für Tag ein Sonett produziere. Eine sonderbare Wut, die auch Schlegeln angesteckt."
Wie in Petrarcas zweiter großer Sonettfolge ´In Morte di Madonna Laura´ sind auch dies Gedichte der Erinnerung an eine Tote.“
|
|
2002
|
Cersowsky, Peter. »Wunderbare Welt«, Zu Bürger und Shakespeare. In: Prägnanter Moment. Festschrift für Hans-Jürgen Schings.
“[S. 105, für die Anmerkungen siehe den vollständigen Text] Der Verriß, mit dem Schiller Bürgers Gedichte bedachte, mag seinen Teil dazu beigetragen haben, daß der Blick auf ihn noch
immer getrübt ist. Allenfalls sporadisch hat man bislang jedenfalls ins Auge gefaßt, wie er es denn mit Shakespeare hält, der doch bei seinen Generationsgenossen in aller Munde ist - als Leitfigur für natürliche
Menschendarstellung. Aber diskutiert wird ja im Jahrhundert der Aufklärung immerhin auch die Kategorie des »Wunderbaren«, definiert gemeinhin gerade als dasjenige, was den Anschein erweckt, mit den Gesetzmäßigkeiten
der Natur nicht vereinbar zu sein.
[S. 108] So akribisch wie durch Bürger war Macbeth noch nie ins Deutsche übersetzt worden - und noch nie mit derartiger Fixierung auf Sinneswahrnehmung und Affekt. Sein Konzept für die Wiedergabe einzelner Wörter kleidete Bürger bezeichnenderweise metaphorisch ein: »Das müssen lauter Stahlfedern seyn, die an Ohr und Herz schnellen, daß mans fühlt."« Stets hatte er die Bühne im Auge - in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts keineswegs selbstverständlich, wenn es um Shakespeare ging. »Wenn mich jemals verlangt hat, ein Schauspiel vorgestellt zu sehen, so ist es von jeher, seit ich ihn kenne, Shakespears Macbeth gewesen«. Und der Appell an die Sinne sollte dadurch noch synästhetisch verstärkt werden, daß er die Hexenszenen vertont wissen wollte. Chorgesang und Tanz sollten im Spiel sein. Immerhin läßt auch Shakespeare die Hexen bereits singen. Bei allen Freiheiten, die er sich gegenüber dem Original nahm -die Hexenszene, die Shakespeares Stück einleitet und worin sie ihre Zusammenkunft mit Macbeth vereinbaren, beließ er an Ort und Stelle. Ihre Rolle als Hauptmedien des Wunderbaren wurde so nicht beeinträchtigt.
[S. 109] Dies zeigt nicht nur, wie reflektiert Bürger als Shakespeare-Übersetzer arbeitete; es unterstreicht auch seine Tendenz zur Versinnlichung: »Gold« und »Quark« sind konkreter als »trüblich« und
»lieb«; und diese Tendenz schlägt sich vor allem auch klanglich nieder; der Reim ist Bürger wesentlich, und überhaupt gelingt es ihm, die metrische Struktur des Originals beizubehalten, den trochäischen ´niederen´
Knittelvers, passend zur sozialen Position der Hexen - und das alles erklärtermaßen, um deren wunderbare Macht über die Natur zu akzentuieren. Daß Bürger die Hexenszenen überhaupt originalgetreu in Versen übersetzt,
während er das übrige, wie schon Wieland, in Prosa wiedergibt, unterstreicht gleichermaßen ihren eigenen Status gegenüber der 'natürlichen´ Diktion des Kontexts.
[S. 110] Bürger möchte Shakespeare nicht nur
übersetzen, sondern in jeder Hinsicht 'verdeutschen'. Entsprechend macht er schon in der Anfangsszene aus »Graimalkin« ein »Graulieschen«, aus »Paddock« »Unke«. »Wips« ist niedersächsischer Dialekt, und auch Quark
ist ein niederdeutscher Dialektausdruck für »Kot«. Shakespeare schrieb mit seinem Macbeth bereits ein regionalisiertes, ein Schottland-Stück. Orientiert an einem norddeutsch-mitteldeutschen Publikum, verlagert Bürger die regionale Einbindung. Offenkundig hat auch solche Umplazierung in den engeren heimatlichen Sprachraum die Funktion, die übernatürliche Wirkmacht der Hexen um so einsichtiger zu machen. - Bürger multipliziert die Menge der Zauberutensilien aus den verschiedensten Bereichen der Natur, mit denen die Hexen operieren, und er universalisiert auch damit ihre Wirkmacht - das »Eibenreis«, das dazu gehärt, ist obendrein »in Walpurgisnacht geschnitten«, will sagen, Bürger präsentiert nicht nur deutsche, sondern zugleich - entschiedener als Shakespeare - christliche Hexen. Bezeichnenderweise verwandelt er ihre antike Anführerin Hekate in eine »Hexenaltfrau«.
[S. 113] Daß Bürger durch Shakespeare vor allem im Hinblick auf die Darstellung des Wunderbaren inspiriert wurde, läßt sich auch an seinen Gedichten ablesen, besonders an der Lenore (1773): »Shakespearisch« findet er selbst eine ihrer Strophen. »Nehmlich die Weite und Geschwindigkeit des Rittes anzudeüten, hab' ich die Scene dreymal im Reiten sich verändern laßen«. [...]
Der erwähnte Ausschnitt ist darin nur repräsentativ für Lenore insgesamt; jener Ritt, auf den der Geist ihres gefallenen Geliebten die Titelgestalt mitnimmt - er antizipiert die Rolle des Wunderbaren in Bürgers Macbeth. Auch hier bleibt es regional - in Preußen - und christlich fundiert.
[S. 115] Ebenso wie die Vorliebe für Macbeth zeigen jedoch auch seine anderen Balladen, daß es dabei zugleich um Wunderbares im Bann Shakespeares geht. Wie Macbeth ist Der Raubgraf (1773) ein tyrannischer Aristokrat, zu Fall gebracht durch Hexenrnacht, dessen Schloß durch mitternächtlichen Hexenspuk, geführt von Herrn Urian und konkretisiert u.a. in dem Wort »wips«, heimgesucht wird. Auch Der wilde Jäger (1778) zeigt einen despotischen Fürsten in der Macht des Teufels, der dem Gottesgericht verfällt.
Im Zusammenhang mit Des Pfarrers Tochter von Taubenhain (1781) schrieb er:«Genius! Genius Shakespears! gieb mir Schwingen, das Ziel zu erfliegen, welches mein Auge sieht!« Die gebetsähnliche Anrufung, die den verehrten Shakespeare gleichermaßen als Geist apostrophiert, um mit seiner Hilfe die natürlichen Grenzen zu überwinden, sieht dieses Gedicht ebenfalls im Zeichen des Wunderbaren.
[S. 116] Wunderbare Reisen verspricht schon der Untertitel seines populärsten Textes: Münchhausen (1786). In der Tat: Übernatürliches ist für den Münchhausen konstitutiv: ob für den Ritt auf der Kanonenkugel, den Weg zum Mond oder den Schnellauf von Wien nach Konstantinopel. Münchhausen und Macbeth - diese Konstellation ist so abwegig nicht. Beide Aristokraten ziehen um so größere Bewunderung auf sich, als ihnen übernatürliche Wirkmächte zu Gebote stehen. Überdies erinnert Münchhausen auch an einen anderen weitgereisten Aristokraten Shakespeares, der eine ferne Insel durch seine übernatürlichen Kräfte zum Paradies gestaltet: Prospero. Münchhausen gelangt seinerseits auf eine Insel wie im Tempest.
Shakespeare persönlich plaziert er sogar in seinem Lügengespinst: die Schleuder, mit der David Goliath erschlug, sei ein Familienerbstück. Sein Urgroßvater nun, so Münchhausen, habe die Bekanntschaft Shakespeares
gemacht, und der Dichter habe sich besagte Schleuder ausgeliehen, um im Park eines Aristokraten zu wildern. Er sei dafür ins Gefängnis geworfen worden, und Urgroßvater Münchhausen habe ihm durch magische
Hilfsdienste bei der Königin die Freiheit erwirkt. Jung Shakespeare hinter Gittern wegen Wilddieberei im herrschaftlichen Park - das ist eine Dichterlegende; noch Wieland nahm sie jedoch immerhin für bare Münze.
[S. 119] Das Wunderbare bei Shakespeare wie bei Bürger - beides reizte Lichtenbergs spekulative Energie: In Daß du auf dem Blocksberge warst (1799) spielt er das Möglichkeitspotenrial dieser Verwünschung durch, indem er sie beim Wort nimmt - im Traum seines Ich-Erzählers, der darin ebenso rasch auf den Hexenberg gebracht wird wie Bürgers Lenore - shakespearisch - zu ihrer Richtstätte. Diese Analogie stellt Lichtenberg selbst her. Auf dem Blocksberg, Ort des Schreckens und der Wunscherfüllung zugleich, träumt Lichtenbergs Erzähler die Französische Revolution. Gesellschaftlicher Umsturz durch das »wilde Heer« - in Bürgers Macbeth konnte Lichtenberg schon davon lesen. Aus Hogarths Stichen zieht seine konjunktivische Phantasie ebenfalls die Möglichkeit des Wunderbaren nach dem Vorbild der Lenore und ihres verstorbenen Geliebten: »Oh! ritte doch einmal diese Toden-Figur [...] wie Lenorens Wilhel beim Gattertor an der Ecke des Saals hin, wo der Bischof oder der Rektor ihr Te Deum
schmausen [ ... ] Doch das ist Poesie.« Nicht anders als für Bürger findet auch für Lichtenberg die konjunktivische Imagination des Wunderbaren durchaus ihren spezifischen Ort in der Dichtung; im wirklichen
Leben bedenkt er es mit gehöriger Skepsis, ohne indes die Möglichkeit unbekannter Naturerscheinungen zu leugnen.
[S. 121] Seit dem Fischer (I778) und dem Erlkönig (1782) sind seine eigenen Balladen [Goethes] Fundgruben für das Wunderbare, die Bürger näherstehen, als man hat wahrhaben wollen. Noch der klassische Goethe tendiert seit dem Balladenjahr 1797 entschieden zu eben jener alliterierenden Lautmalerei, die Bürger seit jeher vorgeworfen wurde - mit ihrem »treppauf treppab« (Der untreue Knabe), »walle walle« (Der Zauberlehrling),
"klippert's und klappert's [ ... ] tappet und grapst« (Der Totentanz) oder »pispend und knisternd« (Hochzeitlied).
[S. 126] Schon bei Bürger, dem Pfarrerssohn, bleibt ja das Wunderbare bei
allem Variantenreichtum vielfach in christlichen Zusammenhängen - das dürfte deutlich geworden sein. Wenn es bei ihm, angeregt durch Shakespeare, zu einer Schlüsselkategorie wird, dann gibt er damit jedenfalls
seinerseits Impulse, die in die Kunstreligion der Frühromantik münden. Solcher Beziehungen sollte man eingedenk sein, ehe man Bürger rundheraus abwertet.”
Der vollständige Beitrag in der ONLINE-BIBLIOTHEK.
|
|
2002
|
Kestenberg-Gladstein, Ruth. Siegfried Kapper (1820-1879). In: Heraus aus der "Gasse" - Böhmens Juden im 19. Jahrhundert. Münster 2002
“[S. 131] Aber nicht nur Kappers Vater konnte und pflegte das Deutsche. Auch Kappers Mutter sang gern deutsche Lieder, von denen eines dem gefühlvollen
Knaben einen unauslöschlichen Eindruck hinterließ. Die Mutter sang ´Die Pfarrerstochter von Taubenhain´ und begleitete sich selbst am Klavier. Die eindrucksvolle Ballade von August Bürger, die das damals aktuelle
Thema der Kindesmörderin stark sozial akzentuierte, war eine der frühesten Kindheitserinnerungen Kappers. Er konnte sich die unglückliche Pfarrerstochter nicht anders vorstellen als mit den Zügen seiner ersten
Liebe: Lizenka, des Mautners Töchterlein, das gegenüber wohnte. Offenbar war Lizenka ein jüdisches Mädchen, denn Mautner (Zolleinnehmer) pflegten Juden zu sein, weil die Nichtjuden auf dem Land nicht imstande waren,
die hohe Kaution, welche das Ärar forderte, aufzubringen. Es ist anzunehmen, daß ´Die Pfarrerstochter von Taubenhain´ nicht das einzige deutsche Lied war, das die Mutter zu singen pflegte.“
|
|
2003
|
Hiden, Andrea. Körper und Schrift bei Gottfried August Bürger. Diplomarbeit Universität Wien.
„[S. 6] Es ist sicher kein Zufall, daß sich der Beginn einer Autonomisierung der Poesie genau dann abzeichnet, als mit zunehmender Alphabetisierung im Zuge der Aufklärung das Medium der
Schriftlichkeit immer mehr zum zentralen Medium der öffentlichen Kommunikation wird. Der damit einhergehende expandierende Buchmarkt, der sich "im Laufe des 18. Jahrhunderts zunehmend" nach den
"Regeln der kapitalistischen Produktion" organisiert, wird paradoxerweise zur Voraussetzung für die Verabschiedung der (Dicht-)Kunst aus der Welt der materiellen Nöte. Denn die an diesem literarischen
Diskurs beteiligten Kommunikanten erfahren in ihrer Rolle als Autor oder als Leser eine völlige Entkörperlichung. Die Schrift "stellt sie im Rahmen des von ihr konstituierten Systems von Gebrechlichkeit
einerseits, Leidenschaft andererseits tendenziell frei und wirkt so wie ein Filter, der ein geläutertes, spiritualisiertes Substrat einbehält.' Bei Schiller schließlich wird diese "Befreiung" vom
(persönlichen) Körper zur Normvorgabe fiir den poetischen Text.
Für Bürger jedoch erweist sich die Qualität eines Textes erst in seiner Anbindung an den Körper und die wirkliche Welt. "In der Poesie muß,
troz aller Erhabenheit und Göttlichkeit, dennoch alles sinnlich, faßlich und anschaulich seyn; oder es ist keine Poesie für diese, sondern vielleicht fiir eine andere Welt, die aber - nirgends existirt."
[S. 36] Grimm [siehe Grimm] wirft Bürger also einerseits zuviel („Gemachtheit", „inszenierte Emotionen") und andererseits zuwenig Distanz zu seinen Gefühlen („kruden
Naturalismus“,), zuwenig oder zuviel Privatheit vor. Er hält den Ausdruck Bürgers nicht für echt, weil er zu sehr auf die Äußerlichkeiten der Sprache und ihren Effekt achtet.
[S. 37] Andererseits bezweifelt Grimm die "Wahrhaftigkeit" der durch Bürger dargestellten Erlebnisse. Sie sind nicht "echt", weil das Sinnliche sowohl der Sprache
als auch des Körpers zu stark in den Vordergrund gerückt wird. Der nur am Sinnlichen, am "Reißerischen" orientierte sprachliche Ausdruck verstellt den Weg zu einer inneren "wahrhaftigen"
Bedeutung. Bürger wird hier gleichzeitig zuviel und zuwenig Authentizität, zuviel und zuwenig Artifizialität vorgeworfen. Für Grimm gilt noch immer, daß der Körper die Identität und Authentizität des Subjekts
gefährdet und verfälscht. Die Schwäche Bürgers rührt in dieser Sichtweise von der Besessenheit durch seinen Leib her, der Weigerung, das materielle Sein zu überschreiten.
[S. 108] Wie wichtig Bürger die materielle Seite der Sprache nimmt, zeigt sich nicht zuletzt auch in seinen Vorschlägen für eine Verbesserung der Rechtschreibung, im Beklagen des
schlechten Stils vieler Gelehrter, in der Bildung zahlreicher Neologismen und in der fanatischen Verfolgung von Druckfehlern. Bürgers Ziel, die Poesie sinnlich zu machen, ist eine Reaktion auf den Verlust an
Sinnlichkeit in der Schrift. Dieses Ziel bringt eine Erweiterung der materiellen Möglichkeiten der Sprache für die Poesie hervor. Sie muß das, was die Schrift verdrängt, den Körper, nach dessen Vorbild ersetzen. Nur
wenn sie die Logik des Körpers auf die Schrift überträgt, kann sie selbst lebendiger Organismus werden. Mit dem Bewußtsein um die Bedeutung der Materialität der Sprache tritt Bürger die „Priesterschaft der
Wortverwaltung“, an.”
Hidens Diplomarbeit in der ONLINE-BIBLIOTHEK.
|
|
2003
|
Härtling, Peter. Lebensalter: Gedichte
“[S. 65] Gottfried August Bürger
Mein Mädel
Mein Mädel ist gar wunderschön.
Hätt´ es Anakreon gesehn,
Ihr Dichter, wir hätten,
Ich wollte drauf wetten,
Ein Bändchen Lieder mehr von ihm.
Mein Mädel ist gar wunderschön.
Hätt´ es der Versler Bav gesehn,
Ihr Dichter, wir hätten,
Ich wollte drauf wetten,
Wohl noch ein gutes Lied von ihm.
Mein Mädel ist gar wunderschön.
Hätt´ es ihr Liebster nie gesehn,
Ihr Dichter, wir hätten,
Ich wollte drauf wetten,
Noch keinen halben Vers von ihm.”
|
|
2003
|
Bernard Schultze, Hans Bender. Glücklich die Stunde, Stuttgart
“[S. 22] Schon früher habe ich von meiner ersten Begegnung mit Golo Mann erzählt. In seiner Festrede bei einer Tagung des Kulturkreises im BDI 1967 in Regensburg hatte er nebenbei
gesagt: Er könne 200 deutsche Gedichte auswendig aufsagen. Hinterher, am Mittagstisch, wo ich ihm gegenübersaß, fragte ich ungeniert: ´Welche Gedichte?´ Er fragte diplomatisch zurück: ´Welches wollen sie hören?´ Ich
sagte: ´Die Wallfahrt nach Kevlaar.´ Oh, bedauerte er, das zähle nicht zu seinem Repertoire, doch er liebe es sehr und nähme sich vor, es demnächst auswendig zu lernen. Aber wie wär's mir einer anderen Ballade, mit
Gottfried August Bürgers Lenore? Ohne zu stocken, wie ein virtuoser Rezitator, trug er die zweiunddreißig Strophen vor, mehr ein Melodram als eine Ballade: Und hurre hurre, hopp hopp hopp! / ging's fort im
sausenden Galopp, / Daß Roß und Reiter schnoben / Und Kies und Funken flogen. Die Herren der Industrie staunten und applaudierten.“
|
|
2004
|
Huber, Herbert. Ergebnis einer Aktion des Landesverein für Heimatpflege und des Bayerischen Rundfunk 2004. In: www.gavagai.de
“Fast 10.000 Vorschläge gingen ein. Gesamtbayerisches Siegerwort ´fei´ [...]
Mit "´ei´ wird eine Steigerung (´Des glab i fei aa!´), Drohung (´Des sag i fei meim Bruada!´)
oder eine Bitte (´Pass fei auf!´) ausgedrückt. Die Wissenschaftler an der Universität Würzburg fanden heraus, dass ´fei´ seit dem 12. Jahrhundert in der Hochsprache gebräuchlich war. Ein paar Beispiele, wo es noch
als ´fein´ im Schriftdeutschen verwendet wird:
In ´Der Ritter und sein Liebchen´ von Gottfried August Bürger (31.12. 1747 Molmerswende, Landkreis Mansfelder Land – 8.6. 1794 Göttingen) sagt das Liebchen zum
abziehenden Ritter:
»Komm fein bald wieder heim ins Land,
Daß uns umschling' ein schön'res Band
Als Band von Gold und Seide,
Ein Band aus Lust und Freude,
Gewirkt von Priesterhand!« –
In ´Auch ein Lied an den lieben Mond´, ebenfalls von Bürger, lauten die beiden ersten Zeilen:
Ei! schönen guten Abend dort am Himmel!
Man freuet sich, Ihn noch fein wohl zu sehn. – “
|
|
2004
|
Damm, Sigrid. Das Leben des Friedrich Schiller: Eine Wanderung. Insel Verlag
“[S. 254] Zu beobachten aber ist, daß sein Engagement rasch nachläßt oder in schroffe Zurückweisung umschlägt, sobald unterschiedliche künstlerische Urteile aufeinandertreffen oder er
sich in seinen Erwartungen getäuscht sieht.
Ein Beispiel: Johann Gottlieb Fichte, dem er persönlich zugetan ist, den er für sein Herausgebergremium der ´Horen´ gewonnen hat, von dem er im November
1794 sagt, er sei nach Kant. . .gewiß der größte Speculative Kopf in diesem Jahrhundert, schickt ihm im Sommer 1795 ein Manuskript. Schiller lehnt es mit einem groben Brief für den Druck ab, nennt es schielend und
unsicher. Als Fichte daraufhin dessen ästhetische Schriften angreift, bricht Schiller beleidigt den Kontakt zu dem Philosophen ab. Daß er Fichtes Manuskript als Konkurrenz empfindet, das die Wirkung seiner eigenen
Abhandlung einschränken könnte, ist unschwer zu erkennen.
Schiller ist empfindlich gegen Kritik und zugleich in seinen Angriffen äußerst scharf. 1791 hatte Gottfried August Bürger das zu spüren
bekommen; Schiller wirft dem zwölf Jahre Älteren fehlende Bildung und Reife vor, führt die Mängel in seiner Dichtung auf seine Person zurück: Das Feuer der Begeisterung scheint ihm zu einer ruhigen Arbeitslampe
herabgekommen zu seyn ... Daß Schiller mit diesem ungerechten Urteil auch sich selbst meint (in der Rezension vollzieht er den Bruch mit der eigenen Vergangenheit), kann Bürger, der sich gegen Schillers Herren-
und Meistergebärde zur Wehr setzt, wenig trösten.
Demgegenüber Schillers überschwengliches Lob des unbedeutenden Lyrikers Friedrich von Matthisson. Und seine Vorbehalte
gegen diese Richter
(Jean Paul), diese Hölderlins. Ob, fragt er seinen Freund Goethe, die Genannten absolut und unter allen Umständen so subjectivisch, so überspannt, so einseitig geblieben wären, ob es an etwas primitivem liegt, oder
ob nur der Mangel einer aesthetischen Nahrung und Einwirkung von aussen und die Opposition der empirischen Welt in der sie leben gegen ihren idealischen Hang diese unglückliche Wirkung hervorgebracht hat.
Schillers Vorbehalte gegen Hölderlin (Goethe bestärkt ihn darin) empfinde ich als besonders schmerzlich, denn Hölderlin verehrt und bewundert Schiller als seinen Lehrer. Ich bin vor Ihnen, wie eine
Pflanze, die man erst in den Boden gesezt hat. Man muss sie zudeken um Mittag, gesteht er ihm 1797, und: Ich habe Muth und eignes Urtheil genug, um mich von andern Kunstrichtern und Meistern unabhängig zu
machen, ... aber von Ihnen dependir' ich unüberwindlich. Schiller seinerseits setzt große Hoffnungen auf Hölderlin: Er hat recht viel Genialismus, und ich hoffe auch einigen Einfluß darauf zu haben .. . Ich rechne
überhaupt auf Hölderlin für die Zukunft der Horen . .. Hölderlin gibt seine Hauslehrerstelle auf, kommt nach Jena, die günstigen Honorare der 'Horen' lassen ihn sogar glauben, er könne davon leben.Schiller bestärkt
ihn darin. Aber er ist nicht fähig, Hölderlins überragendes Talent vorbehaltlos anzuerkennen; in dem Moment, wo sich zwischen ihnen künstlerische Gegensätze zeigen, läßt er die Beiträge liegen. Schweigt. Stößt
Hölderlin zurück.
Fehlt es Schiller an dem für einen Zeitschriftenherausgeber notwendigen Maß an Flexibilität? An Diplomatie? August Wilhelm Schlegel gegenüber verhält er sich durchaus
diplomatisch. Dessen Beiträge, schreibt er Humboldt, seien eine trefliche Acquisition, aber nicht um das Journal in Schwung zu bringen oder auch nur darinn zu erhalten, sondern bloß um demselben eine Masse zu geben.
Letztlich geht es - bewußt oder unbewußt - um die Durchsetzung auf dem Literaturmarkt, um Konkurrenzdenken, um Geltungsansprüche und aus ihnen erwachsende Empfindlichkeiten. Um 1800, als sich
Schillers Erfolg als Dramatiker immer klarer abzeichnet, wird er weitaus souveräner auch mit Kritik umgehen können. Mitte der neunziger Jahre dagegen reagiert er überempfindlich und zuweilen ungerecht. “
|
|
2004
|
Urban, Astrid. Kritik im Namen des guten Geschmacks: Schillers Rezension der Gedichte von G. A. Bürger. In: Kunst der Kritik, Heidelberg.
[S. 108] Weder seine praktische Tätigkeit als Rezensent, unter anderem für die Allgemeine Literatur-Zeitung, noch die intensive Beschäftigung mit der Philosophie Kants, in deren Nachfolge
,Kritik' bald zu einem Modewort avancierte, veranlaßten Schiller zu einer methodischen Aufnahme oder gar zu einer systematischen Ausformulierung dieses Konzeptes. Die Literaturkritik und die ihr verwandten Formen
verstehen sich bei ihm als Medien der ästhetischen Reflexion. Für das Gattungsverständnis der Rezension ist dies von entscheidender Konsequenz: Die Besprechungen, die Schiller in den 90er Jahren im Auftrag der ALZ verfaßt, sind nicht auf das Geschäft der Tageskritik hin bemessen. Schon in ihrer Anlage gehen sie weit über den zu kritisierenden Gegenstand hinaus, das konkrete Werk dient lediglich als Anlaß für die weiterführende Theoriebildung.
[S. 110] Daß in seiner Rezension fast nur von allgemeinen Maßstäben, kaum von einzelnen Gedichten die Rede ist, macht offenkundig, daß die aktuelle Ausgabe der Bürgerschen Lyrik zwar den Anlaß, nicht aber
den eigentlichen Gegenstand der Besprechung darstellt. Was sich rein äußerlich als Rezension präsentiert, erhält damit den Charakter einer theoretischen Grundsatzbestimmung. Nun muß das eine das andere nicht
ausschließen, zumal die Allgemeine Literatur-Zeitung für ihren wissenschaftlich-theoretischen Anspruch bekannt ist. Ob Schillers Text aus methodologischer Sicht tatsächlich den Anforderungen an eine ´gründliche Kritik´ genügt, ist vor allem deshalb zu hinterfragen, weil die diskutierten Normen und Maßstäbe nicht nur auf das in Rede stehende Werk, sondern auch auf die Persönlichkeit des Autors bezogen werden. Schiller trennt nicht zwischen Autor und Werkkritik, die Defizite, die er an den zu beurteilenden Gedichten feststellt, sind für ihn gleichbedeutend mit charakterlichen Mängeln des Verfassers. […] Schiller hingegen scheint nichts Zweifelhaftes an seinem Verfahren zu finden. Ganz offen kündigt er an, er wolle die Anwendung der festgelegten Maßstäbe auf den ´Hn. Bürger´ unternehmen und sieht sich auch aus diesem Grund der Pflicht enthoben, die vorliegenden Gedichte einer genaueren Prüfung zu unterziehen. Ganz offensichtlich ging es Schiller also nicht darum, poetologische Kriterien zu formulieren, die tatsächlich für eine angemessene Bewertung der Bürgerschen Lyrik geeignet gewesen wären.
[S. 111] In einer Zeitung, wohlgemerkt, die nicht nur auf Gründlichkeit, sondern auch auf Neutralität und Objektivität der Kritik höchsten Wert legt, die ihre Mitarbeiter zu einem unparteiischen Urteil
auffordert und in ihren Rezensionsnormen verlangt, der Kritiker solle ´wenig von sich und dem Verfasser, und mehr von dem Buche´ sprechen die Beurteilung solle also sach- und nicht personenbezogen ausfallen.
Insofern ist es ganz zutreffend, daß Luciano Zagari im Fall der Bürger-Kritik von einer ´vermeintlich philosophisch-methodologische[n] Rezension´ spricht, denn den Erwartungen an eine ´gründliche Prüfung´ wurde
Schiller weder aus der Sicht des damaligen noch des heutigen Lesers gerecht.
[S. 114] Der ´allgemeine Maßstab´, an dem er sich orientiert, kann jedoch aus Schillers Sicht nur dem Durchschnittsgeschmack
entsprechen, und dieser führt - so der Vorwurf - nicht zur angestrebten Popularität der Dichtung, sondern zu ihrer Trivialisierung. Statt also weiterhin von einem allgemeinen Richtmaß auszugehen, wertet Schiller das
Popularitätskonzept um und beruft sich dabei auf den ,guten Geschmack' als Distinktionsmerkmal. Nicht die Erwartungen der Menge, sondern der verfeinerte Geschmack des ,Kenners' habe als Maßstab der Kunst zu dienen,
lautet seine Forderung.
[S. 119] Schon 1795 hatte Schlegel in einem Brief an Schiller bedauert, daß dessen Besprechung in der ALZ über poetologische Fragen weitgehend hinweggegangen war, nun setzt er sich ganz direkt mit dem Verfahren der Bürger-Rezension auseinander. Schlegel kritisiert, daß Schiller nicht zwischen Person und Sache trennt, daß er Bürger vor dem Publikum bloßstellt, statt sich auf dessen Dichtung zu konzentrieren. Dieses Vorgehen wertet Schlegel als einen Verstoß gegen den öffentlichen Anstand, vor allem aber gegen das Ethos der Literaturkritik und die Standards des Rezensierens:
[S. 121] Diese Grundsätze wie auch das Verfahren, von den Defiziten des Werkes auf charakterliche Mängel des Autors zu schließen, sind bereits in Wielands Programm zur ästhetischen Erziehung vorgebildet. Es basiert auf eben jenen Prinzipien der Idealisierung, Veredelung und Vervollkommnung, die in der Bürger-Rezension zu allgemeinen Kunstgesetzen erhoben werden.
[S. 122] In der Bürger-Rezension gilt der Geschmack als Sensorium für ethische wie auch für ästhetische Normen, deren Gegenstandsbezug so genau nicht spezifiziert werden muß, denn mit der Kategorie übernimmt
Schiller ihre Unbestimmtheit, das ´je ne sais quoi´, das sich nicht auf begriffliche Urteile festlegen läßt. Daher ist es bezeichnend, daß die entscheidenden Wertkategorien, die die Bürger-Kritik formuliert, auf
einen Prozeß hindeuten, dessen Endpunkt im Vagen verbleibt. Der Begriff ´Ideal´ (das ´innere Ideal von Vollkommenheit´, die ´idealische Reinheit und Vollendung´ eines Kunstwerkes, das ´Ideal schöne´, schließlich die
´Idealisierkunst´) und die superlativische Bestimmung ´der höchste Wert eines Gedichts´, ´die höchsten Forderungen der Kunst´ stehen bei Schiller stellvertretend für die ästhetischen Kriterien, die zwar als absolute
Norm statuiert, aber nicht genauer ausgewiesen werden.
Ob diese Norm tatsächlich eingelöst wird, ob das Kunstwerk einen ´absoluten innern Wert´ besitzt, zeige sich allein daran, daß es die ´Prüfung
des echten Geschmacks´ aushalte, so Schillers apodiktische Erklärung. Will man diese Argumentation nicht als zirkulär abtun oder sich mit dem Verweis auf die lange Tradition des Rezensenten-Hochmuts begnügen, bleibt
zu fragen, wie eine individuelle Bewertung, deren Maßstäbe nicht hinreichend zu explizieren sind, Anspruch auf allgemeine Gültigkeit erheben kann - allein mit dem Verweis auf die ´Prüfung des echten Geschmacks´?
[S. 125] Es gibt zwei wesentliche Konsequenzen, die sich aus dieser Individualisierung des kritischen Verfahrens ergeben. Auf die erste wurde zu Beginn des Kapitels bereits hingewiesen: Von der ´wissenschaftlichen Prüfung´, die die Redaktion der Allgemeinen Literatur-Zeitung - ebenfalls mit Berufung auf Kant - proklamiert, hat sich Schillers Geschmackskritik weit entfernt. Unabhängig von der Spezifik des Gegenstandes fordert die Rezensionsnorm der ALZ eine Bewertung nach ´objektiven Gründen´. Kritik versteht sich hier als ein systematisches, logisch fortschreitendes Verfahren, das zu einem gesicherten und überprüfbaren Urteil führt. Dieses Urteil wird dadurch beglaubigt, daß der Rezensent als Dolmetscher des Publikums auftritt. Er repräsentiert die Gesamtheit der Stimmfähigen, deren Bewertung nur in einem neutralen, überpersönlichen Diskurs vermittelt werden kann. Mit der von Schiller vorgenommenen ´Prüfung des echten Geschmacks´ verlieren die Gesetze dieses Diskurses ihre Gültigkeit. An die Stelle der Regelanwendung rückt in Schillers Kritik die Diskussion von Normen und Wertmaßstäben - sie schafft die Grundlage für eine übergreifende ästhetische Theoriebildung. Die Repräsentativität, die das logische Argument selbstverständlich einfordert, kann Schillers Geschmackskritik nur beanspruchen, indern sie ihren individuellen Standpunkt deutlich ausweist und - das ist die zweite Konsequenz - den Leser von der Gültigkeit ihrer Maßstäbe auch dadurch überzeugt, daß sie diese auf die Darstellung selbst anwendet. Ästhetische Gegenstände lassen sich nach diesem Verständnis nur in einem ,schönen Vortrag' darbieten. Mit dem Geschmacksideal korrespondiert ein Stilideal, bei Schiller das Ideal einer philosophischen Kunstprosa, das darauf gerichtet ist, gerade die Positionen anschaulich vorzuführen, die nicht in der begrifflichen Erklärung aufgehen. Entsprechend verfaßt Schiller keine technische Rezension und keine wissenschaftlich strenge Analyse, sondern ein ästhetisches Manifest und zeichnet damit schon den Weg vor, der zur Sublimierung der aktuellen Kritik, ob politisch oder literarisch, und zur Abwendung von der Gattung Rezension in den Horen führt.
|
|
2005
|
Selbmann, Rolf. Deutsche Klassik. Paderborn
“[S. 140] Von der Höhe des klassischen Bildungsideals fordert Schiller vom Dichter [in der Bürger-Rezension von 1791] nicht nur eine Erziehung seines Publikums, sondern auch den
Anspruch der Lyrik, die Ästhetik auf einem bestimmten philosophischen Niveau und in Distanz zur Gefühlslage des Dichters zu halten. Lyrik solle keine Empfindungen des Dichters ausdrücken; dem wahren Dichter sei es
untersagt, ´mitten im Schmerz den Schmerz zu besingen´. Es sei für den Dichter beim Dichten sogar nötig, ´sich selber fremd zu werden´. Sie gipfelte in der Forderung, dass jede Lyrik, wenn sie etwas tauge, ´mit dem
Zeitalter fortschritte´.
[S. 162] Ergänzend zu dieser medialen Steuerung des öffentlichen Kunstgeschmacks [Herausgabe von Werken] versuchten die Klassiker die ästhetische Meinungsbildung durch selbst
verfasste oder gesteuerte Rezensionen zu beeinflussen. Vor allem aber prägten die Inszenierungen des Weimarer Theaters unter Goethes Direktion das Bild. Schillers Dramen setzten hier Maßstäbe auf einer Bühne,
die de facto die Funktion eines deutschen Nationaltheaters übernommen hatte. Hier gastierten die besten Schauspieler wie Iffland. Wer hier durchfiel (wie Kleist), hatte kaum Chancen mehr. Weder Goethe noch Schiller
schreckten vor der offenen Bedrohung missliebiger Rezensenten zurück wie nach der (schlecht besprochenen) Uraufführung von Friedrich Schlegels Jon (1801). Berühmt geworden ist eine Theatervorstellung des gleichen
Jahres, als das Publikum eine gravitätische Darstellung mit Lachen quittierte und Goethe ins Parkett donnerte: ´Man lache nicht!´
[S. 171] Indem sich die Kunst aus kirchlichen oder feudal-mäzenatischen
Abhängigkeiten befreite und von außerkünstlerischen Dienstbarkeiten aller Art löste, band sie sich im Gegenzug an moralische Forderungen. Diesem Bestreben der klassischen Kunst nach Autonomie, Eigengesetzlichkeit
und Funktionslosigkeit hatte Kants berühmte Definition der Interesselosigkeit des Ästhetischen vorgearbeitet. Schiller ging einen Schritt weiter. In seiner Theorie der ästhetischen Erziehung vollzog sich die Abkehr
der Ästhetik von der banalen Alltagswelt, unterschied sich die wahre Kunst von bloßer Unterhaltungsliteratur, differenzierte sich die Rolle der literarischen Öffentlichkeit aus, erhielt die Literaturkritik ihr
Eigenrecht (Kunstrichter) . Am Ende waren die Autonomie der Kunst und die deutsche Klassik identisch geworden.
[S. 207] Zugespitzt formuliert ist die deutsche Klassik vor allem eine Erfindung ihrer
Nachkommen. Keine Epoche wurde so häufig, so wirkungsvoll und so unhistorisch für die Ziele der jeweiligen Zeitgenossenschaft benutzt, verbogen und zurechtgestutzt.
[S. 215] Ein neu gewonnenes
Selbstbewusstsein seit der Reichsgründung 1871 suchte die kulturelle Identität in der Klassik als dem Höhepunkt der deutschen Literatur. Warum sollte sich der innerlich so erhobene Reichsbürger einem mühsam und
zeitraubend zu durchlaufenden Bildungsprozess unterziehen, wenn ersatzweise eine dekorativ zur Schau gestellte Belesenheit so leicht zu haben war? Das rechte Klassikerwort zur rechten Zeit schuf Abhilfe [Büchmanns
Der Citatenschatz des Deutschen Volkes, 1864] . Die Klassiker dienten als Phrasenlieferanten, klassische Literatur erschien im Zitat in der Verdünnung oder als Destillat. Man war ´zitatenfest´. Es galt, wie
Biichmann in der Erstausgabe seiner Geflügelten Worte schrieb, dass bei der Lektüre der Klassiker uns ´wie alte Bekannte eine Menge Worte entgegentreten, die der gesellige Verkehr sich für Ernst und Spiel angeeignet hat´. Und er fügte hinzu: ´Wir Deutsche aber dürfen stolz auf unser Aneignungsvermögen sein."
[S. 216] Nicht erst seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts erhob sich Ideologiekritik. Klassik galt als das fragwürdige Produkt einer unpolitischen, die sozialen Ungerechtigkeiten negierenden
Privilegienkultur.“
|
|
2005
|
Eschker, Wolfgang. Friedrich Schiller und Gottfried August Bürger. In: die horen 50, Nr. 4
I
Der Rezensent
Als Rezensent war Friedrich Schiller
ein knallharter Kollegenkiller.
Der arme Bürger samt Lenoren -
nach Schillers Schrift war´n sie verloren.
Errare, Schiller, est humanum.
Jedoch das Wie war inhumanum.
II
Die Dichter und die Schwestern
Bürger konnte zwischen beiden
wie man weiß, sich nicht entscheiden.
Schillern ging es auch ums Geld. -
Wer da nicht mehr zu Bürgern hält?
III
Balladenhelden
Balladen sind meist hochdramatisch,
Balladendichter oft fanatisch.
Nehmt Bürger oder Friedrich Schiller:
Sie wär´n per se Balladenfüller.”
|
|
2005
|
Engelen, Beate. Soldatenfrauen in Preußen: Eine Strukturanalyse der Garnisonsgesellschaft im späten 17. Und 18. Jahrhundert. LIT Verlag Münster
“[S. 108] Ähneln die Frauen der gefallenen Soldaten in den Amazonenliedem tragischen Heldinnen, die noch einen tieferen Sinn im Blutopfer ihrer Männer zu erkennen vermögen, so versuchte
Gottfried August Bürger etwa zehn Jahre später. eine andere Interpretation des Verlustes zu geben. Bürger. der für sich in Anspruch nahm, mit der Stimme des Volkes zu sprechen. gehöne zu den ersten Dichtem seiner
Zeit, die sich mit dem Elend der auf die Heimkehr ihrer Ehemänner wartenden Soldatenfrauen literarisch auseinander setzte. Die berühmte Ballade Lenore von 1773 schildert die Verlustangst einer Soldatenbraut und ihre bittere Konsequenz, nachdem der Bräutigam von einer Schlacht des Siebenjährigen Krieges nicht zurückgekehrt ist. In ihrer Verzweiflung ist sie sogar bereit, ihrem christlichen Glauben abzuschwören - die Verbindung mit ihrem Bräutigam ist ihr wichtiger als ihr Seelenheil. Lenores Wunsch, ihr Bräutigam möge endlich wieder vom Böhmischen Schlachtfeld zurückkehren, scheint in Erfüllung zu gehen; doch der Bräutigam entpuppt sich als Spukgestalt und führt sie nach einem gespenstischen nächtlichen Ritt schließlich als Gevatter Tod in das versprochene Brautbett - ihr Grab. Zwar warnt Bürger am Ende der Ballade davor, Gott abzuschwören; doch geht es ihm ganz deutlich nicht so sehr um religiöse Ermahnungen als vielmehr darum, bildreich und drastisch die Ausweglosigkeit einer jungen Frau zu schildern, die am Verlust ihres Bräutigams auf dem Schlachtfeld zerbricht.“
|
|
2005
|
Kempe, Hans H. Von Versailles bis Hitler. In: Der Vertrag von Versailles und seine Folgen: Propagandakrieg gegen Deutschland, Band 1.
“[S. 182] Es ist deshalb schlechterdings nicht vorstellbar, daß der deutsche Arbeiter es lange dulden wird, sich selbst oder sich in seinen Söhnen von den ihm 1945 präsentierten,
abgedankten alten Gewerkschaftsoffizieren und -generälen mit Schmutz bewerfen zu lassen.
Allen ehemaligen Soldaten aber und ihrer Schicksalsgemeinschaft mag das Wort des Dichters gelten:
´Wenn Dich die Lästerzunge sticht,
So laß Dir dies zum Troste sagen:
Die schlechtsten Früchte sind es nicht,
Woran die Wespen nagen.´ “
|
|
2005
|
Geissner, Hellmut. Noch immer zur Freiheit ermuntern? In: Demokratie und rhetorische Kommunikation: ausgewählte Aufsätze
“[S. 35] Noch immer zur Freiheit ermuntern?
Vor 200 Jahren, am 1. Februar 1790, hielt in der Freimaurerloge zu Göttingen, in der er 'Bruder Redner' war, der Dichter Gottfried August Bürger eine mitreißende Rede auf die französische
Revolution "Ermunterung zur Freiheit".
Im Unterschied zu den Dichtern des 'Göttinger Hain' mit ihrem weltfremden Freiheitsgeschrei und abstraktem Tyrannenhass, hat sich der
Pfarrerssohn Bürger (1747 - 1794) - er war zwar mit den Hain-Dichtern befreundet, aber er war kein Mitglied im Hain-Bund - schon früh z.B. im ´Herzenserguss über Volkspoesie´ (1776) dem wirklichen Volk zugewandt.
Noch stärker als selbst bei Johann Gottfried Herder, zu dessen Sprachauffassung sich bei Bürger Verbindungen finden, kam bei ihm ein sozialkritischer Zug zum Vorschein, etwa in der Ballade ´Die Kuh´ oder - noch
deutlicher - in dem Gedicht ´Der Bauer´ mit dem Untertitel 'An seinen Durchlauchtigen Tyrannen'. Bürger wollte über Gefühlserschütterungen nicht nur aesthetisch, sondern praktisch wirken. Im Laufe der Jahre
verstärkte sich bei ihm die aufklärerische Haltung. So verwundert es nicht, dass er sich in der erwähnten Rede von 1790 die Postulate der französischen Revolution von 1789 zu eigen machte: Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit. Sie wurden in Europa ähnlich wirksam wie die ´..... unalienable rights ... Life, Liberty and the Pursuit of Happiness´ in der Declaration of Independence von 1776 für die U.S.A. Von dieser
Unabhängigkeitserklärung führt ein unmittelbarer Weg zum amerikanischen Verfassungsgrundsatz Freedom of Speech.
Wer die hehren Forderungen aus ihrer postulatorischen Idealität erlösen und im
Leben verwirklichen will, der/die muss versuchen sie zu konkretisieren. Bei diesem Versuch sind Negativ-Beschreibungen nicht nur weniger emphatisch, sie zeigen auch eher in die Richtung möglicher pädagogischer und
politischer Folgerungen. Das heißt
- für Freiheit: Unfreiheit aufdecken und verändern
- für Gleichheit: Ungleichheiten aufdecken und verändern
- für Brüderlichkeit: Unbrüder/schwesterlichkeit aufdecken
und versuchen, sie zu verändern.”
|
|
2006
|
Eversberg, Gerd. Theodor Storm als Schüler.
“[S. 107] Ein bisher kaum beachtetes Manuskript mit der Erzählung "Celeste" ist die einzige Prosaarbeit, von der ein Manuskript aus diesem Zeitraum bekannt ist. Es handelt
sich bei diesem Text um die erste poetische Erzählung des damals 19-Jährigen überhaupt, eine Liebesgeschichte, die durch einen Erzählrahmen als bloßer Traum erkennbar wird. Die Erzählsituation entspricht der
damaligen Seelenverfassung des Primaners, der sich nach Zuneigung und Liebe sehnte. Storm gibt selbst durch das Motto einen Hinweis auf seine Quelle, Bürgers Gedicht "Die Königin von Golkonde", dessen
erste Zeile er seiner Erzählung voranstellt. Er hatte Bürgers Werke bereits als Schüler in der Husumer Gelehrtenschule gelesen, aber eine intensivere Beschäftigung mit dem Autor datiert erst in die Lübecker Zeit.
Zum Jahresende 1835 erschien in der Dieterichschen Buchhandlung Göttingen eine großformatige Prachtausgabe von Bürgers sämtlichen Werken. Storm erwarb ein Exemplar in der Rohden'schen Buchhandlung und versah es mit
dem Namenskürzel "HWStorm". Bürger dichtete seine Verse nach der Prosaerzählung: "Aline, reine de Golconde" (1761) des französischen Dichters Stanislas Chevalier de Boufflers (1738-1815) und
erzählt in Ich-Form von den galanten Erlebnissen eines jungen Edelmannes, der bei einer Jagd in einer abgelegenen Gegend Halt macht und dort einem Bauernmädchen namens Aline begegnet. In einer spontanen
Liebessituation schwängert der Jüngling das Mädchen, verlässt und vergisst es schon bald, wird aber nach einigen Jahren an das Erlebnis erinnert, als er Aline als reiche Dame in Paris wiedertrifft. Weitere fünfzehn
Jahre später treffen die beiden erneut zusammen, diesmal in Ostindien, wo der nunmehr zum General der französischen Kolonialarmee aufgestiegene Erzähler Aline wieder begegnet, die nach dem Tod ihres Mannes bei einer
Reise zunächst in Sklaverei geraten, dann aber vom König von Golkonde zur Geliebten erkoren wurde. In einer von ihr nachgebauten dörflichen Landschaft erleben beide die Begegnung ihrer Jugend noch einmal. Der
Erzähler muss fliehen, verliert, nach Paris zurückgekehrt, sein Vermögen und trifft im Alter erneut mit Aline zusammen, die in einer Wüstenoase beider Alterswohnsitz vorbereitet hat. Das Epos endet mit der Einsicht
des Erzählers, dass er sein Glück bisher vergebens gesucht hat: "Ich fand es erst am Abend meines Lebens." Bürger gestaltet das Liebeserlebnis in einem Rokokogarten, in dem das unverbindliche erotische
Spiel in einer verniedlichten Umgebung stattfindet; dieser Garten wird sogar Jahre später in Indien nachgebaut und die Kopie erfüllt ihre Funktion wie das Original beim ersten Mal. Storm übernimmt das Motiv der
beiden Liebenden, die sich bei Bürger vor der Vereinigung ebenfalls mit "Bruder" und "Schwester" anreden, verändert es aber grundlegend, indem er aus der spielerisch-galanten und unverschlüsselt
erotischen Episode ein ernst gemeintes Spannungsgefüge zwischen Seelenliebe und Sexualität konstruiert, das ähnlich wie später in seiner Novelle "Immensee" zu keiner Erfüllung gelangt. Das Geschehen wird
auf eine einsame exotische Insel verlegt, auf der der Erzähler mit seiner Celeste ganz allein ist und zu ihrem Schutz eine Grotte zu einem Liebesnest ausgestaltet hat. Ihn hindern aber moralische Bedenken und die
Scheu vor der Jungfräulichkeit des Mädchens, den Liebesakt zu vollziehen. Einen motivwerwandten Paralleltext stellt das gleichzeitig entstandene Gedicht "Träumerei" dar. Storm übernimmt nur das Motiv der
Liebenden, nicht aber die ironische Distanz, mit der Bürger das äußerst unwahrscheinliche Geschehen in seinem Versepos schildert, und die das Unglaubwürdige des Erzählten als deutlich erkennbare Erzählerfiktion erst
erträglich macht. Das unaufhebbare Spannungsgefüge zwischen Hölle und Seligkeit, um das es Storm geht, hat Bürger in seiner volkstümlichen Wiedergängerballade "Lenore" gestaltet. (Storm hat diese Ballade
Bürgers sehr geschätzt und sie später neben vier Gedichten in sein "Hausbuch" aufgenommen.) In Storms Erzählung wird es aus seinem christlichen Kontext herausgenommen und in einen Seelenzustand
transformiert; der Kampf zwischen Gut und Böse, der sich in der abendländischen Tradition als Überwindung des Todes durch Christi Auferstehung manifestiert, wird zur bIoßen menschlichen Kategorie, zur intimen
Angelegenheit zweier Liebenden.
Im Gegensatz zu Bürgers Behandlung des Stoffs, die auch den Schmerz des liebenden Mädchens vor dem Verlust des Geliebten andeutet, steht beim jungen Storm die
Angst vor der Gewalt der Sinnlichkeit im Mittelpunkt der Erzählung. Sie bestimmt das Verhalten des Ich-Erzählers und wird in dem Bild der wilden Hyänen gespiegelt, die das Leben des hilflosen Mädchens gefährden, so
wie sich der Erzähler als derjenige erfährt, der die Unschuld des Mädchens bedroht. In einer indirekten Kommunikation wird dieses Spannungsgefüge durch die Begriffe "Bruder" und "Schwester"
ausgesprochen; die inneren Vorgänge des Mädchens werden durch ihre Tränen und ihre körperliche Nähe erkennbar, während der Erzähler die Gefühle des jungen Mannes unverschlüsselt in einem inneren Monolog
thematisiert. Die Darstellung des Mädchens entspricht der späterer Frauengestalten Storms, die sich in ihrer ganzen Unschuld völlig dem geliebten Mann ergeben. Als das Mädchen sich aus Angst vor der drohenden Gefahr
durch die wilden Tiere ganz in seinen Schutz ergibt, beginnt er seine Scheu in einem Kampf "zwischen Himmel und Hölle" zu überwinden. Der junge Mann entspricht in seiner zögerlichen Haltung Reinhardt in
"Immensee"; im Gegensatz zu dieser späteren Novelle überwindet er seine Scheu, aber gerade als er zur Tat schreiten will, bricht der Erzähler die Szene ab und desillusioniert den Leser durch die Eröffnung,
dass es sich nur um einen Traum gehandelt hat."
Der Beitrag in der ONLINE-BIBLIOTHEK
|
|
2006
|
Singer, Rüdiger. Fortsetzender Nachgesang: Bürgers Lenore. In: "Nachgesang" Ein Konzept Herders, entwickelt am Ossian, der popular
ballad und der frühen Kunstballade.
“[S. 314] Schillers berüchtigte Kritik der zweiten Ausgabe von Bürgers Gedichten (1789) richtet sich vorgeblich nicht gegen dessen Balladen: Das
"längst entschiedne einstimmige Urteil des Publikums" beweise, dass er in dieser Gattung unübertroffen sei. Schiller greift zwei allgemeine Tendenzen der Lyrik Bürgers an, die Leitvorstellung ,Volkspoesie' und das unreflektierte Sprechen aus dem Affekt. Beides aber - so meine These - trifft letztlich gerade Bürgers ernste Balladen, und zwar insbesondere seine Lenore,
verweisen doch Gedicht wie Titelfigur auf eine lyrische Haltung, die Schiller überwinden möchte. So bietet sich Schillers Rezension als Folie für die Interpretation der Lenore als ,fortsetzender Nachgesang' an, kontrastiv zu Herder.
[S. 318] Beide Aspekte Volkspoesie und idealisierte Empfindung -schwingen also mit, wenn Schiller behauptet:
Herr B. vermischt sich nicht selten mit dem Volk, zu dem er sich herablassen
sollte, und anstatt es scherzend und spielend zu sich hinaufzuziehen,
gefällt es ihm oft, sich ihm gleich zu machen.
Das ließe sich noch als Kritik an einer bestimmten lyrischen Haltung deuten; doch Schiller wendet seine Argumentation unerbittlich ad hominem und behauptet, "daß seinen Produkten nur deswegen die letzte Hand fehlen möchte, weil sie ihm selbst fehlte." Bezeichnenderweise wählt er zum Beleg Passagen aus Bürgers Elegie, als Molly sich losreißen wollte und erinnert damit an das Skandalon, dass Bürger die Schwester seiner Ehefrau liebte und mit beiden schließlich in einer Dreier-Beziehung lebte. Zwar erwähnt Schiller den Sachverhalt nicht ausdrücklich; aber Verse wie "Herr mein Gott! Wie soll es werden? / Herr mein Gott! Erleuchte mich!" oder "Freier Strom sei meine Liebe, / Wo ich freier Schiffer bin « dürfte er kaum deshalb anführen, weil sie an sich stilistisch unhaltbar wären, sondern weil die hohen Worte nach Schillers Ansicht dem Gegenstand einer tadelhaften Privat-Leidenschaft unangemessen sind. “
|
|
2006
|
Schreiber, Mathias. Deutsch for sale. In: Der Spiegel 40/2006
“Das letzte Wort gebührt einem Vertreter jenes Standes, dem die deutsche Sprache am meisten verdankt: dem der Dichter. Gottfried August Bürger (´Lenore´) schrieb 1778: ´Wenn ihr eure
Sprache lieb habt, so tretet dem Schlendrian auf den Kopf und richtet euch nach den Regeln der Vernunft und einfachen Schönheit!´ “
|
|
2006
|
Drews, Jörg. Nachwort. In: Dichter beschimpfen Dichter. Ein Alphabet harter Urteile. Frankfurt am Main
“[S. 264] Die geistige Welt gliedert sich ohnehin nicht nach objektiven Urteilen, sondern eher nach geistigen Affinitäten, aber die Kumpaneien, Wahlverwandtschaften und kämpferischen
Allianzen sind ja nicht aller Argumente bar. Mag Schillers Attacke auf Bürger pompös von oben herab gewesen sein und in ihrer abstrakten Besserwisserei, ihrer edlen Farblosigkeit schon die ganze Schwäche des
klassischen Weimarer Literaturprojekts von 1790 bis 1805 präfigurieren - man kann Schiller seine Gemeinheit nicht vergeben, kann und muß aber übers Persönliche hinaus die literarästhetische Position erkennen, die
dahintersteht. Die ganzen gesammelten Schimpfkanonaden lösen doch weit mehr aus beim Leser als nur Schadenfreude; sie steigern vielmehr die Lebendigkeit des Nachdenkens über Literatur, zwingen einen selbst zu neuem
Nachdenken und wirken insgesamt aller Versteinerung entgegen. “
|
|
2006
|
Böhler, Michael. High und Low. Zur transatlantischen Zirkulation von kulturellem Kapital. In: Attraktion und Abwehr: die Amerikanisierung der Alltagskultur in Europa
“[S. 73] Es war Friedrich Schiller, der 1791 als einer der ersten im literarhistorisch berüchtigten ´Totalverriss´ seiner Rezension ´Über Bürgers Gedichte´, einer Sammlung von
Gedichten und Balladen (darunter der berühmten ´Lenore´), worin sich G. A. Bürger explizit als ´Volkssänger´ angekündigt und dem Programm der ´Popularität´ als ´seinem höchsten Gesetz´ verschrieben hatte, das
kulturästhetische Problem von ´High´ und ´Low´ in Verbindung mit der Populärkultur festgehalten und mit der stratifikatorischen Ausdifferenzierung der bürgerlichen Gesellschaft in Verbindung gebracht hat:
Jetzt ist zwischen der Auswahl einer Nation und der Masse derselben [...] oder den ungeheuren Abstand, der zwischen beiden sich befindet, durch die Grösse seiner Kunst aufzuheben und beide Zwecke vereinigt zu
verfolgen.
Damit ist jenes hierarchisch stratifikatorische Zwei-Ebenen-Modell von ´Hoch´ und ´Tief´, von Volkskultur und Gebildetenkultur erstmals gesellschaftstheoretische etabliert, das mit
Modifikationen, Erweiterungen und Ergänzungen den Diskurs der ästhetischen Moderne im Wesentlichen
bis vor kurzem bestimmt hat.
3. ´Amerikanisierung´ als Entdifferenzierung
In diesem
Diskussionszusammenhang wird nun bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert die Gefahr eines Niedergangs der ästhetischen Geschmackskultur mit dem Stichwort ´Amerika´ verknüpft, womit eine folgenreiche Verbindung
zwischen dem dualen ästhetischen Werte- und Normensystem mit seiner Dichitomisierung in ´High´ und ´Low´ und der amerikanischen Kultur hergestellt wird. 1889 schrieb der später nobilitierte Sir Edmund Gosse,
Literaturhistoriker in Cambridge, Bibliothekar, Übersetzer und Vermittler von Ibsens Dramen ins Englische, knappe hundert Jahre nach Schiller ganz ähnlich, aber nun mit direktem Bezug auf die Kultur der Vereinigten
Staaten: [...].”
|
|
2007
|
Oesterle, Günter. Friedrich Schillers Polemik gegen die Gedichte Gottfried August Bürgers und die Antwort der romantischen Schriftsteller. In: Positive Dialektik.
“[S. 107] Schiller hingegen rechtfertigte diese literarische Exekution des Werkes eines zeitgenössischen berühmten Schriftstellers
mit zwei Argumenten: erstens mit Bürgers
Berühmtheit und Genialität. Sie erlaube keine Schonung ästhetischer Fehler, weil die Nachahmer dieser Fehler eines genialen Schriftstellers nicht anders zu stoppen seien. Zweitens rechtfertigt er die Schärfe seiner
Polemik durch seine Zeitdiagnose eines Verfalls modemer Lyrik, dem man allein mit radikalen Reformschritten beikommen könnte.
Schiller verschweigt freilich, dass diese literarische Exekution in eigener Sache
geschieht, nämlich den Versuch darstellt eine Selbstreinigung von eigenen ästhetischen "Jugendsünden" zu bewerkstelligen. Schiller verschweigt auch, dass er mit seiner These, Polemik täte in diesem Falle
Not, damit den potentiellen Nachahmern von vornherein ein Riegel vorgeschoben werde, ganz konkret den jungen August Wilhelm Schlegel gemeint hat. In der Forschung ist bislang nicht bemerkt worden, dass Schillers
scharfe Kritik eine doppelte Stoßrichtung zukommt, nämlich außer gegen Gottfried August Bürger gegen dessen jungen Verehrer August Wilhehn Schlegel.
[S. 108] Die Antwort des Rezensenten Schiller ist
eindeutig: Gerade der Dichter, der populär sein will, darf sich auf keinen Fall - wie es G. A. Bürger getan habe - mit dem Volk gemein machen und "krude" Ausdrücke verwenden [...].
[S. 109] Kurz: Ein moderner, die Fortschritte der Kultur und Spezialdiskurse aufgreifender Dichter muss zur gebildeten Elite einer Nation gehören. Er muss das Kunststück hinbekommen,
ein "Medium" von "generativen Ideen" seiner Zeit zu werden, indem er seine Individualität zur höchsten "Reife" ausbildet. Dieses Kunststück ist freilich paradox: denn die Ausbildung
einer kollektiven Individualität gelingt nach Ansicht Schillers nur, wenn auf der einen Seite der Künstler seine ,,Individualität" in Breite und Intensität auf der Höhe seiner Zeit entfaltet, also sich
gleichsam menschheitlich aufbläst, auf der anderen Seite aber seine speziellen, einzigartigen, "streng individualistische[n]" und lokal gestimmte "Seltenheiten" läuternd und veredelnd abstreift und aufgibt. In keiner der theoretischen Schriften Schillers tritt die klassizistische Problematik einer das Kollektiv repräsentierenden Individualität, die der Künstler als Person repräsentieren soll, so komprimiert und zugespitzt auf als in der Polemik gegen Gottfried August Bürger.
[S. 110] Schiller bot nämlich das Beispiel für die Analyse von Bedingungen und Möglichkeiten einer Extremwende, das heißt im Falle Schillers von einem wilden Sturm- und Dränger zu einem
zivilisierten Klassizisten. Schiller hatte diese klassizistische Kehrtwende durchgeführt mit Hilfe einer polemischen Exekution eines seinem Frühwerk nahe stehenden berühmten Dichterkollegen Gottfried August Bürger.
Diese schonungslose ,,Inokulation" am Anderen aber in eigener Sache zielte auf eine therapeutisch-ästhetische Immunisierung der eigenen Vergangenheit.”
Der vollständige Beitrag in der ONLINE-BIBLIOTHEK.
|
|
2007
|
Kollmer, Patrick. "Gedicht ab - Vers läuft" - Parodie, Metapoesie und Komik in der Lyrik F. W. Bernsteins. GRIN Verlag
“[S. 97] P. K..: Sie wenden sich ja mehrmals gegen sehr metaphernreiche, pathetische Formen von Lyrik z. B. parodieren sie neben Durs Grünbein auch Peter Huchel. Was werfen sie
dieser Form von Lyrik vor?
F. W.: Gar nichts. um Gottes Willen! Das ist erst mal Material für mich, das ich oft unfreiwillig komisch finde. Bei Huchel war der Auslöser eine längere Radiosendung mit
Originalton Huchel, wo er seine dunklen Sachen gemacht hat, und ich habe dann bloß mal mitgeschrieben, stenogrammartig, einzelne Hauptwörter, Rhythmuswörter. Und das gibt auch wieder was, da kommt so ein Stück
Dadaismus mit rein. Kritik? Nein. Gernhardt nannte es das ´Nachäffen´. Es gibt Richard-Wagner-Parodien in der Musik, jede Menge, da spielt man damit und das soll und will erkannt werden von den Kennern. Das ist
jetzt auch nicht Kritik an Wagner. Aber Pathoskritik ist eigentlich sowieso immer ein Standardmotiv von Komik. Und da ja Gedichte immer von Gedichten kommen, wie Bilder in der Malerei von anderen Bildern kommen,
wird, glaube ich, jeder Lyriker nicht Innovationen haben, als etwas, was es noch nie gab, sondern wird auf Sachen zurückgreifen, wird angeregt werden, wird Tonfälle von anderen erweitern. Das kann erst mal als
Parodie daherkommen. Es gibt das schöne Beispiel, das war bei uns zu meiner Studienzeit an der Germanistik ein Paradefall: Die Erfindung der deutschen Kunstballade, Gottfried August Bürger, die ´Lenore´. Da gibt es
die genaue Entstehungsgeschichte. Das Ganze fing an als Parodie. Er wollte die Schauerballade, die damals so im Schwange war, parodieren und übertreiben. Bürger hat dann immer seine Kollegen vom Göttinger Hain
zusammen gerufen, wenn er wieder ein paar neue Strophen hatte und inszenierte das. Bei Mondschein und mit Kerzen auf dem Tisch trug er das vor, im hohen Ton, zum Lachen. Bloß, je mehr er reinkam in das Ganze, um so
mehr hat er es ernst genommen, wurde es ihm wichtiger und am Schluss ist da von Parodie nichts mehr zu sehen. Es ist die Kunstballade überhaupt. Das ist ein genau dokumentiertes Beispiel aus dem Briefwechsel und den
Tagebüchern der Kollegen von einer lyrischen Genese, die erst mal als kritisches, respektloses Spiel mit Sprachmaterialien beginnt, dann kriegt das ein Übergewicht, ein Schwergewicht und es wird seine Musik daraus.
Als er fertig war und das Ganze vorgetragen hat, waren die parodistischen Elemente, auch in der Inszenierung, beiseite geräumt und alle waren ergriffen und sagten: ´Mann, das ist es!´ Das wäre so eine Möglichkeit,
auf diese Weise zu bleibenden Ergebnissen zu kommen. Mit kritischem Improvisieren anfangen. Das Huchel-Gedicht ist auch so eine Art Improvisation, um dann langsam rein zu kommen und Formen zu finden.“
|
|
2007
|
Wellbery, David E. u. A. Eine neue Geschichte der deutschen Literatur, Lizenzausgabe für die Wissenschaftliche Buchgesellschaft (WBG), Darmstadt
Die möglicherweise einzige Geschichte der deutschen Literatur, die auf Gottfried August Bürger verzichtet. Er wird lediglich mit dem Satz
“In der Mitte der 1790er Jahre hatte er bereits (gemeinsam mit Gottfried August Bürger) den Versuch unternommen, A Midsummer Night’s Dream zu übertragen [...].” im Kapitel August Wilhelm Schlegel fordert eine poetische Übersetzung von Shakespeares Werken erwähnt. [K. D.]
|
|
2007
|
Sihler, Helmut. Luxusmarken im gesellschaftlichen Wandel. In: Marktorientierte Führung im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel
"[S.178] Mit erfolgreichen Luxusmarken lassen sich aufgrund der Preisgestaltung hohe Gewinne erzielen. Manchmal tritt der paradoxe Zustand auf, dass Preiserhöhungen zu Mehrverkäufen führen, weil der
Geltungsnutzen möglicherweise gesteigert wird. Der technische Ausdruck dafür lautet, oft durch die Fakten gerechtfertigt, "confident pricing". Die Kehrseite dieser Medaille ist die Markenpiraterie. In
begrenztem Ausmaß ist Nachahmung sicherlich auch eine Art von Werbung. ´Es sind die schlechtesten Früchte nicht, an denen die Wespen nagen´. Das Prestigebewusstsein des Käufers von Luxusmarken verhindert die Jagd
nach Schnäppchen.”
|
|
2008
|
Reich-Ranicki, Marcel. Fragen Sie Reich-Ranicki. Frankfurter Allgemeine FAZ.NET 9.November
“Außer dem „Münchhausen“ begegnet man Gottfried August Bürgers Werken, etwa der Ballade „Lenore“, heute kaum noch. Zu Recht? War Schillers Kritik berechtigt? Wilfried Bürger, Hamburg
Reich-Ranicki: Die Voraussetzung ist, wie oft in solchen Fragen, nicht richtig. In den Anthologien, die das 18. Jahrhundert umfassen, finden sich in der Regel mehrere Gedichte Bürgers. Ich glaube, das reicht.
Schillers Kritik der Lyrik Bürgers? Glänzend und immer noch interessant.”
|
|
2008
|
Alt, Peter-André. Franz Kafka: Der ewige Sohn: eine Biographie. C. H. Beck
“[S. 258] Negative Dialektik.
[...] Vor Unglücklichsein, dem letzten Text der Sammlung, hat Kafka zwei kurze Stücke plaziert, die Experimente auf dem Feld der Logik
unternehmen. Wunsch, Indianer zu werden entwirft im Konditionalis, ähnlich wie später der erste Teil von Auf der Galerie (1917), ein Szenario, das den Magazinen der Einbildungskraft entstammt. Beschrieben wird das visionäre Bild eines reitenden Indianers, der sich der (nur imaginierten) Sporen und Zügel entledigt, während er in rasendem Tempo über die Prärie galoppiert. Wenn schließlich das ihn tragende Pferd Hals und Kopf verliert, so mag man sich an Gottfried August Bürgers berühmte Ballade Lenore (1774) erinnern, die den Gespensterritt des Mädchens mit seinem toten Bräutigam zum apokalyptischen Bild der Strafe werden läßt. Anders als bei Kafka, der Bürgers Text aus der Schule kannte, zerfällt hier nicht der Leib des Pferdes, sondern jener des Reiters, der aus dem Reich der Gräber gekommen ist. “
|
|
2009
|
Nabokov, Vladimir. Kommentar zu Eugen Onegin.
“[S. 822] Lenore besteht aus 256 Zeilen oder aus 32 Strophen mit acht jambischen Zeilen mit dem Reimschema babaccee sowie männlich endenden Vierhebern und weiblich endenden Trimetern - ein höchst erfinderisches Arrangement. Dieses Muster wird von Shukowskij in seiner mittelmäßigen Übersetzung von 1831 (Lenora) exakt nachgeahmt und ist die exakte Strophenform von Puschkins Der Bräutigam (Shenich,
1825), einem Gedicht, das an künstlerischem Genie alles, was Bürger je geschrieben hat, bei weitem übertrifft. Seine Lenore verdankt vieles altenglischen Balladen; [...].”
|
|
2009
|
Schacht, Andrea. Goldbrokat: Historischer Roman. Blanvalet Verlag
“Geisterseher
Nun tanzten wohl bei Mondenglanz, Rundum herum im Kreise, Die Geister einen Kettentanz, Und heulten diese Weise: Geduld! Geduld! Wenn´s
Herz auch bricht!
Gottfried August Bürger, Lenore
Die Nähmaschine ratterte fröhlich, und unter meiner Hand bewegte sich eilig der Stoff voran. Welch eine Erfindung! Was früher
Stunden brauchte, wurde mit ihr in Minuten fertig. Vor allem die langen Säume der weiten Röcke, die zahllosen Bahnen, die man aneinanderheften musste, konnte ich alleine damit nähen, ohne eine weitere Hilfskraft
einzustellen. Aber dennoch brauchte ich Nona regelmäßig jeden Vormittag, damit sie die komplizierteren Arbeiten übernahm. Hauchdünne Stoffe verdarb die Maschine, zarte Spitzen vertraute ich ihr nicht an, Kragen,
Ärmelsäume, Knopfleisten, alles, worauf das Auge gelenkt wurde, stichelte Nona weit sorgfältiger als die Maschine. Das neue Leben schien ihr zu behagen. Selbst der hässliche Vorfall im Salon Vaudeville hatte sie
nicht verstört. Bereitwillig halte sie mir von der Schlägerei erzählt und auch über LouLous Schwierigkeiten berichtet. Die Behörden - die finstersten Dämonen der Hölle mochten dereinst die preußischen Beamten braten
- hatten gedroht, ihr die Konzession zu entziehen. “
|
|
2009
|
G. A. Bürger - Erwähnungen in Karl Mays Werk. In: Das Karl-May-Wiki
“Lenore wird zitiert in
1. Das Buch der Liebe
Doch wehe, wenn dieser stille, ruhige Schmerz sich in jene wilde Leidenschaftlichkeit verwandelt,
welche an Allem, selbst an Gottes Gerechtigkeit verzweifelnd, gegen sich selbst und alles Bestehende wüthet und tobt:
´Lisch aus, mein Licht, auf ewig aus;
Stirb' hin, stirb' hin, in Nacht und Graus.
Ich mag ohn' ihn auf Erden,
Mag dort nicht selig werden!´
Diese, das
Schwert sich tiefer und immer tiefer in den Busen stoßende Leidenschaftlichkeit gleicht jenem dunklen, mit sprühendem Funkenregen am Hochgerichte vorübersausenden Geisterrosse, auf welchem der Tod hockt und Bürgers
´Leonore´ unter nachrasselndem Gespensterspuke dem körperlichen und geistigen Untergange entgegenführt.
2. Der verlorne Sohn
´... Und dann muß es durch die Luft gehen, hurr, hurr, hopp, hopp, hopp, gerade wie in dem Gedichte von der Lenore, welches der Schiller gemacht hat, oder der Beethoven oder der alte Schweppermann;
ich weiß es nicht genau; kurz und gut, ein berühmter Kerl ist es gewesen. ...´
3. Deutsche Herzen - Deutsche Helden
Und mir ists gegangen, wie es in der Lenore heißt:
'Er frug den Zug wohl auf und ab,
Und frug nach allen Namen,
Doch Keiner war, der Kunde gab,
Von Allen, die da kamen.' ..."
4. Der schwarze Mustang
´... An dieser
Weisheet is nimmermehr zu rütteln und zu wackeln; sie is so fest gefügt und unerschütterlich, daß schon Schiller, der berühmte Dichter von Uhlands 'Lenore fuhr ins Morgenrot' in seinem 'Götz von Berlichingen' gesagt
hat: Die Vorwelt flicht der Nachwelt keene Kränze, jedoch der Frühling duftet schon im
Lenze!´
Der wilde Jäger wird zitiert in
1. Der Schatz im Silbersee
´Höre, das is zu schtark; nu wird mirsch zu toll. Ich kann dich nur mit den Worten niederschmettern, welche Heinrich Heine in 'Des Sängers Fluch' bringt, nämlich:
'Du Wütrich teuflischer Natur,
Frech gegen Gott und Mensch und Tier,
Das Ach und Weh der Kreatur
Und deine Missethat an ihr
Hat polizeilich dich beordert
Und vor das Amtsgericht gefordert.'
Da – nu weeßt du meine
Meenung. Nimm sie dir zu Herzen und drehe sie so lange in deinem Gemüte rum und num, bis du zur reuevollen Einsicht gelangst!´
´Aber, alter Frank, ich meine es ja gar nicht bös; ich muß dich als
Freund doch aufmerksam machen, wenn du dich irrst. Ich will nicht haben, daß du dich blamierst.´
´So? Kann ich – ich – ich, nämlich ich, der Hobble-Frank aus Moritzburg, mich etwa wirklich irren und blamieren?´
´Ebenso wie jeder andre Mensch. Gerade auch der Reim, den du jetzt
gebraucht hast, ist ein Beweis dafür. Erstens ist im Originale weder von der Polizei, noch von einem Amtsgerichte die Rede; zweitens ist das Gedicht nicht von Heine, sondern von Bürger, und drittens lautet seine
Ueberschrift nicht 'Des Sängers Fluch' sondern 'Der wilde Jäger'.´
´So so, i der Tausend! Was du nich alles weeßt oder wissen willst! Wenn du dich in dieser Weise an mich wagst, so kann ich dir nur
sagen, daß meine Litteraturgeschichte nich von Blech is, sondern über jeder andern erhaben schteht. Durch deine Verdrehungen der wahrhaftigen Thatsachen und Unwahrscheinlichkeeten willst du mich selber zum wilden
Jäger machen; aber das soll dir nich gelingen. Rede von jetzt an, was du willst, ich schpreche keen Wort mehr mit dir, sondern hülle mich dir gegenüber in die tiefste Verächtlichkeet. Wer Heine und Bürger
verwechseln kann, noch dazu hier im indianischen Wigwam, dem sind alle Schterne untergegangen. ...´ “
|
|
2010
|
Hochweiler, Peter. Rena Puella: Ein Lustrum der Liebe. Norderstedt, Books on Demand
“[S. 18] Das Tele endete am Donnerstag, dem 2. Dezember, nachts 1:37 Uhr. Jetzt, nachdem Rena gestanden hatte, mich ´ficken´zu wollen, stand einem Date nichts mehr im Wege, und so
klopften wir im anschließenden Telefongespräch den Sonntag, den 12. Dezember, für unser erstes Treffen fest. [...] In den Telefongesprächen ging es nicht ausschließlich um das Thema Nummer Eins. Der Name
´Tintenbub´, die Figur aus Struwwelpeter war ja der Anlaß gewesen, dass Rena mich am Montag angetelt hatte. Noch in der ersten Nacht hatte ich Ovids Corinna-Gedicht aus den ´Liebeselegien´in der Übersetzung von Axel
von Bernus vorgelesen, eines meiner Lieblingsgedichte überhaupt. Auch Rena steuerte ihren Teil dazu bei und las ´Des Pfarrers Tochter von Taubenhain´ vor, eine der bekanntesten Balladen von Gottfried August Bürger.
Und ich revanchierte mich mit einer anderen bekannten Bürgerballade, der ´Lenore´. “
|
|
2010
|
Knödler, Stefan. Rudolf Borchardts Anthologien. Walter de Gruyter
“[S. 247] Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Borchardts Kanon deutscher Poesie im Ewigen Vorrat und den Anthologien von Echtermeyer, Vesper und George und Wolfskehl hängen eng mit Borchardts Entwurf einer deutschen Literaturgeschichte zusammen. [...] Die großen Dichter des Barock fehlen mit Ausnahme von Opitz und Fleming vollständig, aber die Zeit von etwa 1750 - 1850 - das ´Jahrhundert Goethes´ - ist naturgemäß am besten dokumentiert, besonders die beiden großen Namen Goethe und Schiller, beide mit sowohl bekannten als auch weniger bekannten Texten. Gottfried August Bürger und Heinrich von Kleist ragen heraus. Bürger, der als Dichter nach Schillers Verriß das
19. Jahrhundert über (und auch heute wieder) vor allem als Verfasser der Ballade ´Lenore´ bekannt geblieben ist - und im ´Echtermeyer´mit diesem und fünf anderen Gedichten vertreten ist -, war um die
Jahrhundertwende weitgehend vergessen und fehlt daher auch bei Vesper und George und Wolfskehl. Borchardt hat vor allem solche Gedichte Bürgers ausgewählt, denen jener schlichte, innige Ton zu eigen ist, der auch
den Großteil der anderen Gedichte des Ewigen Vorrats auszeichnet. “
|
|
2010
|
Soubigou, Gilles. The Reception of Robert Burns’ poems in French Art. In: international journal of scottish literature, ISSUE SIX, SPRING/SUMMER
“[S. 8] Gottfried Bürger’s 1773 ballad Lenor, which was known in Great Britain thanks to Walter Scott’s 1796 translation, William and Helen, and in France thanks to Madame de Staël’s
1814 De l’Allemagne and Gérard de Nerval’s 1829 translation, also fascinated French artists who were captivated by its visual possibilities. Tony Johannot engraved a Lenore c. 1830, and published it in the journal
La Silhouette. Louis Boulanger executed c. 1831-1837 an unpublished print on the same theme.* Horace Vernet’s 1839 Lenore, kept in Nantes, is probably one of the most striking images of this subject, while Ary
Scheffer’s c. 1825-30 For the Dead Travel Fast, which title is Bürger’s ballad catch-up line, bears some clear similarities with Delacroix’s composition for his Tam o’ Shanter.
* At the 1834 Paris Salon he
exhibited a lost painting on the same subject. Felix Cottrau also exhibited a Lénore ou les morts vont vite at the Paris 1831 Salon (n. 403). “
|
|
2010
|
Backscheider, Paula R. Eighteenth-Century Women Poets and Their Poetry: Inventing Agency, Inventing Genre
“[o. S.] John Sitter points out that it is easy ´to underestimate the poetic richness´ of eighteenthcentury poetry and to glide over ´the placid surfaces of eighteenth-century
urbanity.´ The poetry, however, is ´waiting to be produced by active readers,´ ´brought to life by imaginative interpretation.´ A well-read or well-recited poem still comes to life in ways that silent reading seldom accomplishes, and the history of reading poetry in the century yields important evidence about the revolulionary shift in readers who gave up their role as judges to enjoy being acted upon rather than acting. People came miles to hear the elderly Anna Seward read poems, most notably Gottfried August Bürger's Lenore.
In the preface to his Poems (1778) Bürger had written that all poetry ´can and should be popular. For that is the seal of its perfection.´ This standard, one that many writers, publishers, and readers of poetry in
England seemed to embrace, underscores the differences between that century's literary culture and ours.“
|
|
2010
|
Wellershoff, Maria. Von Ort zu Ort: Eine Jugend in Pommern, Dumont Buchverlag
“[o. S.] Die Gäste nahmen im
Musikzimmer Platz. Prof. Tuerschmann, den ich als korpulent in Erinnerung habe, stellte sich neben den Flügel und deklamierte in einer - wie wir Kinder fanden - penetranten und übertriebenen Bühnensprache, das stark
gerollte R belustigte uns besonders. Wir hatten keinen Sinn dafür, dass ´das richtige Erfassen der Stileigentümlichkeiten, des Ideen-, Gefühls- und Stimmungsgehaltes des vorzutragenden Kunstwerks das Ziel des
Vortragskünstlers´ sein sollte. Am Flügel saß der schlanke Herr Kratz und begleitete mal fortissimo, mal pianissimo zunächst Goethes ´Erlkönig´ und darauf die Ballade ´Lenore´ von Gottfried August Bürger: ´Lenore
fuhr ums Morgenrot empor aus schweren Träumen . ´Bist untreu, Wilhelm oder tot? Wie lange willst du säumen?´ Diese Ballade mit dreißig Versen war für den Professor nur ein kurzes Gedicht; er behauptete, die ganze Ilias von Homer auswendig zu können, und zwar auf Griechisch. Wer sollte das nachprüfen?”
|
|
2010
|
Rothe, Hans. Achtes Kapitel: Die Geschichtsanschauung. In: Hermann von Boyen und die polnische Frage: Denkschriften von 1794 bis 1846
“[S. 162] Und damit ist der Punkt bezeichnet, um den es gung: die preußischen Reformgesetze von 1807. Es war der empfindlichste Nerv von Boyen getroffen. Bitter sagte er: ´mit Gewalt´ wolle
man ´uns in einen historischen Bildersaal zurückführen´, und fügte hinzu: ´ach laß sie ruhen die Todten! Könnte man hier wohl mit Bürger ausrufen´.”
|
|
2010
|
Hahn, Anna Katharina. Kürzere Tage: Roman
"Die Zähne sind im Bad, die darf ich nicht vergessen. Glänzender Stoff. Damast, schön sieht das aus.
Das ist noch von daheeme, Wenzel, das wird dir gefallen, von deiner Schwester. Ich hab so was nie gemacht, nur Socken stopfen, das kann ich gut. Sie kippt Cognac auf die eine Serviette, der weiße Stoff färbt sich
hellbraun. Es läuft auf Tischtuch und Fußboden. Egal, ich nehm den ganzen Rest, es wird keiner mehr davon trinken. Sag an, wo ist dein Kämmerlein? Wo? Wie dein Hochzeitsbettchen? Weit, weit von hier! ... Still, kühl
und klein! ... Sechs Bretter und zwei Brettchen! - Hat's Raum für mich? - Für dich und mich!"
|
|
2010
|
Ebert, Andreas D. Friedrich Theodor Althoff und die Frauenheilkunde in Preußen. In: Geschichte der Berliner Universitäts-Frauenkliniken
"[S.
65] Politisch korrekt war auch Friedrich Althoff wohl eher selten. Doch der Rückhalt seines Kaisers war ihm wichtig. Wirkliche Freunde erwarb er sich durch seine Aktivitäten nur wenige - offene Feinde zu Lebzeiten
jedoch auch nicht (Paulsen 1907). ´Es sind die schlechtesten Früchte nicht, an denen die Wespen nagen´, widwete ihm Wilhelm II. eigenhändig das kaiserliche Portrait ..."
|
|
2011
|
Weinmann, Frédéric. Das Populäre bei Gottfried August Bürger. In: Das Populäre, Göttingen.
“[S. 76] Gottfried August Bürger war zweifelsohne den beiden anderen [Schiller und A.W. Schlegel] intellektuell und künstlerisch unterlegen. Aber er hat vor allem gegen seine Zeit
argumentiert. Er wollte eine Volksdichtung definieren und hervorbringen, die weder für die Masse allein noch ausschließlich für die Elite geeignet gewesen wäre, sondern sich an das breitmöglichste Publikum richtete,
weil sie nicht die ´Veredelung´oder das ´Höchste´anstrebte, sondern die Emotion. Er hat versucht, gegen die Polarisierung von high and low, populär im Sinne von trivial und populär als
Gattungsbezeichnung eine Alternative anzubieten, die diese Dialektik überwunden hätte. Dieses anachronistische Unterfangen erscheint als ein Kampf auf verlorenem Posten. Niemand konnte ihn damals hören. Die Zukunft
gehörte für zwei Jahrhunderte dem Athenäum, dessen viertes Fragment eben lautet:
Zum großen Nachteil der Theorie von den Dichtarten vernachlässigt man oft die Unterabteilungen der
Gattungen. So teilt sich zum Beispiel die Naturpoesie in die natürliche und in die künstliche, und die Volkspoesie in die Volkspoesie für das Volk und in die Volkspoesie für Standespersonen und Gelehrte.“
|
|
2011
|
Hitzemann, Thomas. Liszt-Hommage der besonderen Art. In: Neue Osnabrücker Zeitung 4. November
“Die Hauptrolle aber fällt Helmut Thiele zu. Seine Rezitationen sind beachtlich. Wer Thiele kennt, bemerkt, wie weit er sich von humorvoll hintersinniger Deklamation fortbewegt hat zu
dramatisch packender Sprechweise. Kontinuierlich steigert er sich bei Nikolaus Lenaus ´Der traurige Mönch´ über Moritz Jokais ´Des toten Dichter Liebe´ und Alexei Tolstois ´Der blinde Sänger´ bis hin zu Gottfried
August Bürgers Ballade ´Lenore´.
Während der letzten Ballade stürzt sich Thiele in Pathos. Mit grandiosem Erfolg! Sprecher, Text und Musik verschmelzen zu unlösbarer Einheit. Die jahrzehntelang als
verpönt geltende pathetische Deklamation erlebt hier eine Auferstehung als sinnvoll gebrauchtes Stilmittel. “
|
|
2011
|
Heuwinkel, André. Auf einen Ritt durch die Nacht. In: Lampertheimer Zeitung.
“11.10.2011 - NEUSCHLOSS
Von André Heuwinkel
KLASSIK Katja Schumann und Cornelia Weiß entführen in bravouröser Manier ihre Zuhörer auf eine musikalische Reise. [...]
Höhepunkt des Klassik-Konzerts war zweifelsfrei der Vortrag der „Lenore“ von Franz Liszt (1811-1856).
Es handelt sich hierbei um ein Melodram mit belehrender Botschaft, welches im Sprechgesang
vorgetragen wird. Die im Tonfall äußerst variablen Rezitationskünste der Mezzosopranistin Schumann und ihre Mimik bildeten im Verbund mit der instrumentalen Untermalung Weiß‘ eine kongeniale Melange. Der Text geht
zurück auf den Dichter Gottfried August Bürger und entstand im Jahr 1773. Die Protagonistin Lenore wartet während des Siebenjährigen Kriegs (1756-1763) auf ihren Verlobten Wilhelm, der für Friedrich den Großen
kämpft, jedoch nicht aus der Schlacht bei Prag heimkehrt. Lenore hofft auf seine Rückkehr und hadert mit Gott. Schließlich erscheint ihr Wilhelm als Geist und entführt sie auf einen Ritt durch die Nacht. Lenore wird
in ihr „Hochzeitsbett“ gebracht, das sich als Sarg herausstellt. Sie stirbt und wird für ihre Zweifel an Gott bestraft. Die Zuschauer im Gemeindesaal quittierten den Vortrag mit frenetischem Beifall.”
|
|
2011
|
Friedländer, Vera. Ich bin Vergangenheit und Gegenwart. Berlin.
“[S. 50] In meiner Balladenzeit als Vierzehnjährige wählte ich zuerst Chamisso ´Der rechte Barbier´, es war so wunderbar dramatisch und witzig zugleich. Als bei uns die Romantik aktuell
war, trug ich Droste-Hülshoffs Gedicht ´Der Knabe im Moor´ vor. Irgendwann war ich bei Bürgers ´Lenore´ angekommen, die ums Morgenrot aus wilden Träumen emporfuhr. Das war mir vertraut, Krieg und Tod und Angst, und
in die Liebessehnsucht fühlte ich mich hinein. “
|
|
2011
|
Melton, J. Gordon. The vampire book: the encyclopedia of the undead
“[p. 533] The Vampire in Germany: The emergence of the modern literary vampire began with the exploration of the vampiric theme in the poetry of Germany. More than a generation prior to John Polidori's famous 1819 novella, ´The Vampyre´,
poets were reacting to the intense debate on the subject of vampirism that took place in the German universities in the mid-eighteenth century. Possibly the first such poem was ´Der Vampir´ written by Heinrich August Ossenfelder:
My dear young maiden clingeth Unbending, fast and firm To all the long-held teaching Of a mother ever true; As in
vampires unmortal Folk on the Theyse's portal Heyduck-like do believe.
But my Christian thou dost dally, And wilt my loving parry Till I myself avenging To a vampire's health a-drinking Him
toast in pale tockay.
And as softly thou art sleeping To thee shall I come creeping And thy life's blood drain away.
And so shalt thou be trembling For thus shall I be kissing And death's threshold thou'lt be crossing With fear, in my cold
arms.
And last shall I thee question Compared to such instruction What are a mother's charms?
Many similar poems show up in the collection of other poets. More important than any of these specifically
vampire poems, however, was Gottfried August Bürger's ´Lenora´. ´Lenora´ told the story of William, a young man who died but came back to claim his bride. Arriving in the middle of the night, he called his
unsuspecting Lenora to travel with him to their bridal bower. She responded:
´Say on, where is our bridal hall! Where, how the nuptial bower? Far, far from here! Still, cool, and small, Where storms
do never lower.
Hast room for me. For me and thee.
Come up and dress and mount with me! The wedding guests are waiting No more of this debating!´
After a ride across the country at breakneck speed, William spoke again:
´In somber gloom we near the tomb With song and wailing tearful! Come, open stands the bridal room, Though all
around look fearful.
Come sexton, quick! Come with the choir, Our bridal song with reed and lyre! Come, priest, and say the blessing,
Nor wait for our confessing.´´
The couple rode into the graveyard:
High reared the steed and wildly neighed; Fire from his nostrils started.
And lo! from underneath the maid The earth to 'dmit them parted.
While not a vampire poem, ´Lenora´does play upon the themes of love and death, which are so essential to the vampire's life.
Denounced by the literary critics, it nevertheless found a popular following. In the 1790s it was translated into English by William Taylor of Norwich and for several years circulated around Norwich as a favored
topic for poetry reading/discussion groups, then a widespread entertainment event. Sir Walter Scott heard of ´Lenora´ from the discussions of Taylor's as yet unpublished poem and went about securing a copy of the
original German text. Upon reading it, he too became enthusiastic and chose to make his own translation of the ballad the initial publication of his lengthy literary career. Published the same year as Taylor's
translation, it became by far the more popular version. The importance of ´Lenora´ was further demonstrated by the fact that at least three translations were made in 1796 alone and others in subsequent years.
In Germany, ´Lenora´ inspired what has been traditionally called the first vampire poem, ´The Bride if Corinth´(`Die Braut von Korinth´), in 1797 by Johann Wolfgang von Goethe. In most later commentaries on the
vampire in literature, Goethe was said to have based his poem on the account from ancient Greece of the encounter of the philosopher Apollonius with a lamiai. However, it is, in fact, a retelling of another story;
that of Philinnon as related by Phlegon. Goethe's version told of a young man who had traveled to Athens to claim his bride, the daughter of his father's comrade.
Shown into a guest room after his travels by
the woman of the house, he was surprised by the arrival of a beautiful young woman at his door. He noted her paleness, but nevertheless invited her in. She wanted a lock of his hair. He offered her wine, but she
would not drink until midnight, at wich time she assumed a nem vitality. As dawn approached, the mother heard the activity of the two lovers and burst into the room. The girl turned out to be the recently deceased
daughter of the family. She had returned from her grave to find that her love had denied her. Before she left, she told the young man that he would soon join her in death, and asked her mother to see that their
bodies were burned. She had been given an ineffective Christian burial, and was now roaming the land without the peace of death.
The Vampire in England: ´Lenore´ and ´The Bride of Corinth´ became
standard reading for the emerging Romantic movement and the poets who were exploring their inner consciousness. Both Shelley and Lord Byron were enthusiastic about it, and ´Lenora´ directly influenced Samuel Taylor
Coleridge and Robert Southey who shared the honors for producing the first vampire poems in English.”
|
|
2011
|
Althaus, Hans Peter. Literatursprache. In: Deutsche Wörter jiddischer Herkunft
“Am weitesten vom jüdischen
Ursprung haben sich die Wörter in der Lyrik entfernt. Hier werden sie seit Gottfried August Bürger als poetisches Rohmaterial gebraucht, mit dem der Sprache neue Ausdrucksnuancen abgerungen werden können. Alfred
Kerr, Karl Kraus, Loachim Ringelnatz, Gottfried Benn, Max Herrmann-Neiße, Walter Mehrung, Ludwig Harig, Sarah Kirsch, Robert Gernhardt und viele andere haben sich dieses Wortschatzes in manchmal überraschender Weise
bedient.”
|
|
2012
|
Bahnsen, Uwe. Alles hörte auf sein Kommando. In: WELT-ONLINE, 22.01.
“Es sind 100 Stunden, in denen aus dem Polizeisenator Schmidt der ´Herr der Flut´ wird. Nun wird offenbar, dass dieser Mann mehr ist als ´Schmidt-Schnauze´, der brillante Debattenredner
im Bundestag. In das öffentliche Bewusstsein tritt der ´Macher´ mit eisernen Nerven und Ellenbogen. Weit über Hamburg und auch weit über die Bundesrepublik hinaus hinterlässt Schmidts Leistung einen tiefen, bis
heute nachwirkenden Eindruck. Aus dem fernen Afrika, dem Urwaldhospital Lambarene, schreibt ihm der große Theologe, Musiker, Arzt und Philosoph Albert Schweitzer (1875-1965): ´Erlauben Sie mir altem Mann, Ihnen
meine Hochachtung auszudrücken. Innerlich habe ich das ,Lied vom braven Mann' Ihnen zu Ehren hergesagt.´ Die 20 Strophen des berühmten Gedichts von Gottfried August Bürger legt er seinem Brief an Schmidt bei. “
|
|
2012
|
8. Sinfoniekonzert Theater Rudolstadt / Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt
“»Lenore - Heldin wider Willen« - Werke von Duparc, Hummel und Raff
17. Mai 2013 / 19:30 Uhr / Meininger Hof Saalfeld
18. Mai 2013 / 19:30 Uhr / Theater Rudolstadt
Henri Duparc / »Lenore« Sinfonische Dichtung nach Bürgers Ballade (1875)
Johann Nepomuk Hummel / Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 a-Moll op. 85 (1821)
Joachim Raff / Sinfonie Nr. 5 E-Dur, op. 177 »Lenore« (1872)
Viktor Vyssotzki, Klavier / Sprecher: N. N. / Musikalische Leitung: Oliver Weder
»Lenore fuhr ums Morgenrot / Empor aus schweren Träumen: /
Bist untreu, Wilhelm, oder tot? / Wie lange willst du säumen?« Schicksalsschwanger hebt die Ballade von Gottfried August Bürger an. In den 32 Strophen beklagt die junge Braut den Tod ihres Verlobten. Am Ende stirbt
Lenore nach einem gespenstischen Traumritt. Die 1774 erschienene Geschichte löste europaweit Begeisterung aus und war noch hundert Jahre später Quelle der Inspiration für etliche Kunstwerke.
Henri Duparc war
Schüler von César Franck und Zeitgenosse von Camille Saint-Saëns. Seine sinfonische Dichtung »Lenore« machte ihn schlagartig berühmt. Mit rasanten, aber auch zärtlichen Klängen zeichnet er die Szenerie der
alptraumhaften Handlung nach.
Anders geht Joachim Raff vor: In seiner fünften Sinfonie steht weniger die moralische Botschaft als vielmehr die tragische Liebesgeschichte im Mittelpunkt. Auf das Glück der
Brautleute folgen die Trennung bei Kriegsbeginn und die Wiedervereinigung im Tode. Nachdem Raff lange für Liszt instrumentiert hatte, ging er eigene Wege und wurde zu einem sehr populären Komponisten. Dazu trugen
vor allem seine klug und farbig instrumentierten Programmsinfonien bei.
Eine sowohl zeitliche als auch stilistische Brücke zu Bürgers Ballade schlägt das zweite Klavierkonzert von Johann Nepomuk Hummel.
Mozart gab dem späteren Hofkapellmeister von Weimar in dessen Jugendtagen kostenlos Klavierunterricht. Als Komponist entwickelte Hummel aus einer klassischen Grundhaltung heraus eine eigene romantische Tonsprache.
Mit seinem unprätentiös-virtuosen Spiel war er einer der besten Pianisten seiner Zeit, und so finden sich in seinem Werk perlende Läufe neben schwärmerisch impulsiven Harmonien.
Musikalische Leitung Oliver Weder “
|
|
2012
|
Schübler, Walter. Bürger, Gottfried August BIOGRAPHIE. Verlag Traugott Bautz
“1774 mit der Lenore Shooting-Star der deutschen Literatur, 1778 mit seinen gesammelten Gedichten ´Dichter der Nazion´, kurz darauf in einem zeitgenössischen Ranking gleichauf mit
Lessing, Klopstock, Goethe: Gottfried August Bürger (1747-1794). Heute ist der Autor des Münchhausen vergessen. Warum? - Weil's offenbar doch Verhältnisse im Leben gibt, wo der Philister zuletzt immer recht behält.
Schiller rezensiert ihn 1791 ´um alle menschliche Ehre´, qualifiziert mit dem Werk den ´liederlichen´ Dichter ab, dem es an ´sittlicher Maßbeschränkung´ mangle - und die ´Literärgeschichtler´ plappern dieses Verdikt
bis in die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts nach. Soziale Ächtung auch seitens der Göttinger akademischen Kollegenschaft: Privatdozent Bürger bekennt sich unverhohlen zur Französischen Revolution! Postum
verleiht ihm Heinrich Heine dafür den gebührenden Ehrentitel: ´Der Name Bürger ist im Deutschen gleichbedeutend mit dem Worte citoyen.´ “
|
|
2012
|
Nadolny, Sten. Er oder ich: Roman. Piper Verlag
“[o. S.] Müdigkeit. Hätte nicht die letzte Nacht am Computer verbringen und ´Myst´ spielen
sollen. Aber ich hatte Angst vor der Nacht. Zwar schlafe ich stets rasch ein, aber dann beginnen die Traumkatastrophen. Das Unglück setzt sich beim Aufwachen um drei oder vier Uhr mit der bleiernen Gewißheit
baldigen Todes fort. Gegen sechs läßt sich mein schmähliches Ende wieder um ein paar Wochen, gegen acht Uhr sogar um Jahre hinausschieben. Ich bezahle nachts für
etwas, was ich falsch gemacht haben muß, bezahle
reichlich, halte eine ganze Runde von Teufeln frei. Strafe, wofür? Wer straft? Und wie um Gottes willen bringe ich es zu ermutigenderen Träumen? Kann man vielleicht den Tag so leben und steuern, daß die Nacht stärkt
und nicht zermalmt?
Woher stammt der Satz: ´Was spricht die tiefe Mitternacht?´ Irgendein Gedicht. ´Lenore fuhr ums Morgenrot empor aus schweren Träumen´ kann es kaum sein. Eine Frage, ich drehe
zum Notieren das Heft um. Und jetzt möchte ich, wie in den alten Zeiten, genüßlich im Kursbuch - peng, das war's, was ich vergessen hatte! Ich merkte etwas später, daß dies geschehen war, vergaß aber dann, daß ich's
gemerkt hatte.”
|
|
2012
|
Hensel, Rolf. Not, Unrecht und Gefahr. In: Stufen zum Schafott. Der Berliner Stadtschulrat und Oberbürgermeister von Görlitz: Hans Meinshausen. Digitalisiert von Google
“[S. 95] Das Ehepaar Erich und Gerti Rubensohn wählte am 21. August 1942 den Freitod, gewiss um der Deportation zuvor zu kommen255.
Am 17. August war gerade ein Transport mit 1.000 Personen nach Theresienstadt abgegangen. Die Eheleute wurden am 27. August auf dem Jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee beigesetzt.
255Erich Rubensohn rezitierte in seinem Brief an Adolf Hitler: ´Solang' ein edler Biedermann mit einem Glied sein Brot verdienen kann, so lange schäm' er sich, nach Gnadenbrot zu
lungern! Doch tut ihm endlich keins mehr gut: So hab' er Stolz genug und Mut, sich aus der Welt hinaus zu hungern.´ Dazu kam es tatsächlich im Jahr 1942, als Erich und Gerti Rubensohn in Pankow den Freitod wählten
(vermutlich Veronalvergiftung. wie in vielen Fällen).”
|
|
2012
|
Gubitz, Friedrich Wilhelm. In: Erlebnisse aus Romantik und Biedermeier, Jazzybee Verlag. Digitalisiert von Google
“[o. S.] Durch seinen sehr
angreifenden Husten erkrankte Chamisso in bedenklicher Steigerung seit 1831, während dessen Zeitraum er schon nach irgendeiner Herzenseröffnung mehreren Briefchen den Seufzer einschob: ´Mög' es Dir besser ergehen
als Deinem alten Freunde!´ Von Zeit zu Zeit stärkten sich die Kräfte wieder, er beschäftigte sich dann mit der Herausgabe seiner Schriften, und am 27. April 1836 schrieb er mir zu der bezeichneten Beilage: ´Hier,
mein teurer Freund, ein Exemplar von meinen unsterblichen Werken, damit Du sie immer bei der Hand haben magst. - Ignisco! Ich habe immer nicht geglaubt, daß man dem Inhaber einer Buchhandlung ein Buch schenken
kann!´ Im Dezember desselben Jahres empfing ich die Mahnung:
´Bist untreu, Gubitz, oder tot,
Wielange willst Du säumen?´”
|
|
2013
|
Berghahn, Klaus L. Rezension "Rufmord klassisch" In: Monatshefte, Volume 105, Number 1, Spring 2013, University of Wisconsin (USA)
“Im Jahre 1791 rezensierte Friedrich Schiller in der Jenaer Allgemeinen Literatur-Zeitung die erweiterte, zweite Auflage von Gottfried August Bürgers Gedichten (1789) anonym und
vernichtend. Für Klaus Damert ist diese Rezension ein klassischer Rufmord. Sie bildet daher auch das Zentrum seines Buches. Schillers Urteil wurde zur Richtschnur für die Beurteilung der Lyrik Bürgers, von Gundolfs
abfälligem Urteil über den „Plebejer con amore“ bis zu zahlreichen Wiederholungen in den jüngsten Literaturgeschichten.
Schiller Rezension ist nicht nur eine Kritik der populären Lyrik Bürgers
sondern vor allem eine kulturkritische Kontroverse über Volkstümlichkeit. Für den „Volksdichter“ Bürger, wie er sich selbst nannte, ist Volkstümlichkeit „die Achse, woherum meine ganze Poetik sich dreht.“ Oder noch
programmatischer: „Alle Poesie soll volksmäßig sein, denn das ist das Siegel ihrer Vollkommenheit.“ Dieses theorieferne „Glaubensbekenntnis“ machte es Schiller leicht, ihn zu kritisieren. Denn Schiller beurteilte
die Situation des literarischen Marktes skeptischer und realistischer. Bürgers Vorstellung vom Volk als einer kulturellen Einheit entsprach nicht mehr der von Schiller erkannten Desintegration des Publikums in eine
gebildete Elite und einen „großen Haufen,“ der nicht einmal lesen konnte. Schiller wollte diesen Kulturunterschied durch große Kunst „aufheben“ um durch eine ästhetische Erziehung die unteren Schichten „scherzend
und spielend zu sich hinaufzuziehen.“ Gemessen an diesem Kunstideal, das sich im Gegensatz zu Bürger nicht am Geschmack des Volkes orientiert sondern an der literarischen Elite, konnten Bürgers Gedichte und seine
Vorstellung von Volkstümlichkeit nicht bestehen. Nimmt man hinzu, dass Schiller sich nicht scheute, moralisiernd auch noch auf Bürgers unglückliche Liebesbeziehungen anzuspielen, wie er sie in den Molly-Gedichten
wahrnahm, so ist seine Rezension, allen wichtigen kulturkritischen Einsichten zum Trotz, vernichtend. Überraschenderweise schadete Schillers Rezension dem Nachruhm Bürgers wenig.
Im Grunde ist
Damerts Buch eine reich dokumentierte Rezeptionsgeschichte zu Bürgers Poesie und Popularität. Sie beginnt mit der Wirkung von Bürgers berühmtester Ballade „Lenore“ und widmet dem „vergessenen Volksdichter“ ein
eigenes Kapitel, in dem Damert auch den „radikalen Demokraten“ würdigt. Kapitel zu Bürgers Humor und seiner Liebeslyrik runden das Buch ab.
Damert lässt andere ausführlich für sich sprechen und
kommentiert dann kurz die langen Zitate. Der Leser wird mit Zitaten reich bedient, aber dieser Reichtum an Dokumentation ist zugleich ein Mangel des Buches, das die These vom klassischen Rufmord an Bürger zwar
erschöpfend belegt, aber sie zu wenig literaturhistorisch und kritisch analysiert. Doch statt dem Autodidakten dies vorzuhalten oder sich nochmals wie Schiller auf das hohe Ross der Ästhetik und Literaturkritik zu
schwingen, muss man lobend anerkennen: Damert hat wie ein kluger Museumsdirektor alles zusammengetragen, was Bürgers Lyrik und die Bürger-Schiller-Kontroverse erhellen kann: also ihre Erstrezeption, vor allem unter
den deutschen Dichtern, Zeugnisse der Literaturkritik aus dem 19. Jahrhundert und Urteile von Literaturhistorikern. Er scheute auch nicht davor zurück, Bürgers berühmteste Balladen und Gedichte nachzudrucken, was
die Lektüre des Buches auflockert und es auch leserfreundlich macht. Und schließlich reproduzierte er neben zahlreichen zeitgenössischen Illustrationen zwölf wenig bekannte Lithographien von Lovis Corinth zu Bürgers
„Die Königin von Golkonde.“ Das alles macht dieses Buch zu einem Kompendium für Liebhaber von Bürgers Lyrik, die es immer noch geben soll, geschrieben von einem Liebhaber, der kenntnisreich und verständnisvoll an
Bürger erinnert. “
|
|
2013
|
Röhl, John C. G. Der anachronistische Autokrat (1888-1900). In: Wilhelm II. München. Digitalisiert von Google
“[S. 32] Seiner geradezu schwindelerregenden Vorstellung von seiner Rolle als Kaiser und König zufolge war er [Wilhelm II.] der Mittler zwischen Gott und seinem Volke: Er empfange von
Gott seine Weisungen und sei in seiner ´Gottesgebundenheit´ verpflichtet, die göttlichen Ratschlüsse gegen jedwede Kritik auszuführen. Allen Ernstes behauptete er, gekrönte Häupter wie er hätten die angeborene Gabe
des Hellsehens, die allen normalsterblichen Staatsmännern abging. Ein Monarch, der sich von der Verfassung oder vom Parlament einschränken ließ, verdiene nur Verachtung. ´Ich bin gewohnt, daß mir gehorcht wird´,
verkündete er 1890 kurz vor der Entlassung Bismarcks. ´Ein Kaiserwort soll man nicht drehen oder deuteln.´ “
|
|
2013
|
Gercke, Doris. Kein fremder Land, Hoffmann und Campe
“[o. S.] Ein freies Volk in freien Grenzen, sagte Schlee neben ihm. Ich finde, sie
hätten etwas mehr Wert auf das Wort Demokratie legen sollen. Nach meiner Meinung ist doch der Kern der neuen Entwicklung das demokratische Moment, Einfach genial, dieses Gerede über Faschismus und Sozialismus zu
beenden. Wie lange hat das Ansehen unseres Volkes in der Welt unter diesen Ungeheuern gelitten? Ist dir aufgefallen, daß die Wörter im deutschen Sprachschatz nicht mehr vorkommen? Demokratie, mein Lieber, ordnende
Demokratie, das ist es, was wir Deutschen der Welt zu schenken haben. Freiheit durch Ordnung.
Hartmanns Gesicht blieb skeptisch, während er dem älteren Kollegen die Tür aufhielt. Als ihnen die
Krankenhausluft entgegenschlug, fiel beiden gleichzeitig ein, daß sie kein Wort über den Ablauf des Programms miteinander gewechselt hatten.
Wie üblich? fragte Hartmann.
Schlee
nickte, und Hartmann begann, sich die ersten Worte der Ballade ins Gedächtnis zu rufen, die er zu Beginn jeder Lesung vorzutragen sich angewöhnt hatte.
Lenore
Lenore fuhr ums Morgenrot
empor aus schweren Träumen.
´Bist untreu, Wilhelm, oder tot?
Wie lange willst du säumen?´”
|
|
2013
|
Groeben, Christiane (Hg.). duBois-Reymond an Dohrn, 15. Oct.'80. In: Emil du Bois-Reymond (1818–1896) Anton Dohrn (1840–1909): Briefwechsel. Digitalisiert von Google
“[S. 197] Freund Petersen's Photo's haben uns lebhafte Sehnsuchtsseufzer entlockt. Gott sei dank daß Peru und Chile jetzt ihren harten Sinn erweichten, und endlich Friede machten. Bis jetzt
freilich ist der Chile-Dollar noch immer nicht viel mehr als die Hälfte werth.”
|
|
2013
|
Raddatz, Fritz J. Der falsche Feind - Plädoyer für Rolf Hochhuth. In: Stahlstiche: 33 Einreden aus 35 Jahren
“ Wieder eine Nacht herabgestiegen
Auf das alte, ew'ge Erdenrund,
Wieder eine Finsternis geworden
In dem qualmerfüllten Kerkerschlund.
Nun sind das aber Zeilen von Georg Büchner, und der ist zum Staatspreisdichter glattgehobelt, wenngleich kürzlich in einem glanzvollen Essay von Christoph
Hein (sehr richtig) als ´Mitglied einer terroristischen Vereinigung´ charakterisiert: In Wahrheit sind die knappen Zeilen die Summe des politischen Menschenbildes von Büchner, von dem Friedrich Dürrenmatt sagte, ´er
sah den Menschen an sich selbst scheitern - überzeugt vom gräßlichen Fatalismus der Geschichte´. Abgelehnt. Abgelehnt würde dann, konsequenterweise, auch Majakowskis ´Vorwärts, Genosse Mauser´ (es war, beiläufig,
ebendiese Mauser, mit der der Dichter sich umbrachte), ein Autor, den sogar der Antipode Benn schätzte. Abgelehnt werden müßte dann gewiß auch Gottfried August Bürgers berühmte Schmetter-Zeile gegen das
Gotteskönigtum ´Du nicht von Gott, Tyrann!´ wie arg vieles von Ezra Pound oder dem, dessen Name bereits Imperativ ist: Brecht.
Einem Kanon verweigerte sich jeder von diesen. In seinem
soeben erschienenen furiosen Essay-Buch ´Die Intrige´ stellt Peter von Matt die zentrale Frage: ´Wer bestimmt eigentlich, was in einem literarischen Werk gut und schlecht ist?´ - und gibt eine Antwort, die schnelle
Urteile ausschließt.”
|
|
2013
|
Lentz, Michael. Exemplum Schiller. In: Atmen Ordnung Atmen - Frankfurter Poetikvorlesungen.
“Noch
Friedrich Schiller wusste von den idealischen Vorzügen gegensätzlicher Affektdisposition zwischen dichterischem Subjekt und objektiver poiesis ein Lied zu singen. In seiner vernichtenden Rezension von Gottfried
August Bürgers Gedichten warnt er den Dichter davor, ´mitten im Schmerz den Schmerz zu besingen´. Seine Begründung richtet das rhetorische Angemessenheits-Prinzip am ästhetisch-philosophophischen Begriff des
´Idealschönen´ aus, verliert also das Regulativ der Rhetorik nicht aus dem Blick: ´So, wie der Dichter selbst bloß ein leidender Teil ist, muß seine Empfindung unausbleiblich von ihrer idealischen Allgemeinheit zu
einer unvollkommenen Individualität herabsinken.´ Dann führt Schiller das Kriterium der zeitlichen Distanz ein, die den Affekt mildert, den Dichter als Wissenden aber stärkt: ´Aus der sanftern und fernenden
Erinnerung mag er dichten, und desto besser für ihn, je mehr er an sich erfahren hat, was er besingt; aber ja niemals unter der gegenwärtigen Herrschaft des Affekts, den er uns schön versinnlichen soll.´ Das
Postulat der Distanz soll Schiller zufolge auch vor dem Subjekt nicht haltmachen, das so zu seinem eigenen, sich entfernenden Beobachter wird: ´Selbst in Gedichten, von denen man zu sagen pflegt, daß die Liebe, die
Freundschaft u.s.w. selbst dem Dichter den Pinsel dabei geführt habe, hatte er damit anfangen müssen, sich selbst fremd zu werden, den Gegenstand seiner Begeisterung von seiner Individualität los zu wickeln, seine
Leidenschaft aus einer mildernden Ferne anzuschauen.´ In der rhetorischen Anthropologie ist die Vermittlung von natura als Anlage oder Talent (ingenium) oder ars als Kunstlehre (techne)
ein Kernmoment rhetorischer Pädagogik. In diesem Sinne zeigt sich auch Schiller als Pädagoge, der auf eine Vermittlung von Rhetorik, Ästhetik und Philosophie im Begriff des Idealschönen zielt, das einer ungezügelten
Affektpoetik unter der Maßgabe eines autopoetischen freien Geistes gegensteuert: ´Das Idealschöne wird schlechterdings nur durch eine Freiheit des Geistes, durch eine Selbsttätigkeit möglich, welche die Übermacht
der Leidenschaft aufhebt.´
Schillers Maxime veranlasste mich, den Prosatext Muttersterben so lange umzuarbeiten, bis er endlich eine Gestalt angenommen hatte, die primäre Affekte hinter eine eigene chronotopische Ordnung und Dynamik zurückdrängte: Schreiben mit kalter Leidenschaft.
Und tatsächlich: Es kommt nur in seltenen Momenten vor, dass ich nicht das Gefühl habe, es wirke im Hintergrund des Schreibens ein Regulativ, das manche Sätze verhindert und manche andere leider
nicht. Dieses imaginäre Regulativ hat einen starken Assistenten, der die Sätze im Prozess ihres Entstehens abtastet und evtl. korrigiert: die Thetorik - insbesondere mit ihren drei Stationen der inventio, dispositio und elocutio.
Es ist bedauerlich, dass ich nicht alle rhetorischen Termini auswendig kann. Was würde das andererseits in einem Gespräch nutzen? Ergäbe es Sinn, zu sagen: ´Entschuldigen Sie, Sie haben soeben klipp und klar ein
Hendiadyoin verwendet´ oder ´Ihr Anakoluth sitzt da nicht ganz richtig´? Das hätte wohl genauso viel Erkenntniswert wie Karl Valentins analytisch ins Leere laufende Rede: ´Die Gesellschaft im Eisenbahnwagen war sehr
gemischt; es waren fast lauter Reisende, nur der eine Herr, der in München den Zug versäumte, fuhr nicht mit.´”
|
|
2014
|
Bürger-Aufsatz steht nun online. In: Mitteldeutsche Zeitung, 11. Dezember 2013 in Regionalausgabe ELN/HET; am 20.01.2014 im MZ-Online-Angebot
“MOLMERSWENDE/MZ.
Er ist in keiner Werksausgabe zu finden - der Aufsatz ´Über die ästhetische Sittlichkeit´ von Gottfried August Bürger, der im Jahre 1747 in Molmerswende geboren wurde. Jetzt ist der Aufsatz neben vielen anderen
Werken in der Online-Bibliothek des Bürger-Archivs für jedermann zugänglich.Das bisher unbeachtete Werk veröffentlichte Karl von Reinhard, der erste Herausgeber einer Bürger-Gesamtausgabe, 1833 in der Zeitschrift
´Gesellschafter´ mit der Bemerkung, dass es in den bisherigen Werkausgaben fehle. ´Das hat sich bis heute nicht geändert´, sagt Klaus Damert, Bürger-Experte aus Molmerswende. Allerdings entspreche dies durchaus dem
Umgang der Germanistik mit dem populären deutschen Dichter des 18. und 19. Jahrhunderts. Man beschäftigte sich lieber mit Bürgers angeblich unmoralischem, nicht geläuterten Leben, als mit seinen unglaublich
populären Werken, so Damert. Zudem hätten den Herrschenden Bürgers politische Gedichte nicht behagt, seine Freimaurerrede ´Aufmunterung zur Freiheit´ sei von geradezu beklemmender Aktualität. Die Entdeckung des
Aufsatzes könne für das Land Anlass sein, einen Blick auf das vernachlässigte Geburtshaus in Molmerswende zu werfen.”
|
|
2014
|
Engelhardt, Manfred. Fünf Augsburger und Forelle im Fluss - zwei große Quintette. In: Augsburger Allgemeine, 19. Februar
“Unter dem Namen
´Hummorella´ traten fünf renommierte Augsburger Musiker bei S-Live im Foyer der Puppenkiste auf den Plan. Diesmal war ein klassisch-romantisches Programm angesagt. Es entschlüsselte die Ad-hoc-Bezeichnung des
Ensembles: Gespielt wurden Klavierquintette von Johann Nepomuk Hummel und Schubert („Forellenquintett“). Der Humor kam auch nicht zu kurz, weil Marie Tremblay-Schmalhofer als ´Überraschungsgast´ Georg Gersons
Vertonung von Gottfried August Bürgers ´Hummellied´ einschob – der dänische Romantiker (1790–1825) machte zu den hitzig-erotischen Blütensauger-Honig-Strophen musikalische Anspielungen auf das ebenso quicke
´Forellenquintett´ von Schubert.”
|
|
2014
|
Kluge, Alexander. Geisterhafte Himmelserscheinung über dem Brocken. In: 30. April 1945: Der Tag, an dem Hitler sich erschoß und die Westbindung der Deutschen begann, Suhrkamp Verlag
“[o. S.] Schleef hatte die Klavierlehrerin so verstanden: Hexen, mißbrauchte Frauen aus ganz Europa, die komplette Geisterschar haben den Propagandaspruch wörtlich genommen,
sich als letztes Aufgebot verstanden und sich zum Vernichtungssturm formiert. In Schleefs Skizze heißt es: Eine Vergeltungslust ergriff sie, die zwischen den fliehenden Kolonnen deutscher Truppen, den Panzern der
Roten Armee, den vorstoßenden Westalliierten, also nach Vaterländern, keine Unterschiede machten. Dieser Sturmwind vernichtete für einige Stunden alles, was ihm gegenüberstand. Die Verluste durch diese Explosion
aller UNGERECHT VERBRANNTEN DIESER ERDE sind in keiner Liste der miteinander kriegführenden Mächte angemessen aufgeführt, meinte Schleef.
Schleefs Skizze schließt mit dem letzten der sieben
Bewegtchöre: einer videogestützten Musik mit der Bezeichnung: »Leuchtendes Sturm- und Gewittergewölk«, vom Chor gesummt. Das symphonische Gemurmel und Geächz geht über in das populäre Lied: »Leonore fuhr ums
Morgenrot, und als sie rum war, war sie tot«. Schleef nannte den neuen Revue-Entwurf TRAUERODE FÜR CHOR UND MUSIK. Seiner Auffassung nach war das Werk dafür bestimmt, den Schlußsatz der Neunten Symphonie als
Offizialmusik bei feierlichen Anlässen in Europa künftig zu ersetzen, da Beethovens respektables Werk »ungeeignet ist, die Vision der Sangerhauser Klavierlehrerin wiederzugeben, die Fräulein Bülow hieß«.”
|
|
2015
|
Agthe, Kai. Kranker Uhu stutzt den Vogel. Klaus Damert verteidigt Gottfried August Bürger gegen die Kritik Friedrich Schillers. In: Mitteldeutsche Zeitung, 25./26. April 2015
“Hätte Gottfried August Bürger (1747-1794) geahnt, dass die Abenteuer des Baron Münchhausen ein Klassiker werden würden, er hätte das Buch wohl nicht anonym veröffentlicht. Seit mehr
als 200 Jahren reitet der Lügenbaron auf der Kanonenkugel und seinem halben Pferd, dennoch ist kaum bekannt, dass der aus Molmerswende (Mansfeld-Südharz) stammende Autor der Verfasser ist. Zu allem Überfluss soll
Bürger das Manuskript seinem Verleger geschenkt haben. Unter anderen Umständen wäre er heute der angesehene Münchhausen-Autor und so berühmt wie Schiller. Dessen Name fällt nicht von ungefähr: Denn der junge,
streitlustige Schiller war es, der mit einer überzogenen Kritik von Bürgers Gedichten dem Autor nachhaltig schadete. In der Rezension ´Über Bürgers Gedichte´ (1791) wirft der ungestüme Schwabe Bürger vor, er sei
kein Dichter, weil er nicht idealisiere. Besonders anstößig findet Schiller die Maxime des zwölf Jahre Älteren, derzufolge die ´Popularität eines Gedichts das Siegel seiner Vollkommenheit´ sei. Schiller
beließ es jedoch nicht bei ästhetischer Kritik, sondern wurde auch persönlich: So bezeichnete er Bürger als ungebildet und unreif. Generationen von Germanisten übernahmen Schillers Generalverriss ungeprüft und
sorgten dafür, dass Bürger einen Platz in der Schmuddelecke der deutschen Literaturgeschichte erhielt. ´Gegen den göttlichen Schiller konnte der sterbliche Bürger nicht bestehen´, schreibt Klaus Damert in seiner
Studie ´Gottfried August Bürger, Schiller und der kranke Uhu´. Schillers Rezension zum Ausgang nehmend, kann der in Molmerswende lebende Autor ebenso faktenreich wie spannend darlegen, dass Bürger ein bedeutender
Autor ist und seine Dichtungen vom Publikum viel intensiver gewürdigt wurden als es die Literaturhistoriker auf ihrem Feldherrenhügel wahrhaben wollten. Bürger reagierte seinerzeit auf Schillers verkappte Rezension
von 1791 mit einer ´Antikritik´, der Schiller wiederum eine anonym erschienene ´Anti-Antikritik´ folgen ließ. Zuletzt rettete sich Bürger mit dem Gedicht ´Der Vogel Urselbst, seine Rezensenten und der Genius´ (1793)
ins Parodistische. Der Vogel Urselbst, das ist Bürger, der sich gefallen lassen muss, von einem ´kranken Uhu´, also Schiller, zurechtgestutzt zu werden. So ruft der komische Kauz dem armen Vogel Urselbst zu:
´Es fliegt im dritten Himmelssaal
Ein Vogel namens: Ideal.
Mit dessen Federn rüste dich,
Sonst fliegst du ewig schlecht für mich.´
Doch mit Witz war Schiller nicht beizukommen: Bürgers literarischer Ruf war dauerhaft ruiniert. Klaus Damerts vorzügliche Streitschrift für Bürger lesend, wird einmal mehr deutlich, weshalb Nietzsche Schiller den
´Moraltrompeter von Säckingen´ zu nennen pflegte.”
Faksimile der Rezension in der ONLINE-BIBLIOTHEK
|
|
2015
|
EZ. Schwabenstreich. In: DIE ZEIT, 30. Juli

|
|
2015
|
Rothe, Hans. Christian Lach-Szyrma. In: Gottfried Ernst Groddeck und seine Korrespondenten
“[o. S.] Im Ganzen ging Lach nach einem eindrucksvollen
Lehrplan vor: im Lateinischen Seneca, Cicero, Plinius, Cornelius Nepos und Horaz; im Griechischen Platon, Xenophon, Euripides, Sophokles, Demosthenes; in deutscher Literatur Goethe, Schiller, Wieland, Gerstenberg
und Bürger.
Dieser letzte scheint nicht ganz zu dem Kanon der Weimarer Klassik zu passen. Bürger gehörte noch zum deutschen Sturm und Drang. Aber er hatte auch zu dem ´großbritannischen´ Göttingen
gehört; die Spur führt auch hier auf Groddeck, und bezeugt auch die moderne Richtung in der Literatur, abgewandt vom konventionellen Klassizismus, wie er in Warschau und auch im russischen Petersburg immer noch
herrschte. Dadurch führte Lach seinen Zögling an eine moderne Auffassung von schöner Literatur heran, die damals in Moskau die junge Generation der Russen schon ergriffen hatte, und die, wie in Göttingen, auch an
den neuen Universitäten des Kaiserreiches, in Wilna und Dorpat Eingang fand. In Moskau gab es zu eben dieser Zeit eine heftige Auseinandersetzung eben über Bürgers Lenore. Lach beteiligte sich gewissennaßen daran,
als er die Ballade Bürgers ins Polnische übersetzte und sie mit einem erklärenden Aufsatz 1819 im Pamienik Naukowy veröffentlichte, der nun auch in Warschau ein neues Literaturverständnis zu Gehör brachte.”
|
|
2015
|
Schübler, Walter. Temperamentvoll in allen Registern. Rezension Gottfried August Bürger: Briefwechsel, Bd. 1: 1760- 1776. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 07.08.2015, Nr. 181, S. 10
“[...] Warum ist Bürger heute vergessen? - Schiller hat ihn 1791, wie Caroline Böhmer sich entsetzte, "um alle menschliche Ehre recennsirt". Bürger hatte das
Pech, als Bannerträger seiner "Göttin Popularität" demonstrativ zum Gegenbild der Weimarer Klassik gemacht zu werden. Schillers ehrenrühriges Urteil, das mit dem Werk den "liederlichen" Dichter
abqualifizierte, dem es an "sittlicher Maßbeschränkung" mangele, doppelte Goethe noch nach: Bürger sei in der noblen République des lettres nicht gesellschaftsfähig.
[...]
Als nicht
salonfähig wurde der Privatdozent - ab 1784 unterrichtete Bürger an der Georgia Augusta Poetik und Ästhetik - auch von der akademischen Kollegenschaft taxiert. Unerhört, dass er sich zudem unverhohlen zur
Französischen Revolution bekannte! Zu Lebzeiten trug ihm diese Haltung soziale Ächtung ein - auch Lichtenberg, der ihn gut leiden mochte, rückte von ihm ab -, postum verlieh ihm Heinrich Heine dafür einen
Ehrentitel: "Der Name Bürger ist im Deutschen gleichbedeutend mit dem Worte citoyen."
[...]
Wenn er Freunden gegenüber ruhmredig seine jüngsten "poetischen Pollutionen"
überschwänglich preist; wenn er seinem Verleger, der leise Zweifel am Wert seiner Geisteskinder angemeldet hat, den Kopf wäscht; wenn er über das gänzliche Versiegen seiner "poetischen Ader" lamentiert,
wenn er es sich erbost verbittet, als "nicht unglücklicher Nachahmer von Jacobi" gelobt zu werden; wenn er, selbst berüchtigt saumselig, aber auf die Anregung und Aufmunterung von Freunden, auf den
mündlichen Gedankenaustausch angewiesen wie auf einen Bissen Brot, sich bitter über ausbleibende Briefe beklagt; wenn er über dem amtlichen Papierkram verzagt, der ihm sein "bischen Dichterlaune" verdirbt;
wenn er schmollend auf seine "poetische Glorie" pfeift - "Die Musen mögen mich samt und sonders gar Creüzweise im A.,.lecken" -, die ihn ja doch nicht glücklich mache, dann ist das je für sich
ungemein bewegend und im Gesamten ein - über die Jahrhunderte hinweg - unmittelbar und zutiefst anrührendes menschliches Zeugnis.”
|
|
2015
|
Mansfeld, Hasso. Essen, Schlafen, Sex. In: The European, Das Debatten-Magazin, 13.03.
“Ich-Schwäche, Voyeurismus, Gehässigkeit
Mir
bereitet diese Entwicklung Sorge. Dass kulturelle Formate entstehen, die eher an unsere niederen Instinkte appellieren, die eher zerstreuen und emotional bewegen wollen, als anzuregen oder aufzuklären, ist normal.
Das hat es immer gegeben und ist vielleicht sogar notwendig. Einer der meistgelesenen Dichter zu Zeiten Goethes und Schillers war der heute fast vergessene Gottfried August Bürger, seinerzeit ein enorm erfolgreicher
Verfasser eher leichterer Lektüre. Aber dass sich ein so überwältigender Anteil der Unterhaltungsproduktionen nicht einfach dem leichten, dem Konsumierbaren widmet, sondern vor allem das Bedürfnis bedient, sich an
der Erbärmlichkeit des Lebens anderer Menschen selbst aufzubauen, das Bedürfnis sich aggressiv abzugrenzen und auf den Mitmenschen herabzusehen, das ist neu. Und es verheißt nichts Gutes. Denn diese Bedienung eines
unreflektierten Abgrenzungsbedürfnisses haben so unterschiedliche Shows wie „Big Brother“ und „Berlin – Tag & Nacht“ gemein. Der Voyeurismus, den sie ansprechen, ist nicht mehr der sexuelle Hans Castorps, der
gern hinter das weibliche Geheimnis der feinen Gaze kommen würde. Es ist nicht mehr die übersteigerte Neugier darauf, wie meine Mitmenschen eigentlich leben. Es ist die Gehässigkeit dessen, der sich versichert: ´So
weit immerhin ist es mit mir noch nicht gekommen.´“
|
|
2015
|
Karasek, Hellmuth. Rettende Weiberlist. In: Hamburger Abendblatt, 27.06.
“Hellmuth Karasek: Rettende Weiberlist
Dem Lokomotivführerstreik
verdanke ich es, dass ich jüngst, auf einer Reise durch Schwaben, mit dem Auto an der Stadt Weinsberg mit ihrer Burgruine ´Weibertreu´ vorbeifuhr. [...] In meinem Kinderbuch ist zu sehen, wie die Frauen ihre
Männer huckepack aus der Stadt tragen. Samt Helmen und Schwertern. Die Sage heißt ´Die Weiber von Weinsberg´, Weib, das war damals noch kein abschätziges Wort, sondern benannte wie das englische ´wife´ noch heute
die Herrin von Haus und Hof. Es ereignete sich also im finsteren Mittelalter, dass die Herzogin Jutta ihren Gemahl Welf vom Berg herab rucksackte und alle Damen ihrem Beispiel folgten. Dem Kaiser gefiel diese
Weiberlist, und er sagte: ´Versprochen ist versprochen!´
Der Balladendichter Gottfried August Bürger, Zeitgenosse Goethes und Schillers, reimte über diesen Akt fraulicher Entschlossenheit und Emanzipation mit
viel Sarkasmus, wie der Herrgott in die besiegte Stadt hineintrompetete und den Männern prophezeite: ´Ihr Schurken, komm ich 'nein, so wisst / Soll hängen, was die Wand bepisst.´ Hier wird also zum ersten Mal ein
Mann als Stehpinkler verhöhnt. Die Frauen retteten sie dennoch – trotz aller hygienisch-feministischer Bedenken.”
|
|
2015
|
Eberhard Köstler, Stuttgarter Antiquariatsmesse
Album amicorum des Gütersloher Pastors Christian Ludwig Schlüter. Halle, Gütersloh u.a.,
1763–1772. Mit 1 kolor. Tuschzeichnung. 65 Bl. mit Eintragungen auf zusammen ca. 125 Bl. Ldr. d. Zt. mit reicher Goldprägung, Bordüren und Monogramm „C. L. S.“, Goldschnitt (etwas bestoßen).
“Stammbuch aus Halle mit zwei der frühesten und äußerst seltenen handschriftlichen Zeugnisse G. A. Bürgers (1747–1794). Die Briefausgabe von Joost/Wargenau kennt nur einen früheren Beleg, datiert
Halle 1760, dann erst wieder zwei Albumblätter aus Halle 1765, jedoch nicht den hier vorliegenden Eintrag. Der nächste laut Joost/Wargenau bekannte Beleg ist ein Stammbuchblatt, datiert Halle 23. IV. 1766, auf
dessen Rückseite sich der Halter des vorliegenden Albums verewigt hat: „C. L. Schlüter studioso in Theologia della Vestphalia“. Bürger, der bis 1768 in Halle studierte und dann an die Universität zu Göttingen ging,
war demnach ein Freund und Kommilitone C. L. Schlüters (1746–1826), der später als Pfarrer in Gütersloh und wichtiger Verbreiter des Pietismus wirkte. – Bürgers Einträge in Schlüters Stammbuch sind zudem von
besonderem Interesse, da er ironischen Bezug auf Friedrich II. nimmt. In der Manier der Hallenser Studenten datiert mit „Saal-Athen den 11.hujo 1765“ schreibt er, ein Gedicht von C. F. Weiße zitierend: „Noch wallt
die Freud in meiner Brust / Noch hab ich viel zu leben lust / Wenn mich die Parcen nicht vertreiben / doch daß ich winselnd Abschied nähm / Wenn schon zu früh die Parce käm / das lasse ich wohl bleiben.“ Darunter
die Bitte: „Schätzbahrer Freund, hiebey erinnere dich auch in der Entfernung an deinen aufrichtigen Freund Gottfr. Aug. Bürger aus d[em] Halberstädt[ischen] d[er] G[ottesgelahrtheit] Befl[issenen]“. Darüber hinaus
hinterlässt Bürger einen zweiten Eintrag auf der Vorderseite des Blattes, ganz ähnlich wie Schlüter nur wenig später im April 1766 sich im oben erwähnten Stammbuch auf der Rückseite von Bürgers Widmung einschreibt.
Hier nun kommentiert Bürger das „Halle, le 16eme 10bre 1765“ datierte Stammbuchblatt eines „sincere Ami et Frere J. J. Kaiser de l’Alsace“, der unter dem Titel „Phil. de Sans-Souci“ nicht frei von Ironie auf
Friedrich II. verweist. Das kommentiert Bürger in französischer Sprache: „C’etoit un homme fola- | tre, qui n’avoit rien | qu’un coeur impudent | et un peu de philosophie fanatique | Dieux le convertisse“. Dieser
Kommentar ist nicht zusätzlich eigenhändig signiert, ein Vergleich von Schrift und Tinte mit dem auf der Blattrückseite befindlichen Haupteintrag G. A. Bürgers machen jedoch deutlich, dass er nur von dessen Hand
stammen kann. Zwei Drittel aller weiteren Einträge in Schlüters Album stammen von Studenten der Universität Halle.”
|
|
2015
|
Behrendt, Leni. Staffel 3 - Liebesroman
"[o. S.] ´Ach, sieh mal an.´ Er kniff die Augen zusammen und
besah sie sich angelegentlichst. ´Bisher hast du dich im Kreis der Klatschbasen doch immer so wohl gefühlt? Hast sogar eifrig mitgetan, wenn man an einem armen Opfer die Zunge wetzte. Nun, da du selbst jedoch so ein
armes Opfer bist, begehrst du auf. Vielleicht wirst du dir jetzt des wahren Sprichwortes bewußt: Es sind die schlechtesten Früchte nicht, woran die Wespen nagen.´
´Manchmal sind es sogar schon
Hornissen!´ regte lnga ihr flinkes Zünglein, was ihr diesmal schlecht bekam. Denn schon saß ihr eine Hand im Gesicht.”
|
|
2016
|
Radioprogramm MDR KULTUR – Das Radio – 31. Woche vom 30.07. bis 05.08.2016
“18:00 Wunderbare Reisen zu Lande, zu Wasser und durch die Luft (60 Min.)
MDR KULTUR – Hörspiel, Krimi und Feature
Hörspiel / Feature / Krimi
Von Gottfried August Bürger
Er hat wirklich gelebt, der Junker Baron Hieronymus Carl-Friedrich von Münchhausen, das ist keine
Mär. Von 1720 bis 1797. Und er hat auch wirklich als Soldat in Russland gedient und wahrscheinlich auch am Türkenkrieg teilgenommen und er war ein leidenschaftlicher Jäger. Von Münchhausen wird berichtet, er habe am
abendlichen Kaminfeuer beim Wein Großmäuler und Möchtegerne, die faustdicke Lügen als Wahrheit auszugeben versuchten, durch sein lebhaftes Erzählen und seine fantasiereichen Lügengeschichten spöttisch übertrumpft
und parodiert. Diese Geschichten dürfte er zum größten Teil nicht selber erfunden haben. Die meisten waren bereits aufgeschrieben: in Schwanksammlungen, in überlieferten Texten aus der griechisch-römischen Antike,
in walisischen Prosaromanen des 13. Jahrhunderts, in Heiligenlegenden und natürlich vor allem in den Märchen, die man weitererzählte, ohne dass jemand nach ihrem Ursprung gefragt hätte.
Die Lügengeschichten
des Baron von Münchhausen wurden 1781 in dem Berliner Anekdoten- und Witzblatt "Vade Mecum für lustige Leute" veröffentlicht. Dort entdeckte sie Rudolf Erich Raspe, der ihnen noch ein paar Geschichten aus
verschiedenen alten Büchern hinzufügte und alles in seinem Büchlein in England veröffentlichte. Raspe verfolgte mit seinem "Münchhausen" die Absicht, Lügner und Prahlhälse, ja sogar gewisse Schreier im
englischen Parlament auf ironische Weise zur Wahrheit zu erziehen.
Raspes Büchlein fiel dem deutschen Dichter Gottfried August Bürger in die Hände, der es ins Deutsche übertrug, wobei er mit dem englischen
Text recht frei umsprang, manche satirische Anspielung auf deutsche Verhältnisse einfließen ließ, die Sammlung um acht Geschichten erweiterte, die er ebenfalls alten Schriften entnahm und nachdichtete und das Buch
unter dem Titel "Wunderbare Reisen des Freiherrn von Münchhausen", ohne seinen Namen zu nennen, herausgab.
Das Hörspiel versammelt eine Auswahl der schönsten dieser unmöglichen Abenteuer, Märchen
und phantasiereichen Geschichten, darunter einige, die Bürger hinzugeschrieben hat, so der Entenfang mit Speck, der Ritt auf der Kanonenkugel, Münchhausens Abenteuer mit den fünf brauchbaren Subjekten, die Wette
zwischen Münchhausen und dem türkischen Großsultan sowie die Taten der hinteren Hengsthälfte. (Dieter Wardetzky)
Regie: Dieter Wardetzky
Bearbeitung: Dieter Wardetzky; Dieter Wardetzky
Komponist: Gerhard Rosenfeld
Musikalische Leitung: Gerhard Rosenfeld
Produktion: LITERA 1984
Sprecher: Kurt Böwe – Münchhausen
Walter Wickenhauser – 1. Gast
Andreas Dölling – 2. Gast
Joachim Konrad – 3. Gast
Dieter Schaarschmidt – 4. Gast
Solisten: Otto Rühlemann”
|
|
2016
|
Anonym. Ernstes und Humorvolles. Kammerschauspieler Hermann Burck stellte Ernstes und Humorvolles aus großen Werken der deutschen Literatur vor. In: Blick Aktuell, Sinzig
“Literaturwissenschaftlich betrachtet vereint die Ballade grundlegende Merkmale der Gattungen Dramatik, Epik und Lyrik. Spricht man heute von Balladen, so werden darunter die
Kunstballaden des 18., 19. und 20. Jahrhunderts verstanden.
Die Verfasser der sogenannten Volksballaden waren in der Regel unbekannt. Ab dem 18. Jahrhundert widmeten sich dann namhafte Schriftsteller der
Balladendichtung. Die Form der Kunstballade begann unter anderem mit Gottfried August Bürger und Johann Gottfried Herder. Sie errang jedoch einen besonderen Bekanntheitsgrad in dem von Johann Wolfgang von Goethe und
Friedrich Schiller im Jahr 1797 geprägten „Balladenjahr“, in dem innerhalb weniger Monate viele ihrer bekannten Balladen, wie zum Beispiel von Goethe: „Die Legende vom Hufeisen“, „Der Zauberlehrling“ oder „Der
Schatzgräber“ und von Schiller: „Der Ring des Polykrates“, „Der Handschuh“ oder „Die Bürgschaft“ entstanden.”
|
|
2016
|
Trommer, Ralph. „Münchhausen – Die Wahrheit übers Lügen“ Eine Therapie für den Lügenbaron. In: Der Tagesspiegel, 18.07.2016
“Flix und Bernd Kissel schaffen mit „Münchhausen – Die Wahrheit übers Lügen“ eine moderne, eigenständige Version des Klassikers - ungelogen.
Therapeut und Patient: Freud mit Münchhausen auf der Couch in einer Szene aus dem Buch.

Ein bekanntes Bild: Münchhausen reitet auf einer Granate über die Schlachtfelder des 1. Weltkrieges und entgeht so dem sicheren Tod in den
Schützengräben. - Moment! Was sucht Münchhausen im 20. Jahrhundert? Die Erlebnisse des ´Lügenbarons` Hieronymus Carl Friedrich Freiherr
von Münchhausen, der (ungelogen!) von 1720-97 lebte, sind legendär. Aufgezeichnet wurden die haarsträubenden Geschichten – gegen den Willen
des Barons – von einigen Zeitgenossen, die viele neue Lügen dazu erfanden. Später mauserte sich der beliebte Lügenbaron zum Filmhelden, Hans
Albers verkörperte ihn 1943 in Helmut Käutners und Erich Kästners Adaption, 1988 nahm sich „Monty Python“-Mitglied Terry Gilliam seiner an.
Nun hat sich ein deutsches Comiczeichnerteam des spätbarocken Stoffs angenommen und daraus eine ganz eigene Legende gestrickt. Der bereits
mit Klassikeradaptionen wie ‘Faust’ und ‘Don Quijote’ hervorgetretene 39jährige Berliner Zeichner Flix (der auch lange für den Tagesspiegel
gearbeitet hat) hat sich für die Graphic Novel ‘Münchhausen – Die Wahrheit übers Lügen’ diesmal auf das Szenario konzentriert, sein Saarbrücker
Kollege Bernd Kissel, Jahrgang 1978 (vor allem regional bekannt durch seine Saar-Legenden-Comics) hat für die gemeinsame Idee die Zeichenarbeit übernommen.
Schön absurd ist schon die Grundkonstellation: „Rony“ Münchhausen landet 1939, am Vorabend des Zweiten Weltkriegs, per Ballon auf dem Dach
des Buckingham Palace in London. Da der ältere Herr mit der barocken Perücke deutsch spricht, aber behauptet, Adolf Hitler nicht zu kennen,
ziehen die Schergen des Secret Service einen Spezialisten zu Rate: Dr. Sigmund Freud! Der floh vor den Nazis aus Wien nach London und muss
dem schrulligen Herrn, der laut Pass Erich Bürger heißt (ein Wink auf die Münchhausen-Erzähler Rudolf Erich Raspe und Gottfried August Bürger)
nun auf den Zahn fühlen. Ist der Deutsche ein Spion, bloß ein Lügner oder steckt ein Korn Wahrheit in seinen Berichten?
Der ‘Patient’ erzählt dem Therapeuten seine Lebensgeschichte und beginnt in der Zeit des Kaiserreichs. Ein enormes Trauma wird offenbar: in seiner
Jugend verstirbt Ronys ganze Familie auf einen Schlag, und er selbst wird als deren Mörder verurteilt. An seinem Haarschopf muss er sich samt
Pferd hochziehen, um dem Gefängnis zu entkommen. Seitdem sucht Rony eine Gelegenheit, dem deutschen Kaiser seine Unschuld zu beteuern. Als
Gardist hätte er um ein Haar Erzherzog Franz Ferdinand, den Thronfolger Österreich-Ungarns, vor dem Attentat in Sarajevo retten und somit den
Ersten Weltkrieg verhindern können. Nach dem erwähnten Granatenritt gelangt er auf die utopische (und im Gegensatz zum Rest des Buches bunte!) Rückseite des Mondes… Kein leichter Fall für Dr. Freud!
Flix und Kissel benutzen bekannte Motive der Legende und erschaffen eine moderne, eigenständige Münchhausen-Version, die Witz und auch Tiefe
besitzt. Die feinen, lebendigen Tuschezeichnungen Bernd Kissels weisen dabei eine große Liebe zum Detail auf, die an manche Klassiker der frankobelgischen Comictradition erinnert.”
|
|
2016
|
Anonym. Hörbühne / Münchhausen. Kulturwerk MSH, Schauspiel, Lutherstadt Eisleben
“Im Sommer 2016 traute sich
die Hörbühne Münchhausen in einen Konkurrenzkampf mit Grillabenden oder geselligem Beisammensein auf dem Freisitz zu treten. Zu Beginn der neuen Spielzeit 2016 | 2017 lädt Baron ‘Münchhausen’ noch einmal ein, seinen
phantastischen Lügengeschichten zu lauschen.
Nun zieht die Hörbühne an einen authentischen Ort: in den Kirchgarten am Geburtshaus von Gottfried August Bürger in Molmerswende, bei Hettstedt. Er ist der
geistige Vater des Lügenbarons und hätte sicher seine Freude, wenn um 18 Uhr die Kirchenglocken die szenische Lesung seiner Geschichte einläuten und 18:03 Uhr das Spiel beginnt...
So eine kleine
Lügengeschichte ist auch ein wundervoller Zeitvertreib für ‘Die geklaute Stunde’. Zu dieser lädt der Kulturverein Armer Kasten wieder in das kultige Kaffeehaus Kolditz in Sangerhausen ein, wenn die Uhren umgetellt
und den Menschen mal wieder eine Stunde Lebenszeit geklaut wird... oder ist das alles nur geflunkert vom Herrn Baron???
Davon, dass es humorvoll auf der Bühne zugeht, kann man ausgehen, wenn Gottfried August
Bürger alias Jocosus Hilarius mit „Wunderbare Reisen zu Wasser und zu Lande. Feldzüge und lustige Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen, wie er dieselben bei der Flasche im Zirkel seiner Freunde selbst zu erzählen
pflegt" zu Worte kommt. Bürgers Erzählungen der Abenteuer des berühmten Lügenbarons gilt als die heute bekannteste Fassung dieser Geschichten, sieht man von den Verfilmungen des Stoffes ab.”
|
|
2016
|
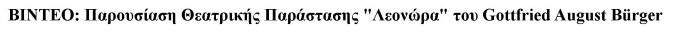

“Die Gruppe für UNESCO Argolis und Nafplion Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Kultur & Entertainment SPOTLIGHT laden
Sie ein zu einer Theateraufführung: "Leonore" von Gottfried August Bürger
6. August um 21.00 Uhr in St. George, Nafplion
In der Rolle der Leonora Schauspielerin Mrs. verunreinigen Xenopoulou
Regie: Dimitris Foinitsis
Die Show wird unter der Schirmherrschaft des Nationalrates von Griechenland Clubs und Zentren für die UNESCO statt.
Über das Projekt:
Der Gottfried August Bürger war ein deutscher Dichter, dessen Balladen waren sehr beliebt in Deutschland. Die berühmteste Ballade Titel "Leonora"
wurde 1773 geschrieben, wurde in englischer und russischer Sprache und übersetzt in Französisch angepasst. Ebenso wichtig ist die Übersetzung ins Griechische von Lorenzo Mavili.
Die Ballade, ein polyphones Leistung von einem Schauspieler und bezieht sich nur auf die Rückkehr aus dem Krieg ein toter Reiter mit ihm seine
Geliebte zu nehmen. Das Gedicht, wie die griechische Mundart - Version von "The Dead Brother" rettet die archetypische Form des romantischen
Motiv des toten Reiter, ausgebeutet, unter anderem - die "Drei" von Lena, sondern auch die "exotischen" Goethe.
Da diese Arbeit wurde Goethe inspiriert und schrieb die "Braut von Korinth", und die Walter Scott, der mit dem Titel "William und Helen" umschrieben und präsentiert.
Das Gedicht soll unbeanstandet bleiben, weil sie dramatische Kraft hat, Vitalität und bewegt sich in das Reich des Übernatürlichen.
Es ist erwähnenswert, dass der Text zuerst in Theaterform geht.”
[Ergebnis des Google Übersetzer]
|
|
2016
|
Lucka, Emil. The Evolution of Love, Sai ePublications
“There is a document from the year 1779 which contains
in its entirety the modern conception of harmonious love, together with its ecstatic apotheosis, the love-death, a document which puts the later theorising romanticists and Lucinda completely in the shade. I am
referring to the only one of Gottfried August Bürger's letters to Molly, which has been preserved. It contains the following passages: ´I cannot describe to you in words how ardently I embrace you in the spirit.
There is in me such a tumult of life that frequently after an outburst my spirit and soul are left in such weariness that I seem to be on the point of death. Every brief calm begets more violent storms. Often in the
black darkness of a stormy, rainy midnight, I long to hasten to you , throw myself into your arms, sink with you into the infinite ocean of delight and - die. Oh Love! oh Love! what a strange and wonderful power art
thou to hold body and soul in such unbreakable bonds! [...] I let my imagination roam through the whole world, yea, through all the heavens and the Heaven of heavens, and examine every delight and compare it to you,
but by the Eternal God! there is nothing I desire so ardently as to hold you, sweetest and heavenliest of all women, in my arms. If I could win you by walking round the earth, naked and barefoot, through thorns and
thistles, over rocks and snow and ice, and, on the point of death, with the last spark of life, sink into your arms and draw new life and happiness from your loving bosom, I should consider that I bought you for a
trifte."
Quelle: Die drei Stufen der Erotik, 1913
|
|
2016
|
Album amicorum. - Stammbuch des Theologen Georg Wilhelm Prahmer (1770-1812).
Eintrag in: KETTERER KUNST Auktion: 434 / Wertvolle Bücher am 21./22.11.2016 in Hamburg Lot 55
“117 Bll. mit insgesamt 66 Eintragungen überwiegend namhafter Schriftsteller und
Gelehrter, darunter Friedrich Schiller, Christoph Martin Wieland, Friedrich Gottlieb Klopstock, Johann Gottfried Herder, Matthias Claudius u. v. a. Jena, Weimar, Halle, Berlin, Hamburg, Leipzig, Braunschweig u. a.
Aus den Jahren 1789-93.
[...]
Bedeutendes Stammbuch mit Eintragungen großer Dichter und Gelehrter aus nahezu allen wichtigen Zentren des deutschen Geistes zur Zeit der französischen Revolution. - Der
Stammbuch-Besitzer Georg Wilhelm Prahmer wurde 1770 im brandenburgischen Zehdenick geboren, absolvierte in Berlin das Gymnasium zum Grauen Kloster und studierte bis zu seiner Ordination 1793 an der Universität
Halle. Von 1796 bis 1800 war er lutherischer Prediger an der Berliner Charité, zusammen mit Friedrich Schleiermacher, mit dem er während dieser Zeit freundschaftlich verbunden war. In der Diskussion um den dürftigen
Zustand der Charité trug seine vielbeachtete Schrift Einige Worte über die Berlinische Charité (Berlin 1798) wesentlich zur Reform des berühmten Krankenhauses bei. 1800 wurde er Pfarrer in Ahrensfelde, wo er bis zu
seinem frühen Tod 1812 tätig war.
Neben vielen Persönlichkeiten aus seinem Studienort Halle enthält das Album überwiegend Eintragungen von Schriftstellern und Gelehrten, die Prahmer auf mehreren Reisen besucht
hat. Herausragend ist die frühe Eintragung von Friedrich Schiller vom 23. August 1789, der seit Ostern des Jahres Professor für Geschichte an der Universität Jena war und großen Zulauf an Studenten und begeisterten
Lesern hatte. Er zitiert frei aus einem Gedicht von Gottfried August Bürger:
Der Geist gedeyht durch Weißheit
Das Herz durch Schönheit,
Dieser Adel führt zum Ziele
Dauernder Glückseligkeit.
(Bürger's Gedichte)
Zum Andenken von Friedr. Schiller
Jena d 23. Aug. 1789.
Die Tatsache, daß Schiller hier ein Gedicht von Bürger zitiert, ist nicht ohne Pikanterie: Nur anderthalb Jahre später
veröffentlichte er seinen berühmt-berüchtigten Aufsatz Über Bürgers Gedichte , worin er dem populären Balladendichter nicht nur künstlerische, sondern auch charakterliche Schwäche attestiert.”
[Das von Schiller genutzte Zitat stammt aus dem Gesang am heiligen Vorabend des funfzigjährigen Jubelfestes der Georgia Augusta:
und lautet korrekt:
Denn der Geist gedeiht durch Weisheit,
Und das Herz gedeiht durch Schönheit.
Dieser Einklang rauscht in Stärke;
Dieser Adel führt zum Ziele
Dauernder Glückseligkeit. ]
|
|
2024
|
www.uni-goettingen.de Aktuelles
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seminars „Das Feuer der Freiheit. Gedichte und Prosa aus der Demokratiebewegung des Vormärz“
ehrten mit ihrem Dozenten Hermann Engster am 17. Juni 2024 den Göttinger Dichter Gottfried August Bürger als einen frühen Kämpfer für Freiheit und für die Rechte der Unterdrückten, indem sie Texte von ihm rezitieren
und sein Grabmal mit Blumen schmückten.

|
|
bis 1789 1790-1799 1800-1806 1807-1815 1816-1821 1822-1825 1826-1828 1829-1831
1832-1836 1837-1840 1841-1845 1846-1850 1851-1855 1856-1858 1859-1861 1862-1865
1866-1868 1869-1870 1871-1880 1881-1897 1898-1915 1916-1949 ab 1950
nach oben
23082024-175
|
|